Die
Nachtigall

ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch
von Karolina Fell
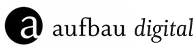
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine internationale Top-Bestseller-Autorin und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Pazifischen Nordwesten der USA und auf Hawaii.
Karolina Fell studierte Philologie und Geschichte und übertrug unter anderem Werke von Jojo Moyes ins Deutsche. Sie lebt als freie Übersetzerin in Berlin.
Zwei Schwestern. Die eine kämpft für die Freiheit. Die andere für die Liebe.
Der Weltbestseller – die Nr. 1 aus den USA
»Ich liebe dieses Buch – große Charaktere, große Geschichten, große Gefühle.« Isabel Allende
Zwei Schwestern im von den Deutschen besetzten Frankreich: Während Vianne ums Überleben ihrer Familie kämpft, schließt sich die jüngere Isabelle der Résistance an und sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die Pyrenäen. Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die schützen, die man liebt?
In diesem epischen, kraftvollen und zutiefst berührenden Roman erzählt Kristin Hannah die Geschichte zweier Frauen, die ihr Schicksal auf ganz eigene Weise meistern.
In den USA begeisterte »Die Nachtigall« Millionen von Lesern und steht seit über einem Jahr auf der Bestsellerliste.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Die
Nachtigall

ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch
von Karolina Fell
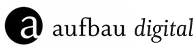
Für Matthew Shear. Freund. Mentor. Kämpfer.
Du wirst vermisst.
Und für Kaylee Nova Hannah,
den jüngsten Stern in unserer Welt.
Willkommen, kleines Mädchen.
Inhaltsübersicht
Über Kristin Hannah
Informationen zum Buch
Newsletter
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreissig
Einunddreissig
Zweiunddreissig
Dreiunddreissig
Vierunddreissig
Fünfunddreissig
Sechsunddreissig
Siebenunddreissig
Achtunddreissig
Neununddreissig
Nachbemerkung
Dank
Impressum
Leseprobe aus: Kristin Hannah – Liebe & Verderben

9. April 1995
AN DER KÜSTE VON OREGON
Wenn ich in meinem langen Leben eines gelernt habe, dann ist es Folgendes: In der Liebe finden wir heraus, wer wir sein wollen; im Krieg finden wir heraus, wer wir sind. Heutzutage wollen die jungen Leute alles über jeden wissen. Sie denken, über ein Problem zu reden wäre schon die Lösung. Ich stamme aus einer schweigsameren Generation. Wir haben verstanden, welchen Wert das Vergessen hat, wie verlockend es ist, sich neu zu erfinden.
In letzter Zeit allerdings ertappe ich mich dabei, wie ich an den Krieg denke und an meine Vergangenheit, an die Menschen, die ich verloren habe.
Verloren.
Das klingt, als hätte ich meine Liebsten irgendwo verlegt; sie vielleicht an einem Ort zurückgelassen, an den sie nicht gehören, und mich dann abgewendet, zu verwirrt, um wieder zu ihnen zurückzufinden.
Aber sie sind nicht verloren. Und auch nicht an einem besseren Ort. Sie sind tot. Heute, wo ich das Ende meines Lebens vor mir sehe, weiß ich, dass sich Trauer ebenso wie Reue tief in uns verankert und für immer ein Teil von uns bleibt.
Ich bin in den Monaten seit dem Tod meines Mannes und meiner Diagnose sehr gealtert. Meine Haut erinnert an knittriges Wachspapier, das jemand zum Wiedergebrauch glattstreichen wollte. Meine Augen lassen mich häufig im Stich – bei Dunkelheit, im Licht von Autoscheinwerfern oder wenn es regnet. Diese neue Unzuverlässigkeit meiner Sehkraft ist nervtötend. Vielleicht schaue ich deshalb in die Vergangenheit zurück. Die Vergangenheit besitzt eine Klarheit, die ich in der Gegenwart nicht mehr erkennen kann.
Ich stelle mir gern vor, dass ich Frieden finde, wenn ich gestorben bin, dass ich all die Menschen wiedersehe, die ich geliebt und verloren habe. Dass mir zumindest verziehen wird.
Aber ich weiß es besser.

Mein Haus, das von dem Holzbaron, der es vor mehr als hundert Jahren erbaute, The Peaks getauft wurde, steht zum Verkauf, und ich bereite meinen Umzug vor, wie mein Sohn es für richtig hält.
Er versucht, sich um mich zu kümmern, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt in dieser schweren Zeit, und deshalb lasse ich mir seine übertriebene Fürsorge gefallen. Was kümmert es mich, wo ich sterbe? Denn darum geht es im Grunde. Es spielt keine Rolle mehr, wo ich wohne. Ich packe das Strandleben von Oregon, zu dem ich mich vor beinahe fünfzig Jahren hier niedergelassen habe, in Kartons. Es gibt nicht viel, was ich mitnehmen will. Doch eine Sache unbedingt.
Ich greife nach dem von der Decke hängenden Griff, mit dem die Speichertreppe heruntergezogen wird. Die Stufen falten sich von der Decke wie der Arm eines Gentlemans, der die Hand ausstreckt.
Die leichte Treppe schwankt unter meinen Füßen, als ich in den Speicher hinaufsteige, in dem es nach Staub und Schimmel riecht. Über mir hängt eine einsame Glühbirne. Ich ziehe an der Schnur.
Es sieht aus wie im Frachtraum eines alten Dampfers. Die Wände sind mit breiten Holzplanken verkleidet, Spinnweben schimmern silbrig in den Winkeln und hängen in Strähnen von den Fugen zwischen den Planken herunter. Das Dach ist so steil, dass ich nur in der Mitte des Raums aufrecht stehen kann.
Ich sehe den Schaukelstuhl, in dem ich saß, als meine Enkel klein waren, dann ein altes Kinderbettchen und ein zerschlissenes Schaukelpferd auf rostigen Federn und den Stuhl, den meine Tochter gerade neu lackierte, als sie von ihrer Krankheit erfuhr. An der Wand stehen mit Weihnachten, Thanksgiving, Ostern, Halloween, Geschirr oder Sportsachen beschriftete Kartons. Darin sind Dinge, die ich nicht mehr oft benutze, von denen ich mich aber dennoch nicht trennen kann. Mir einzugestehen, dass ich zu Weihnachten keinen Baum schmücken werde, ist für mich wie aufzugeben, und im Loslassen war ich noch nie gut. Hinten in der Ecke steht, was ich suche: ein alter, mit Aufklebern gespickter Überseekoffer.
Mit einiger Anstrengung zerre ich den schweren Koffer in die Mitte des Speichers, direkt unter die Glühbirne. Ich hocke mich daneben, habe jedoch prompt solche Schmerzen in den Knien, dass ich mich auf den Hintern gleiten lasse.
Zum ersten Mal seit dreißig Jahren hebe ich den Deckel des Koffers. Der obere Einsatz ist voller Andenken an die Zeit, in der meine Kinder klein waren. Winzige Schuhe, Handabdrücke auf Tonscheiben, Buntstiftzeichnungen, die von Strichmännchen und lächelnden Sonnen bevölkert werden, Schulzeugnisse, Fotos von Tanzvorführungen.
Ich hebe den Einsatz aus dem Koffer und stelle ihn neben mir ab.
Die Erinnerungsstücke auf dem Boden des Koffers liegen wild durcheinander: mehrere abgegriffene ledergebundene Tagebücher; ein Stapel alter Postkarten, der mit einem blauen Satinband zusammengebunden ist; ein Karton mit einer eingedrückten Ecke; eine Reihe schmaler Gedichtbändchen von Julien Rossignol und ein Schuhkarton mit Hunderten Schwarzweißfotos.
Ganz oben liegt ein vergilbtes Stück Papier.
Meine Finger zittern, als ich es in die Hand nehme. Es ist eine carte d’identité, ein Ausweis aus dem Krieg. Das Bild im Passfotoformat. Eine junge Frau. Juliette Gervaise.
»Mom?«
Ich höre meinen Sohn auf der knarrenden Holztreppe, Schritte, die mit meinem Herzschlag übereinstimmen. Hat er schon vorher nach mir gerufen?
»Mom? Du solltest nicht hier oben sein. Mist. Die Stufen sind wacklig.« Er kommt zu mir. »Ein Sturz und …«
Ich berühre sein Hosenbein, schüttle langsam den Kopf. Ich kann den Blick nicht heben. »Nicht«, ist alles, was ich sagen kann.
Er geht in die Hocke, setzt sich zu mir. Ich rieche sein Aftershave, dezent und würzig, und auch eine Spur Rauch. Er hat heimlich draußen eine Zigarette geraucht, eine Gewohnheit, die er vor Jahrzehnten aufgegeben und nach meiner Diagnose vor kurzem wieder angenommen hat. Es besteht kein Grund, meine Missbilligung zu äußern. Er ist Arzt. Er weiß es selbst.
Instinktiv will ich den Ausweis in den Koffer zurückwerfen und den Deckel zuklappen, ihn wieder verstecken. Wie ich es mein Leben lang getan habe.
Doch jetzt sterbe ich. Vielleicht nicht schnell, aber auch nicht gerade langsam, und ich sehe mich gezwungen, auf mein Leben zurückzuschauen.
»Mom, du weinst ja.«
»Wirklich?«
Ich will ihm die Wahrheit sagen, aber ich kann es nicht. Es macht mich verlegen, und es beschämt mich, dieses Versagen. In meinem Alter sollte ich mich vor nichts mehr fürchten – und ganz bestimmt nicht vor meiner eigenen Vergangenheit.
Ich sage nur: »Ich will diesen Koffer mitnehmen.«
»Der ist zu groß. Ich packe die Sachen, die du haben willst, in eine kleinere Schachtel.«
Ich lächle bei seinem Versuch, mich zu kontrollieren. »Ich liebe dich, und ich bin wieder krank. Aus diesen Gründen habe ich mich von dir bevormunden lassen, aber noch bin ich nicht tot. Ich will diesen Koffer mitnehmen.«
»Wozu sollen dir denn die Sachen nützen, die da drin sind? Das sind doch nur unsere Zeichnungen und solches Zeug.«
Wenn ich ihm die Wahrheit längst erzählt oder wenigstens mehr getanzt, getrunken und gesungen hätte, wäre er vielleicht imstande gewesen, mich zu sehen statt einer verlässlichen, normalen Mutter. Er liebt eine Version von mir, die nicht vollständig ist. Ich dachte immer, das wäre es, was ich wollte: geliebt und bewundert zu werden. Doch jetzt denke ich, dass ich in Wahrheit richtig gekannt werden will.
»Betrachte es als meinen letzten Willen.«
Ich sehe ihm an, dass er sagen will, ich solle nicht so reden, aber er befürchtet, seine Stimme könnte schwanken. Er räuspert sich. »Du hast es schon zweimal geschafft. Du schaffst es wieder.«
Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Ich bin zittrig und schwach. Ohne medizinische Hilfe kann ich weder essen noch schlafen. »Natürlich schaffe ich es.«
»Ich will doch nur, dass du gut aufgehoben bist.«
Ich lächle. Amerikaner können dermaßen naiv sein.
Früher habe ich seinen Optimismus geteilt. Ich habe gedacht, die Welt sei ein sicherer Ort. Aber das ist schon sehr lange her.
»Wer ist Juliette Gervaise?«, fragt Julien, und es versetzt mir einen kleinen Schock, ihn diesen Namen aussprechen zu hören.
Ich schließe die Augen, und in der Dunkelheit, die nach Schimmel und längst vergangenem Leben riecht, schweifen meine Gedanken zurück in einem weiten Bogen, der über Jahre und Kontinente hinwegreicht. Gegen meinen Willen – oder vielleicht ihm zufolge, wer kann das wissen? – erinnere ich mich.

In ganz Europa gehen die Lichter aus, wir alle werden sie zu unseren Lebzeiten nie wieder leuchten sehen.
SIR EDWARD GREY ZUM ERSTEN WELTKRIEG
August 1939
FRANKREICH
Vianne Mauriac trat aus ihrer kühlen Küche in den Vorgarten. An diesem schönen Sommermorgen im Loiretal stand alles in Blüte. Weiße Bettlaken flatterten in der Brise, und üppig blühende Kletterrosen entlang der Steinmauer, die ihr Grundstück vor Blicken von der Straße verbarg, boten einen fröhlichen Anblick. Geschäftige Bienen summten zwischen den Blüten, und von weit her hörte Vianne das pochende Stampfen eines Zuges und dann das bezaubernde Lachen eines kleinen Mädchens.
Sophie.
Vianne lächelte. Ihre achtjährige Tochter rannte vermutlich durchs Haus und scheuchte ihren Vater herum, während sie sich für das Samstagspicknick fertig machten.
»Deine Tochter ist ein Tyrann«, sagte Antoine, der an der Tür aufgetaucht war.
Er kam zu ihr, sein pomadisiertes Haar glänzte schwarz in der Sonne. Am Morgen hatte er an seinen Möbeln gearbeitet – einen Stuhl abgeschmirgelt, dessen Oberfläche schon so glatt war wie Satin –, und eine zarte Schicht Holzstaub lag auf seinem Gesicht und seinen Schultern. Er war ein großer Mann, hochgewachsen und breitschultrig, mit kräftigen Gesichtszügen und so starkem Bartwuchs, dass er sich zweimal am Tag rasieren musste.
Er legte seinen Arm um sie und zog sie an sich. »Ich liebe dich, Vianne.«
»Ich liebe dich auch.«
Das war das Fundament ihres Daseins. Sie liebte alles an diesem Mann. Sein Lächeln, die Art, wie er im Schlaf murmelte, nach einem Niesen lachte oder unter der Dusche Opernarien sang.
Sie hatte sich fünfzehn Jahre zuvor in ihn verliebt, auf dem Schulhof, noch bevor sie überhaupt wusste, was Liebe war. Das erste Mal hatte sie in jeder Hinsicht mit ihm erlebt: den ersten Kuss, die erste Liebe, die erste Liebesnacht. Vor ihm war sie ein mageres, linkisches, unsicheres Mädchen gewesen, das zum Stottern neigte, wenn es eingeschüchtert war, was sehr oft vorkam.
Ein mutterloses Mädchen.
Du bist jetzt erwachsen, hatte der Vater zu Vianne gesagt, als er nach dem Tod ihrer Mutter mit ihr auf dieses Haus zugegangen war. Sie war vierzehn Jahre alt gewesen, die Augen vom Weinen verquollen, ihre Trauer unermesslich. Unversehens hatte sich dieses Haus vom Sommerhaus der Familie in eine Art Gefängnis verwandelt. Maman war weniger als zwei Wochen tot, als Papa seine Rolle als Vater aufgab. Bei ihrer Ankunft hier hatte er nicht ihre Hand gehalten oder ihr seine Hand auf die Schulter gelegt, er hatte ihr nicht einmal ein Taschentuch gegeben, mit dem sie sich die Tränen von den Wangen wischen konnte.
Aber ich bin doch noch ein Mädchen, hatte sie gesagt.
Jetzt nicht mehr.
Sie hatte zu ihrer jüngeren Schwester hinuntergesehen, Isabelle, die mit vier Jahren immer noch am Daumen lutschte und nichts von dem ganzen Geschehen begriff. Isabelle fragte in einem fort, wann Maman nach Hause käme.
Als die Tür geöffnet wurde, hatten sie eine große, dürre Frau vor sich, mit einer Nase wie ein Zapfhahn und Augen, die so klein und dunkel waren wie Rosinen.
Sind das die Mädchen?, hatte die Frau gefragt.
Ihr Vater nickte.
Sie werden keine Schwierigkeiten machen.
Es war so schnell gegangen. Vianne hatte es gar nicht richtig verstanden. Ihr Vater gab die Töchter ab wie einen Beutel Schmutzwäsche und ließ sie mit einer Fremden zurück. Der Altersunterschied zwischen den Schwestern war so groß, als kämen sie aus unterschiedlichen Familien. Vianne hatte Isabelle trösten wollen – jedenfalls hatte sie das vorgehabt –, aber ihre Trauer war so übermächtig, dass sie sich um niemand anders sorgen konnte, erst recht nicht um ein so eigensinniges und ungeduldiges und lautes Kind wie Isabelle. Vianne erinnerte sich noch gut an die ersten Tage damals in diesem Haus. Isabelle schrie immerzu, und Madame versohlte ihr den Hintern. Vianne hatte ihre Schwester angefleht, immer wieder gesagt: Mon Dieu, Isabelle, hör auf zu kreischen. Tu einfach, was sie sagt. Doch selbst mit vier Jahren war Isabelle nicht zu bändigen.
All das hatte Vianne ans Ende ihrer Kräfte gebracht – die Trauer um ihre Mutter, der Schmerz, von ihrem Vater verlassen worden zu sein, der plötzliche Wechsel ihrer Lebensumstände und Isabelles gefühlsbeladene, hilfsbedürftige Einsamkeit.
Es war Antoine, der Vianne rettete. In diesem ersten Sommer nach dem Tod ihrer Mutter wurden die beiden unzertrennlich. Mit ihm fand Vianne einen Ausweg. Kaum sechzehn, war sie schwanger, mit siebzehn war sie verheiratet und die Herrin von Le Jardin. Zwei Monate später hatte sie eine Fehlgeburt und verlor sich eine Zeitlang. Man konnte es nicht anders nennen. Sie verkroch sich in ihren Kummer, spann sich in einen Kokon ein, außerstande, sich um irgendetwas oder irgendjemanden zu kümmern – und ganz bestimmt nicht um eine bedürftige, jammernde kleine Schwester.
Aber das waren alte Geschichten. Nicht die Art Erinnerungen, die sie an einem so wunderschönen Tag haben wollte.
Sie lehnte sich an ihren Mann, während ihre Tochter auf sie zurannte und verkündete: »Ich bin fertig. Lasst uns losgehen.«
»Nun«, sagte Antoine grinsend, »die Prinzessin ist bereit, also müssen wir uns in Bewegung setzen.«
Vianne ging lächelnd ins Haus zurück und nahm ihren Hut von dem Haken neben der Tür. Mit ihrem rotblonden Haar, der zarten Porzellanhaut und Augen, die so blau waren wie das Meer, hatte sie sich schon immer vor der Sonne geschützt. Bis sie den breitrandigen Strohhut aufgesetzt und ihre Spitzenhandschuhe und den Picknickkorb zusammengesucht hatte, waren Sophie und Antoine schon vor dem Tor.
Vianne ging zu ihnen auf die unbefestigte Landstraße hinaus, die an ihrem Haus vorbeiführte. Sie war kaum breit genug für ein Auto. Dahinter erstreckten sich weite Heuwiesen, hier und da von grünen Flecken durchsetzt, auf denen roter Klatschmohn und blaue Kornblumen wuchsen. Zwischen den Wiesen lagen kleine Wäldchen. In diesem Abschnitt des Loiretals wurde mehr Grünfutter als Wein angebaut. Obwohl nur knapp zwei Zugstunden von Paris entfernt, befand man sich in einer vollkommen anderen Welt. Nur wenige Touristen verirrten sich hierher, nicht einmal im Sommer.
Gelegentlich rumpelte ein Auto vorbei, ein Radfahrer oder ein Ochsenkarren, meist aber war die Straße verlassen. Sie wohnten etwa anderthalb Kilometer von Carriveau entfernt, einem Städtchen mit weniger als tausend Einwohnern, das vor allem als Station der Pilger auf den Spuren Jeanne d’Arcs Bedeutung hatte. Hier gab es keine Industrie und wenig Arbeit – bis auf die paar Stellen auf dem Flugplatz, der den ganzen Stolz Carriveaus bildete. Es war der einzige Flugplatz in weitem Umkreis.
In der Stadt wanden sich enge Pflasterstraßen zwischen uralten Kalksteinhäusern hindurch, die krumm und schief aneinanderlehnten. Mörtel bröckelte aus den Mauern, Efeu verdeckte den Verfall, der zwar nicht zu sehen, doch überall zu spüren war. Das Städtchen war über Hunderte von Jahren aus krummen Straßen, schiefen Treppen und verwinkelten Sackgassen zusammengeschustert worden. Bunte Farben belebten das Dunkel des Mauerwerks: Rote Markisen leuchteten über schwarzen Metallgestängen, Geranien in Tontöpfen über schmiedeeisernen Balkongeländern. Überall zog etwas den Blick an: das Schaufenster mit pastellfarbenen macarons, grob geflochtene Weidenkörbe voller Käse, Schinken und saucissons, Stiegen mit schimmernden Tomaten, Auberginen und Gurken. Die Cafés waren an diesem Sonnentag gut besucht. Männer saßen um Metalltischchen, tranken Kaffee, rauchten selbstgedrehte braune Zigaretten und diskutierten lautstark.
Ein typischer Tag in Carriveau. Monsieur LaChoa fegte die Straße vor seinem Bistro, Madame Clonet putzte das Fenster ihres Schuhladens, und ein paar halbwüchsige Jungen schlenderten Schulter an Schulter durch die Stadt, kickten ab und zu Unrat von der Straße und reichten sich untereinander eine Zigarette weiter.
Hinter der Stadt bogen Vianne, Antoine und Sophie Richtung Fluss ab. An einer flachen grasbewachsenen Stelle am Ufer stellte Vianne ihren Korb ab und breitete im Schatten eines Kastanienbaums eine Decke aus. Sie nahm eine knusprige Baguette aus dem Korb, eine Ecke üppigen Doppelrahmkäse, zwei Äpfel, ein paar Scheiben hauchdünnen jambon de Bayonne und eine Flasche 36er Bollinger. Sie schenkte ihrem Mann ein Glas Champagner ein, setzte sich neben ihn und sah Sophie dabei zu, wie sie auf der Wiese spielte.
Die Zeit verging in der behaglichen Trägheit eines warmen Sonnentages. Sie unterhielten sich, lachten und genossen ihr Picknick. Erst spät am Nachmittag, als Sophie mit ihrer Angelrute am Flussufer saß und Antoine einen Gänseblümchenkranz für sie flocht, sagte er: »Hitler wird uns bald allesamt in seinen Krieg hineinziehen.«
Krieg.
Die Leute konnten über nichts anderes reden in diesen Tagen, und Vianne wollte es nicht hören. Ganz besonders nicht an diesem schönen Sommertag.
Sie beschattete die Augen mit der Hand und schaute zu ihrer Tochter hinüber. Jenseits des Flusses lag das mit viel Sorgfalt bestellte grüne Tal der Loire. Es gab keine Zäune, keine Begrenzungen, nur kilometerweit wogende grüne Felder, Baumgruppen und hier und da ein Bauernhaus oder eine Scheune. Winzige weiße Blütenblätter schwebten durch die Luft wie Baumwollflöckchen.
Sie stand auf und klatschte in die Hände. »Komm, Sophie. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.«
»Du kannst das nicht ignorieren, Vianne.«
»Ich will mich nicht mit diesem Problem beschäftigen. Warum auch? Wir haben schließlich dich, damit du uns beschützt.«
Lächelnd – vielleicht etwas zu strahlend – packte sie alles in den Picknickkorb, rief ihre Familie zu sich und führte sie zurück zur Landstraße.
In weniger als einer halben Stunde waren sie zurück am massiven Holztor von Le Jardin, dem Landhaus, das sich seit dreihundert Jahren im Besitz ihrer Familie befand. Die Mauern des zweistöckigen Hauses waren in einem Dutzend Grautönen verwittert, und Fenster mit blauen Läden gingen auf einen Obstgarten hinaus. Efeu wuchs an den beiden Kaminen hinauf und bedeckte die Ziegel weiter unten. Es waren nur noch sieben Morgen des ursprünglichen Grundbesitzes übrig. Die anderen zweihundert waren während der letzten zwei Jahrhunderte verkauft worden, als das Vermögen der Familie schrumpfte. Sieben Morgen waren viel für Vianne. Sie konnte sich nicht vorstellen, mehr Land zu brauchen.
Vianne schloss die Haustür hinter ihnen. In der Küche hingen Töpfe und Pfannen aus Kupfer und Gusseisen an einer Eisenstange über dem Herd. Lavendel- und Rosmarinbüschel baumelten zum Trocknen von einem der Deckenbalken herab. In der enormen Kupferspüle hätte man einen Hund baden können.
Der Wandverputz im Haus blätterte an einigen Stellen ab, so dass man die Farbe früherer Anstriche sehen konnte. Die Wohnzimmereinrichtung war eine Mischung aus unterschiedlichsten Stilen – ein mit Gobelinstoff bezogenes Sofa, Aubusson-Teppiche, antikes Chinaporzellan, Chintz- und Toile-Stoffe. Einige der Gemälde an den Wänden waren hervorragend, möglicherweise sogar bedeutend, andere wiederum ohne jeden künstlerischen Wert. Alles strahlte den durcheinandergewürfelten planlosen Eindruck einstigen Reichtums und überkommener Geschmacksvorlieben aus – ein wenig schäbig, aber gemütlich.
Im Salon blieb Vianne stehen und schaute durch die verglasten Sprossentüren in den Garten hinter dem Haus, in dem Antoine dabei war, Sophie auf der Schaukel anzustoßen, die er für sie gebaut hatte.
Behutsam hängte Vianne ihren Hut an den Haken neben der Tür, holte ihre Schürze und band sie um. Während Antoine draußen mit Sophie spielte, wickelte sie eine Schweinelende in dicke Speckstreifen, die sie mit einem Faden festband, und briet sie in heißem Öl an. Während das Fleisch im Ofen garte, bereitete sie die übrige Mahlzeit vor. Um acht Uhr, genau zur rechten Zeit, rief sie zum Essen und musste unwillkürlich über die lauten Schritte, die lebhafte Unterhaltung und das Kreischen der Stuhlbeine auf dem Boden lächeln, als sie sich zu Tisch setzten.
Sophie saß mit ihrem Gänseblümchenkranz, den ihr Antoine am Fluss geflochten hatte, am Kopfende der Tafel.
Vianne stellte die Servierplatte auf den Tisch. Köstlicher Geruch stieg auf – gebratenes Schweinefleisch, knuspriger Speck und glasierte Äpfel in einer gehaltvollen Weinsauce lagen in einem Bett aus gebräunten Kartoffeln. Daneben stand eine Schüssel mit frischen Erbsen, die in Butter schwammen und mit Estragon aus dem Garten gewürzt waren. Und natürlich war auch die Baguette auf dem Tisch, die Vianne gebacken hatte.
Wie immer plapperte Sophie während des gesamten Essens. Was das anging, war sie wie ihre Tante Isabelle – ein Mädchen, das nicht still sein konnte. Erst als sie beim Dessert angelangt waren – îles flottantes, Inseln aus Eischnee, die in einer üppigen crème anglaise schwammen –, stellte sich um den Tisch befriedigtes Schweigen ein.
»So«, sagte Vianne schließlich und schob ihren halbleeren Dessertteller von sich, »es wird Zeit für den Abwasch.«
»O Maman«, jammerte Sophie.
»Kein Gemecker«, sagte Antoine, »dafür bist du zu groß.«
Vianne und Sophie gingen wie jeden Abend in die Küche, nahmen ihre üblichen Plätze ein – Vianne an der tiefen Kupferspüle, Sophie an der gemauerten Ablauffläche – und begannen die Teller zu spülen und abzutrocknen. Vianne roch den süßen, scharfen Geruch von Antoines abendlicher Zigarette, der durchs Haus wehte.
»Papa hat heute über keine einzige meiner Geschichten gelacht«, sagte Sophie, als Vianne die Teller in das Holzregal an der Wand zurückräumte. »Er hat irgendwas.«
»Kein einziges Lachen. Tja, das ist wirklich besorgniserregend.«
»Er macht sich Sorgen über den Krieg.«
Der Krieg. Schon wieder.
Vianne scheuchte ihre Tochter aus der Küche. Oben, in Sophies Schlafzimmer, setzte sich Vianne auf das Bett und hörte dem Geplauder ihrer Tochter zu, während diese ihren Pyjama anzog, sich die Zähne putzte und sich schlafen legte.
Vianne beugte sich vor, um ihr einen Gutenachtkuss zu geben.
»Ich fürchte mich«, sagte Sophie. »Wird es Krieg geben?«
»Hab keine Angst«, sagte Vianne. »Papa wird uns beschützen.« Doch noch während sie die Worte aussprach, erinnerte sie sich an einen anderen Moment, in dem ihre eigene Maman gesagt hatte: Hab keine Angst.
Damals, als ihr eigener Vater in den Krieg gezogen war.
Sophie wirkte nicht überzeugt. »Aber …«
»Kein Aber. Es gibt nichts, worum du dir Sorgen machen musst. Und jetzt schlaf.«
Sie küsste ihre Tochter noch einmal und ließ ihre Lippen einen kurzen Moment auf der Wange des kleinen Mädchens ruhen.
Dann ging sie die Treppe hinunter und wandte sich zum Garten hinter dem Haus. Draußen war es schwül, die Luft von Jasminduft erfüllt. Sie entdeckte Antoine auf einem der eisernen Caféhausstühle, die Beine ausgestreckt, den Oberkörper unbequem zur Seite geneigt.
Sie trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Er stieß einen Schwall Rauch aus und nahm einen weiteren langen Zug an seiner Zigarette. Dann sah er zu ihr auf. Im Licht des Mondes wirkte sein Gesicht blass und verschattet. Er griff in seine Westentasche und zog ein Papier heraus. »Ich bin einberufen worden, Vianne. Gemeinsam mit den meisten Männern zwischen achtzehn und fünfunddreißig.«
»Einberufen? Aber … wir haben keinen Krieg. Ich …«
»Ich muss mich am Dienstag melden.«
»Aber … aber … du bist Postbote.«
Er sah sie an, und plötzlich konnte sie nicht mehr atmen.
»Jetzt bin ich Soldat, so wie es aussieht.«

Vianne kannte den Krieg. Zwar nicht sein Dröhnen und Donnern, nicht den Qualm und das Blut auf den Schlachtfeldern, aber die Nachwirkungen. Obwohl sie zu Friedenszeiten geboren worden war, hatte sich der Krieg in ihre frühesten Erinnerungen eingeprägt. Sie erinnerte sich, wie sie ihre Mutter bei dem Abschied von ihrem Vater hatte weinen sehen. Sie erinnerte sich an den Hunger und das immerwährende Frieren. Aber vor allem erinnerte sie sich daran, wie verändert ihr Vater bei seiner Rückkehr nach Hause war, wie er gehinkt und geseufzt hatte und wie still er gewesen war. Wie er zu trinken begonnen, sich zurückgezogen und seine Familie nicht mehr wahrgenommen hatte. Und danach erinnerte sie sich an Türenknallen, an aufbrandenden Streit, der in unheilvollem Schweigen versiegte, und daran, dass ihre Eltern getrennte Schlafzimmer hatten.
Der Vater, der in den Krieg zog, war nicht derselbe, der wieder nach Hause kam. Sie hatte sich um seine Liebe bemüht, und, wichtiger, sie hatte sich um die Liebe zu ihm bemüht, doch letzten Endes hatte sich das eine als so unmöglich erwiesen wie das andere. Er hatte sie nach Carriveau abgeschoben, und in den Jahren seither hatte sich Vianne ihr eigenes Leben aufgebaut. Sie schickte ihrem Vater Weihnachts- und Geburtstagskarten, bekam jedoch nie eine Antwort; Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch gab es kaum. Hatten sie überhaupt noch etwas zu besprechen? Anders als Isabelle, die außerstande schien, einfach loszulassen, hatte Vianne verstanden – und akzeptiert –, dass ihre Familie mit dem Tod ihrer Mutter für immer zerbrochen war. Er war ein Mann, der es schlicht ablehnte, seinen Kindern ein Vater zu sein.
»Ich weiß, wie sehr du dich vor dem Krieg fürchtest«, sagte Antoine.
»Die Maginot-Linie wird halten«, sagte sie und versuchte, überzeugt zu klingen. »Zu Weihnachten bist du wieder zu Hause.«
Die Maginot-Linie bestand aus kilometerlangen Betonmauern und Befestigungsanlagen und Abwehrstellungen. Sie war infolge des Großen Krieges, der zwischen 1914 und 1918 geführt worden war, zum Schutz Frankreichs entlang der deutschen Grenze errichtet worden. Die Deutschen würden sie nicht durchbrechen können.
Antoine nahm sie in die Arme. Der Jasminduft war berauschend, und mit einem Mal wusste sie ganz sicher, dass sie von jetzt an, wo auch immer sie Jasmin roch, an diesen Abschied denken würde.
»Ich liebe dich, Antoine Mauriac, und ich erwarte von dir, dass du wieder nach Hause kommst.«
Später konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, wie sie ins Haus gegangen waren, die Treppe hinauf, wie sie sich ins Bett gelegt und einander ausgezogen hatten. Sie wusste nur noch, wie sie nackt in seinen Armen lag und er mit ihr geschlafen hatte wie noch nie zuvor, mit rasenden, suchenden Küssen und Händen, die sie auseinanderzureißen schienen, selbst als er sie ganz dicht an sich heranzog.
»Du bist stärker, als du denkst, Vianne«, sagte er, als sie engumschlungen beieinanderlagen.
»Das bin ich nicht«, flüsterte sie zu leise, als dass er es hätte hören können.

Am nächsten Morgen hätte sie Antoine am liebsten den ganzen Tag im Bett behalten, hätte ihn am liebsten dazu gebracht, dass sie ihre Sachen packten und davonliefen wie nächtliche Einbrecher.
Aber wohin hätten sie gehen sollen? Der Krieg bedrohte ganz Europa.
Nachdem Vianne das Frühstück und hinterher den Abwasch gemacht hatte, dröhnte ihr Schädel vor Kopfschmerzen.
»Du siehst traurig aus, Maman«, sagte Sophie.
»Wie könnte ich traurig sein, wenn die Sonne so schön scheint und wir unsere besten Freunde besuchen gehen?« Vianne lächelte ein bisschen zu strahlend.
Erst als sie aus der Haustür getreten war und unter einem Apfelbaum im Vorgarten stand, bemerkte sie, dass sie barfuß war.
»Maman«, sagte Sophie ungeduldig.
»Ich komme«, sagte sie, dann folgte sie Sophie durch den Vorgarten, vorbei an dem alten Taubenhaus, das jetzt ein Gartenschuppen war. Sophie öffnete die hintere Gattertür und rannte in den gepflegten Nachbargarten auf ein kleines Haus mit blauen Fensterläden zu.
Sie klopfte, hörte nichts und ging hinein.
»Sophie!«, sagte Vianne scharf, doch ihre Zurechtweisung traf auf taube Ohren. Manieren waren im Haus der besten Freundin überflüssig, und Rachel de Champlain war seit fünfzehn Jahren Viannes beste Freundin. Schon seit dem zweiten Monat, nachdem Viannes Vater seine Kinder so mitleidlos nach Le Jardin abgeschoben hatte.
Sie waren ein seltsames Paar gewesen: Vianne, schmächtig, blass und ängstlich, und Rachel, so groß wie die Jungs, mit wuchernden Augenbrauen und einer Stimme wie ein Nebelhorn. Zwei Außenseiterinnen, als sie sich kennenlernten. In der Schule waren sie unzertrennlich gewesen und in all den Jahren seither Freundinnen geblieben. Sie hatten gemeinsam studiert und waren beide Lehrerin geworden. Sie waren sogar zur gleichen Zeit schwanger gewesen. Und nun unterrichteten sie beide in der Schule am Ort.
Rachel tauchte mit ihrem Neugeborenen, Ariel, an der offenen Tür auf.
Die beiden Frauen wechselten einen Blick, in dem all ihre Gefühle und Ängste lagen.
Vianne folgte ihrer Freundin in ein kleines sonnenhelles und blitzsauberes Wohnzimmer. Eine Vase mit einem Wildblumenstrauß schmückte die massive aufgebockte Holzplatte des Tischs, um den ein Sammelsurium von Stühlen verteilt war. In der Ecke stand eine lederne Reisetasche, obenauf lag der braune Fedora, den Rachels Mann Marc am liebsten trug. Rachel ging in die Küche und kehrte mit einem Gebäckteller voller canelés zurück. Dann gingen die beiden Frauen hinaus.
In dem kleinen Garten hinterm Haus wuchsen Rosen entlang einer Ligusterhecke. Ein Tisch und vier Stühle standen auf einer unregelmäßig gepflasterten Terrasse. Alte Laternen hingen an den Ästen eines Kastanienbaums.
Vianne nahm einen der kleinen Kuchen, biss ab und genoss das Vanillearoma des weichen Kerns und das knusprige, leicht angebrannt schmeckende Äußere. Sie setzte sich.
Rachel setzte sich ihr gegenüber, das schlafende Baby in den Armen. Zwischen ihnen breitete sich ein Schweigen aus, in dem ihre Ängste und Bedenken mitschwangen.
»Ich frage mich, ob er seinen Vater überhaupt kennenlernen wird«, sagte Rachel schließlich, den Blick auf ihr Söhnchen gerichtet.
»Sie werden sich verändern«, sagte Vianne, in der die alten Erinnerungen wach wurden. Ihr Vater hatte in der Schlacht an der Somme gekämpft, in der mehr als eine Million Männer das Leben verloren hatten. Die wenigen Heimkehrer hatten Gerüchte von deutschen Gräueltaten mitgebracht.
Rachel hob das Kind an ihre Schulter und klopfte ihm sanft auf den Rücken. »Marc ist beim Windelwechseln nicht zu gebrauchen. Und Ari schläft so gern in unserem Bett. Ich schätze, ab jetzt findet Marc das in Ordnung.«
Vianne musste unwillkürlich lächeln. Es war nur eine Kleinigkeit, ein Witz, aber es half. »Antoines Geschnarche ist unerträglich. Ich werde endlich mal richtig ungestörten Schlaf haben.«
»Und wir können uns verlorene Eier zum Mittagessen machen.«
»Und nur die halbe Wäsche«, sagte Vianne, doch dann brach ihre Stimme. »Dafür bin ich nicht stark genug, Rachel.«
»Natürlich bist du das. Wir stehen das gemeinsam durch.«
»Bevor ich Antoine kennenlernte …«
Rachel hob abwehrend die Hand. »Ich weiß, ich weiß. Du warst dürr wie eine Bohnenstange, und du hast gestottert, sobald du nervös wurdest. Ich weiß. Ich war dabei. Aber das ist alles vorbei. Du wirst stark sein. Und weißt du auch, warum?«
»Warum?«
Rachels Lächeln verschwand. »Ich weiß, wie groß und gewaltig ich aussehe – statuesk nennen die Verkäuferinnen das, wenn sie mir Büstenhalter und Strümpfe heraussuchen –, aber jetzt fühle ich mich völlig … verloren, Vianne. Ich werde dich brauchen, damit ich mich auf dich stützen kann. Nicht mit meinem ganzen Gewicht, versteht sich.«
»Damit wir nicht beide gleichzeitig zusammenbrechen.«
»Voilà«, sagte Rachel. »So machen wir es. Sollten wir das nicht mit einem Cognac begießen? Oder lieber mit Gin?«
»Es ist zehn Uhr morgens.«
»Da hast du recht. Wie immer. Also einen Cognac.«

Als Vianne am Dienstag aufwachte, schien die Sonne ins Zimmer und ließ die Deckenbalken glänzen.
Antoine saß am Fenster in dem Schaukelstuhl aus Nussbaumholz, den er während Viannes zweiter Schwangerschaft gebaut hatte. Jahrelang hatte es so gewirkt, als würde sie dieser leere Schaukelstuhl verspotten. Die Fehlschlagsjahre nannte Vianne sie bei sich. Eine Zeit der Trostlosigkeit in einem Land des Überflusses. Drei verlorene Leben in vier Jahren; kaum spürbare, schwache Herzschläge, blaue Händchen. Und dann, wie durch ein Wunder, ein Baby, das überlebte. Sophie. In der Holzmaserung des Schaukelstuhls schienen traurige kleine Geister gefangen, doch er barg auch gute Erinnerungen.
»Vielleicht solltest du Sophie nach Paris bringen«, sagte Antoine, als sie sich aufsetzte. »Julien würde sich um euch kümmern.«
»Mein Vater hat seinen Standpunkt unmissverständlich klargemacht, was das Zusammenleben mit seinen Töchtern angeht. Er wird mich nicht willkommen heißen.« Vianne schob die Matelassé-Decke mit dem schönen Reliefmuster beiseite, schwang ihre Füße auf den abgetretenen Teppich und stand auf.
»Wirst du zurechtkommen?«
»Sophie und mir wird es gutgehen. Davon abgesehen bist du im Handumdrehen wieder hier. Die Maginot-Linie wird halten. Und Gott weiß, dass uns die Deutschen nicht gewachsen sind.«
»Zu dumm, dass ihre Waffen es sehr wohl sind«, sagte Antoine und fuhr dann fort: »Ich habe unser ganzes Geld von der Bank geholt. In der Matratze stecken sechsundfünfzigtausend Francs. Verwende es klug, Vianne. Zusammen mit deinem Gehalt als Lehrerin müsstest du lange damit auskommen.«
Sie wurde nervös. Sie wusste zu wenig über ihre finanziellen Angelegenheiten. Darum kümmerte sich Antoine.
Er erhob sich langsam und nahm sie in die Arme. Das Gefühl der Sicherheit, das sie in diesem Moment empfand, hätte sie am liebsten in Flaschen abgefüllt, um später davon zu zehren, wenn Einsamkeit und Angst sie bedrängten.
Bewahre dir diesen Augenblick in deiner Erinnerung, dachte sie. Die Art, wie sich das Licht in seinem widerspenstigen Haar brach, den liebevollen Blick aus seinen braunen Augen, die aufgesprungenen Lippen, die sie noch eine Stunde zuvor im Dunklen geküsst hatte.
Durch das offene Fenster hörte sie das langsame, gleichmäßige Klapp-Klapp-Klapp eines Pferdes, das die Straße heraufkam, und das Rattern des Wagens, den es zog.
Vermutlich war Monsieur Quillian mit seinen Blumen auf dem Weg zum Markt. Wäre sie im Garten, würde er anhalten, ihr eine Blume geben und sagen, dass sie nicht mit Viannes Schönheit konkurrieren könne, und sie würde lächeln und merci sagen und ihm etwas zu trinken anbieten.
Widerstrebend löste sich Vianne aus Antoines Armen. Sie ging hinüber zu dem hölzernen Toilettentisch, goss lauwarmes Wasser aus einem blauen Porzellankrug in die Schüssel und wusch sich das Gesicht. In dem Alkoven hinter gold-weiß gemusterten Toile-Vorhängen, den sie als begehbaren Schrank benutzte, zog sie ihren Büstenhalter, die mit einer Borte aus Spitze besetzten Unterhosen und das Strumpfband an. Sie rollte die Seidenstrümpfe an ihren Beinen hinauf, strich sie glatt und befestigte sie an den Strumpfbändern. Dann schlüpfte sie in ein Baumwollkleid mit Gürtel und einem eckigen Kragen. Als sie die Vorhänge aufzog und sich umdrehte, war Antoine aus dem Raum gegangen.
Sie ging durch den Flur zu Sophies Zimmer. Ebenso wie das Elternschlafzimmer war es klein, lag unter der Dachschräge, hatte freiliegende Deckenbalken, breite Dielen und ein Fenster, das auf den Obstgarten hinausging. Mit dem schmiedeeisernen Bett, dem Nachttisch, auf dem eine abgenutzte Lampe stand, und einem blaugestrichenen Schrank war der Raum ausgefüllt. Sophies Zeichnungen schmückten die Wände.
Vianne öffnete die Fensterläden und ließ das Licht in den Raum fluten.
Wie immer in den heißen Sommermonaten hatte Sophie irgendwann über Nacht ihre Decke auf den Boden gestrampelt. Ihren rosafarbenen Teddy, Bébé, hatte sie an ihre Wange geschmiegt.
Vianne nahm den Bären in die Hand und betrachtete sein filziges, vielfach gehätscheltes Gesicht. Im Jahr zuvor hatte Bébé vergessen in einem Regal gelegen, und Sophie hatte sich nur noch ihren neuen Spielsachen gewidmet.
Nun war Bébé also zurück.
Vianne beugte sich über ihre Tochter, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben.
Sophie rollte sich zu ihr herum und wachte blinzelnd auf.
»Ich will nicht, dass Papa fortgeht, Maman«, flüsterte sie. Sie griff nach Bébé, riss Vianne den Bären beinahe aus den Händen.
»Ich weiß.« Vianne seufzte. »Ich weiß.«
Vianne ging zum Schrank und nahm das Matrosenkleid heraus, das Sophie am liebsten trug.
»Kann ich die Gänseblümchenkrone aufsetzen, die Papa mir gemacht hat?«
Die »Krone« aus Gänseblümchen lag schlaff auf dem Nachttisch, die kleinen Blüten waren verwelkt. Vianne hob den Kranz vorsichtig hoch und legte ihn auf Sophies Kopf.
Vianne hatte den Eindruck, dass Sophie einigermaßen mit der Situation zurechtkam. Bis sie ins Wohnzimmer ging und ihren Vater sah.
»Papa?« Sophie berührte unsicher den verwelkten Gänseblümchenkranz. »Geh nicht fort.«
Antoine kniete sich hin und zog Sophie in seine Arme. »Ich muss Soldat werden, damit du und Maman sicher seid. Aber ehe du dich’s versiehst, bin ich wieder zurück.«
Vianne hörte das Schwanken in seiner Stimme.
Sophie löste sich ein wenig von ihm. Der Gänseblümchenkranz rutschte seitlich von ihrem Kopf herunter. »Versprichst du, dass du wieder nach Hause kommst?«
Antoine sah an dem ernsten Gesicht seiner Tochter vorbei und suchte Viannes Blick.
»Oui«, sagte er schließlich.
Sophie nickte.
Sie waren alle drei sehr schweigsam, als sie aus dem Haus gingen. Hand in Hand stiegen sie den Hügel hinauf bis zu der grauen Holzscheune. Kniehohes goldglänzendes Gras überzog die Anhöhe, und an der Grundstücksgrenze wuchsen Fliederbüsche, so hoch wie Heuwagen. Drei kleine weiße Kreuze waren alles, was auf dieser Welt auf die drei Babys hinwies, die Vianne verloren hatte. An diesem Tag aber ließ sie ihre Augen nicht darauf ruhen. Sie hatte schon genug mit ihren Gefühlen zu kämpfen, ohne sich auch noch die Last dieser Erinnerungen aufzubürden.
In der Scheune stand ihr alter grüner Renault. Als sie alle in das Auto gestiegen waren, ließ Antoine den Motor an, fuhr rückwärts aus der Scheune und folgte einer Spur aus platt gedrücktem braunem Gras zur Straße. Vianne starrte aus dem kleinen staubigen Fenster, sah das grüne Tal in einer Abfolge vertrauter Bilder an sich vorbeiziehen – rote Ziegeldächer, kleine Bauernhäuser, Heuwiesen und Weinberge, magere Wäldchen.
Viel zu schnell erreichten sie den Bahnhof in der Nähe von Tours.
Auf dem Bahnsteig drängten sich junge Männer mit Koffern, Frauen, die ihnen Abschiedsküsse gaben, und weinende Kinder.
Eine ganze Generation Männer zog in den Krieg. Wieder einmal.
Denk nicht daran, ermahnte sich Vianne. Denk nicht daran, wie es letztes Mal war, als die Männer nach Hause kamen, hinkend, mit Verbrennungen im Gesicht, ohne Arme, ohne Beine …
Vianne ließ Antoines Hand kaum einen Moment lang los, während er ihre Fahrkarten kaufte und sie zum Zug führte. Im Dritte-Klasse-Waggon, in dem es stickig war und heiß und in dem die Leute so dicht gedrängt waren wie die Halme in einem Schilfrohrbündel, saß sie steif aufgerichtet, die Handtasche auf dem Schoß, und umklammerte noch immer die Hand ihres Mannes.
Als sie angekommen waren, stieg etwa ein Dutzend Männer aus. Vianne, Sophie und Antoine folgten den anderen eine Kopfsteinpflasterstraße entlang und in eine reizende Ortschaft, die ebenso hübsch war wie die meisten kleinen Gemeinden der Touraine. Wie konnte es sein, dass der Krieg kam und in diesem malerischen Städtchen mit seinem üppigen Blumenschmuck und den alten pittoresken Gemäuern Soldaten zum Kampf zusammengezogen wurden?
Antoine zog sie an der Hand, damit sie weiterging. Wann war sie stehen geblieben?
Etwas weiter vor ihnen war ein neues zweiflügeliges Eisentor in eine Mauer eingebaut worden. Dahinter waren die Dächerreihen von Behelfsunterkünften zu sehen.
Die Torflügel schwangen auf. Ein Soldat ritt heraus, um die Neuankömmlinge zu begrüßen, der Ledersattel knarrte unter den Bewegungen des Pferdes, das Gesicht des Soldaten war gerötet vor Hitze und staubüberzogen. Er fasste die Zügel kürzer, das Pferd blieb stehen und warf schnaubend den Kopf zurück. Ein Flugzeug dröhnte über sie hinweg.
»Männer«, sagte der Soldat. »Bringt eure Papiere zu dem Lieutenant dort drüben beim Tor. Jetzt gleich. Bewegung.«
Antoine küsste Vianne so sanft, dass sie am liebsten geweint hätte.
»Ich liebe dich«, sagte er, seine Lippen auf ihren ruhend.
»Ich liebe dich auch«, gab sie zurück, aber diese Worte, die immer so bedeutungsschwer gewirkt hatten, schienen plötzlich kein Gewicht mehr zu haben. Was zählte schon die Liebe, wenn es Krieg gab?
»Ich auch, Papa. Ich auch!« Sophie weinte und warf sich in seine Arme. Sie umarmten sich ein letztes Mal als Familie. Dann löste sich Antoine von ihnen.
»Auf Wiedersehen«, sagte er.
Vianne brachte keinen Abschiedsgruß über die Lippen. Sie sah ihm nach, beobachtete, wie er in die Menge der lachenden, gesprächigen jungen Männer eintauchte und in ihr verschwand. Mit einem Knall schlossen sich die Flügel des Eisentores; das metallische Geräusch hallte in der heißen, staubigen Luft nach, und Vianne und Sophie standen allein mitten auf der Straße.

Juni 1940
FRANKREICH
Das mittelalterliche Herrenhaus beherrschte einen tiefgrünen bewaldeten Berghang. Es sah aus, als entstammte es dem Schaufenster einer Konditorei; ein Schlösschen aus Karamell mit Fenstern aus Zuckerwatte und Fensterläden in der Farbe kandierter Äpfel. Weit unter dem Gebäude spiegelten sich die Wolken in einem See. Gepflegte Gartenanlagen ermöglichten es den Bewohnern des Anwesens – und, wichtiger noch, ihren Gästen –, über den Besitz zu schlendern, auf dem nur salonfähige Gespräche geführt werden durften.
In dem repräsentativen Speisezimmer saß Isabelle Rossignol steif aufgerichtet an der aufwändig gedeckten Tafel, an der ohne jede Schwierigkeit vierundzwanzig Personen speisen konnten. Alles in diesem Raum war blass. Die Wände, der Boden und die Decke bestanden aus austernfarbenem Stein. Der Scheitelpunkt des Deckengewölbes befand sich in mehr als sechs Meter Höhe. Der große, kalte Raum verstärkte jedes Geräusch, sperrte es genauso ein wie seine Bewohner.
Madame Dufour stand am Kopfende der Tafel. Sie trug ein streng geschnittenes schwarzes Kleid, das die suppenlöffelgroße Kuhle am Ende ihres langen Halses sehen ließ. Ihr einziger Schmuck war eine Diamantbrosche. (Ein einziges gutes Stück, meine Damen, und sorgfältig ausgewählt muss es sein, denn alles hat seine Wirkung, und nichts ist aufdringlicher als billiger Tand.) Ihr schmales Gesicht mündete in ein stumpfes Kinn und war von Locken umrahmt, die so offenkundig blondiert waren, dass der erwünschte jugendliche Eindruck vollkommen zunichtegemacht wurde. »Das Kunststück«, sagte sie jetzt in ihrer kultivierten knappen Aussprache, »besteht darin, dass man seine Aufgabe still und unbemerkt erfüllt.«
Jedes Mädchen am Tisch trug das maßgeschneiderte blaue Wollkostüm, das die Schuluniform darstellte. Im Winter war es gar nicht schlecht, doch an diesem warmen Juninachmittag war es in dem Kostüm kaum auszuhalten. Isabelle bemerkte, dass sie angefangen hatte zu schwitzen, und auch noch so viel Lavendelseife konnte ihren scharfen Schweißgeruch nicht überdecken.
Sie starrte auf die ungeschälte Orange, die vor ihr mitten auf dem Teller aus edlem Limoges-Porzellan lag. Zu beiden Seiten des Tellers war in penibler Ordnung das Besteck platziert. Vorspeisengabel, Menügabel, Messer, Löffel, Buttermesser, Fischmesser. Es nahm kein Ende.
»Und nun«, sagte Madame Dufour, »nehmen Sie die richtigen Besteckteile in die Hand – leise, s’il vous plaît, leise –, und schälen Sie Ihre Orange.«
Isabelle nahm ihre Gabel und versuchte die scharfen Zinken in die dicke Schale zu stechen, doch die Orange rollte von ihr weg über den Goldrand des Tellers und brachte das Porzellan zum Klappern.
»Merde«, murmelte sie und griff schnell nach der Orange, bevor sie zu Boden fiel.
»Merde?« Madame Dufour stand neben ihr.