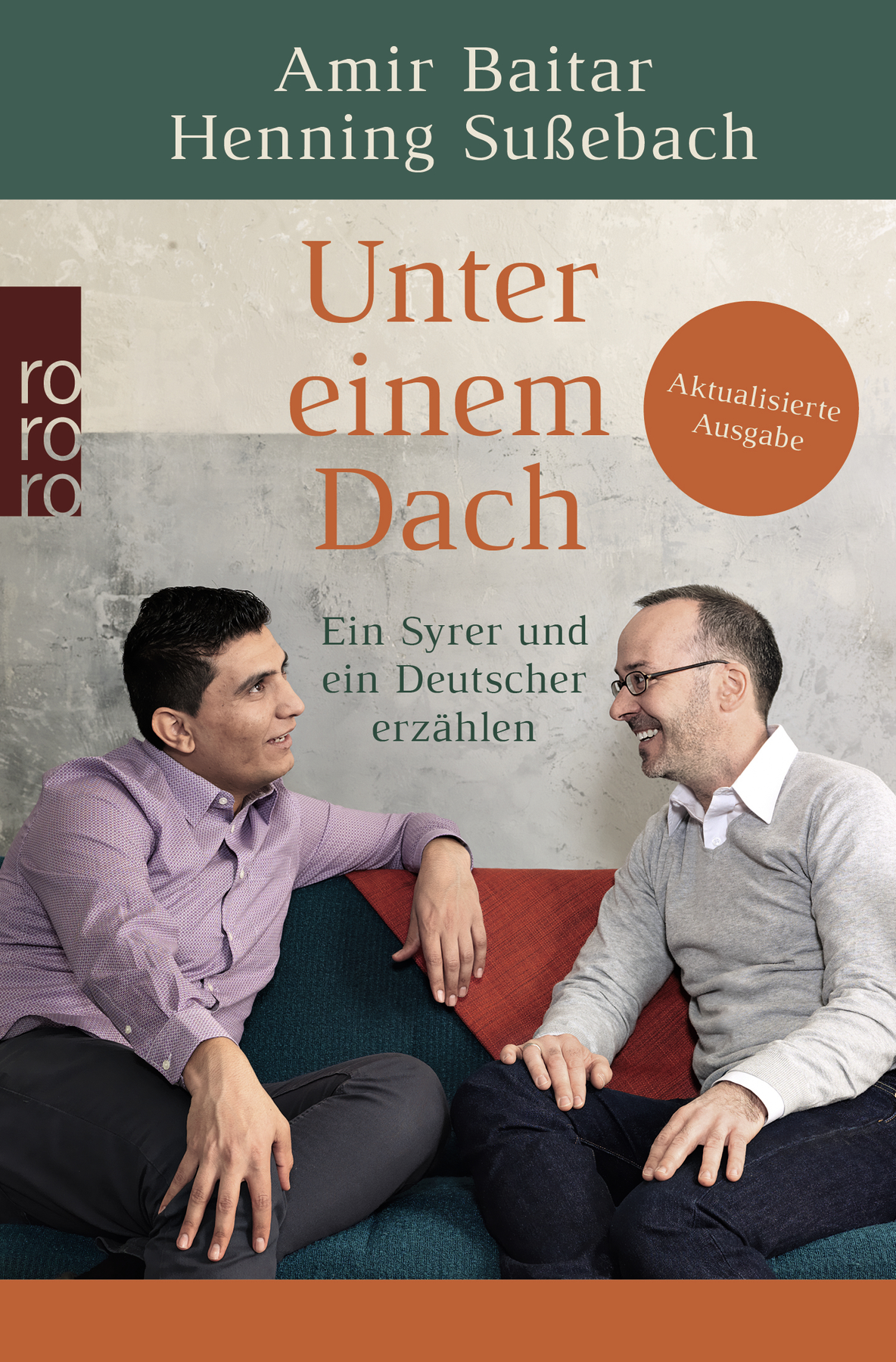
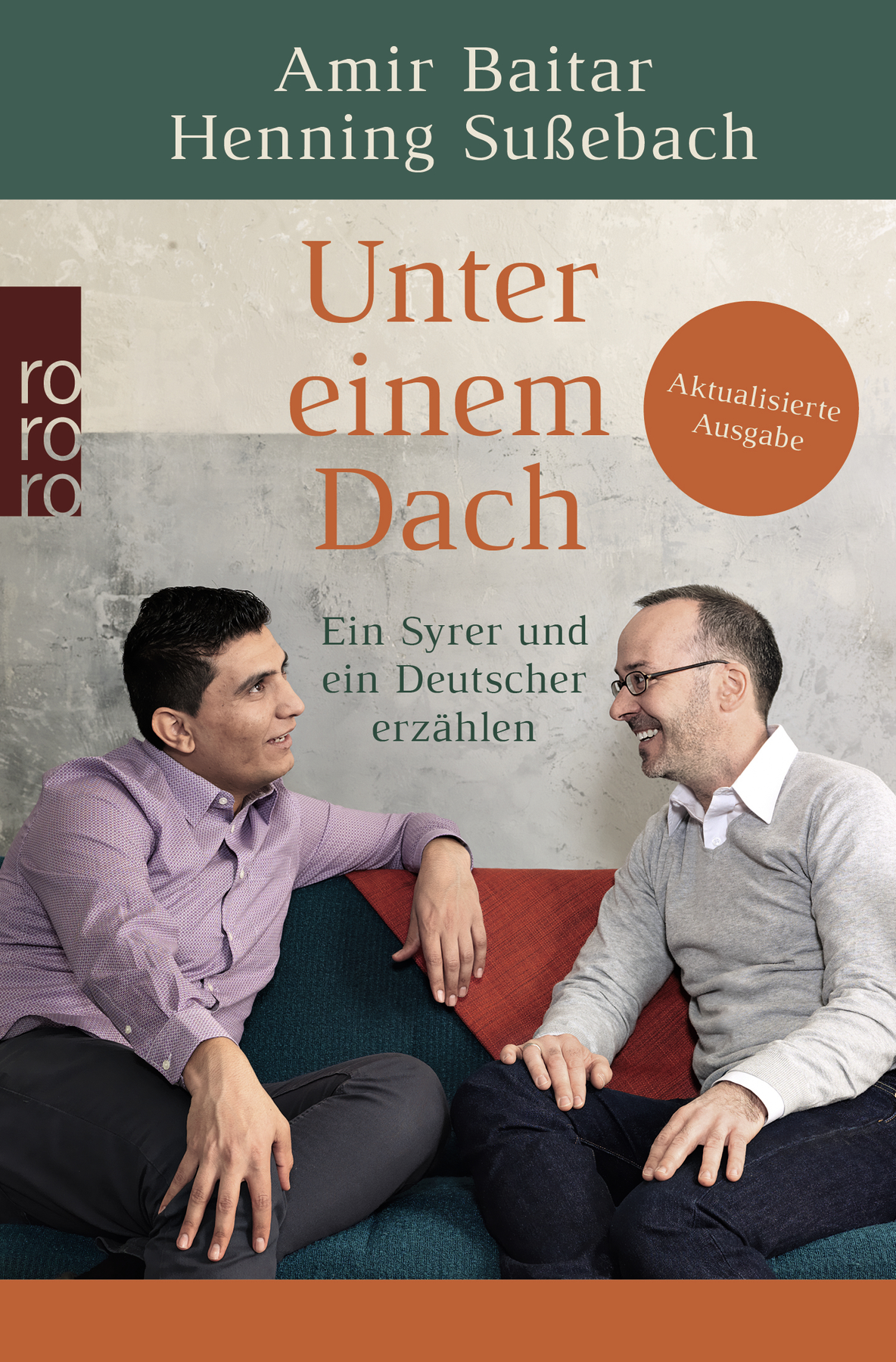
[*]
Alle Namen aus dem Umfeld des Autors Amir Baitar sind geändert. Die seiner Verwandten, um sie in Syrien nicht zu gefährden. Die seiner Freunde in Deutschland, damit sie – unbehelligt vom Echo auf dieses Buch – ihr Leben leben können.
Die Geschichte von Amir und uns, vom Flüchtling und seiner Gastfamilie, sie ist reich an Missverständnissen, komischen Überraschungen und irren Wendungen. Und sie begann gleich mit einer Fehleinschätzung, bei der es um ein großes Zimmer und eine kleine Reisetasche ging. Und hintergründig um viel mehr.
Es war ein Abend im Dezember 2015, windig, kalt und dunkel. In den Nachrichten fiel das Wort «Willkommenskultur» noch ungefähr genauso oft wie «Obergrenze», der Kölner Hauptbahnhof war einfach nur ein Hauptbahnhof, Regionalzüge und Einkaufszentren keine angsterfüllten Orte, und Angela Merkels Satz «Wir schaffen das» wurde zwar schon angezweifelt, doch es gab noch eine Menge Menschen, die den Optimismus teilten, der ihm zugrunde lag. Der Satz war noch nicht tot, noch nicht abgelegt und historisch eingemottet wie ein Ausstellungsstück im Haus der Geschichte in Bonn, wie Konrad Adenauers Mercedes also oder wie Helmut Kohls Strickjacke. Der Satz lebte noch.
Deshalb stand ich am Hamburger Busbahnhof, wartete auf Flixbus Nummer 150 und fror.
Wir schaffen das? Ich hatte einige Zeit gebraucht, um zu begreifen, dass Merkels «Wir» in diesem Satz mal kein behütender pluralis majestatis war, kein Regierungs-Wir und kein Wahlplakat-Wir. Dieses «Wir» bezog ein paar mehr Menschen ein als das Bundeskabinett, es richtete sich auch nicht bloß an Grenzbeamte, Sprachlehrer und Sozialarbeiter. Dieses «Wir» war allumfassend. Es meinte uns. Das «Wir» waren wir! Und wir, das sind: Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Typisch deutsche Vierköpfigkeit in einem Haus in einer Kleinstadt bei Hamburg. Eine ganz normale Familie, die entschieden hatte, sich ins Weltgeschehen einzumischen.
Wir hatten einige Wochen lang gegrübelt, uns gegenseitig beäugt und schließlich beraten. Seit dem Sommer waren da diese Bilder gewesen: der tote Junge an einem türkischen Strand. Die ungarische Kamerafrau, die einem Mädchen ein Bein stellte. Flüchtlingsgruppen, die durch bayerische Milchtütenlandschaft zogen. Inwieweit ging uns das etwas an? Wir hielten uns für politisch, das schon. Aber bislang hatte «sich für politisch halten» bedeutet: Zeitung lesen, Nachrichten gucken, wählen gehen, eine Meinung haben, bei zwei Meinungen diskutieren. Niemand von uns ist Mitglied in einer Partei. In der Kleinstadt, in der wir leben, haben wir kein einziges Mal eine Ratsversammlung besucht. Ich glaube, wir gehören einer Generation an, die unter dem Eindruck aufgewachsen ist, dass Politik oft etwas Fernes, Abstraktes, schwer Beeinflussbares ist – ob sich die Chinesen an ihren Aktienmärkten verspekulieren, die Europäer nächtelang ergebnislos in Brüssel tagen oder die Amerikaner sich für immer beängstigendere Präsidenten begeistern. Zugleich hat Politik, wenn es um persönlichen Konsum geht, eine kleinteilige, konkrete Seite. So, wie wir auf unseren Handys in den Systemeinstellungen die Bildschirmhelligkeit regulieren, Klingelton und Hintergrundbild auswählen, drehen wir graduell an unseren Lebensstilen rum: bisschen weniger Autofahren, bisschen weniger Fleisch essen, bisschen weniger Strom verbrauchen, bisschen mehr spenden.
Wenn Politik nah war, war sie also meistens klein. Wenn sie groß war, war sie eher fern. Kriege, Attentate, Putsche; all das sah man sich aus sicherer Distanz an. Sogar als in Berlin die Mauer fiel, mussten wir hinfahren, um wirklich dabei zu sein.
Das war jetzt anders. Die eine Million Flüchtlinge gab es nicht nur als Bildpunkte auf dem Fernsehschirm. Sie liefen durch unser Land. Auf dem Weg zur Arbeit sahen wir sie an Bahnhöfen stehen, sie stiegen mit uns in die Straßenbahnen und warteten vor uns an der Supermarktkasse. Falls es stimmte, was Politiker sagten, dass nämlich eine neue Völkerwanderung im Gange sei, dann gab es zu dieser keinen historischen und auch keinen räumlichen Sicherheitsabstand mehr. Dies geschah hier und jetzt, nicht im Geschichtsbuch. Und ob es gutgehen oder schieflaufen würde – das lag in unseren Händen.
Heute kann ich nicht mehr sagen, welche genauen Anteile an Überzeugung, Pflichtgefühl, Abenteuerlust und Selbstverliebtheit uns bewogen, einen Menschen aus dieser Million aufzunehmen: Amir, 24 Jahre alt, Syrer, aufgewachsen in einem Dorf am Euphrat. Er würde aus Sachsen kommen, umsteigen in Berlin und aussteigen in Hamburg, Haltebucht Nummer 15.
Ich war seit Jahren nicht mehr am Busbahnhof gewesen. Vermutlich ist das ein Zeichen von Wohlstand, vielleicht auch Weltfremdheit. Wie Auswandererschiffe legten Busse an und wieder ab, kamen aus Belgrad, Moskau und Priština, fuhren nach Anklam, Kiew und Zgorzelec. Auch wenn nur die Bustüren seufzten, und das hydraulisch: Dies war definitiv ein Ort, an dem Romane beginnen und enden können. Ich meinte Gesichter voller Melancholie und Müdigkeit zu sehen, Einwanderer, Auswanderer und Glücksritter, buchstäblich Bepackte und Beladene. Niemanden mit Alukoffer, keinen Bahncomfort-Kunden. Kurz streifte mich der Gedanke: Drüben am Hauptbahnhof steigen jene ein und aus, die über ihr Leben bestimmen. Hier am Busbahnhof einige, über die das Leben bestimmt.
Sofort verbot ich mir dieses Urteil wieder, wie so vieles, was mir durch den Kopf ging seit unserer Entscheidung, einen Fremden aufzunehmen. Von dem Augenblick an, in dem wir Merkels «Wir» zu unserem gemacht hatten, liefen unablässig innere Monologe in unseren Köpfen: Sollten wir Amir mit einem Geschenk empfangen? Oder würden wir ihn beschämen, falls er keins für uns haben würde? Lag zu viel Spielzeug in den Kinderzimmern herum und kündete stumm von zu viel Sorglosigkeit? Hing irgendein Foto in unserem Haus, eine zahnweiße Familienikonographie, die ihm all seine Verluste vor Augen führen würde? Oder müsste er mit dem derzeitigen geographischen und geschichtlichen Glück in Deutschland nicht ohnehin leben? War Amir nicht genau deshalb gekommen?
Eigentlich haben meine Frau und ich mit Besuchen Erfahrung. Wir wissen, welches Essen unseren Eltern nicht schmeckt, welche Bücher unseren Nichten eine Freude machen und wie wir einen verregneten Nachmittag mit der Verwandtschaft rumkriegen, ohne uns auf die Nerven zu gehen. Jetzt wussten wir so gut wie nichts. Sollten wir Amir sofort einen Hausschlüssel geben? Würden wir Eltern, wie zuletzt öfter, abends ins Kino gehen und ihm unsere Kinder anvertrauen? Sollten wir, als wäre nichts, unsere Portemonnaies offen herumliegen lassen? Würde Amir das als Vertrauensbeweis begreifen oder als Test missverstehen?
Statt Antworten: Aktionismus. In den Tagen vor Amirs Ankunft räumten wir unser Arbeits- und Gästezimmer leer, trugen diesen ganzen Organisationskrempel aus Strom- und Müllabrechnungsordnern, Onlinebanking-Unterlagen und PIN-TAN-Generatoren hinauf ins Schlafzimmer, sortierten Bücher aus, brachten einiges an Ladekabel- und Was-war-das-noch-mal-Elektroschrott zur Müllkippe, leerten Schrank um Schrank und Schublade für Schublade, bis da fünf mal drei Meter Raum waren: ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, eine Schrankwand, ein Computer. Fünf mal drei Meter Deutschland. Fünf mal drei Meter Leere, die sich füllen sollte. Fünf mal drei Meter, auf denen sich Politik und Privatsphäre aufs engste vermischen würden. Fünf mal drei Meter, auf denen wir gesaugt, gewischt und richtig Platz geschaffen hatten.
All die Verwicklungen, bei denen es um Bartlängen und Telefonküsse, Alkohol und hartgekochte Eier, Frauenhaut und Colaflaschen gehen würde, waren da noch Zukunft. Die erste Verwirrung war eine andere, sie wurde offenbar, als an jenem Abend im Dezember Bus 150 ankam. Als einer der letzten Passagiere stieg Amir aus, graue Jeans, graue Jacke, schwarzes Haar. Wir hatten wohlmeinend ein ganzes Zimmer für ihn leergeräumt. Doch in seinen Händen hielt Amir nur eine kleine Sporttasche und eine Plastiktüte. Zeug für eine Schublade. Mehr hatte er nicht dabei.
Der Mann wartete am Bahnhof auf mich. Er war schmal, nicht groß, hatte schütteres Haar und trug eine Brille. Henning sah aus wie ein typisch deutscher Mann. Ich hatte ihn kurz vor meiner Ankunft benachrichtigt, dass ich in zehn Minuten in Hamburg sei. Er antwortete: «You are welcome!» Mir war das vorher nicht klar gewesen, aber er war extra zum Busbahnhof nach Hamburg gekommen.
Mit dem Auto fuhren wir hinaus in eine kleine Stadt in der Nähe von Hamburg. Die Häuser waren neu und schön anzusehen, einige hatten spitze Dächer, andere waren flach wie Würfel. Früher hatte ich immer gedacht, alle Häuser in Deutschland hätten einen roten Dachgiebel.
Unterwegs erzählte Henning, er habe Maklouba gekocht. Mir ging das Herz auf! Er hatte tatsächlich darüber nachgedacht, was ich wohl gern essen möge, und dann nicht etwa Nudeln oder Pizza gemacht oder irgendein anderes normales Gericht, sondern ein arabisches! Und sogar mit Huhn, obwohl die Familie fast kein Fleisch isst, wie ich heute weiß. Sie hatten es nur mir zu Ehren gekocht! Das hat mich sehr berührt.
«Da sind wir», sagte Henning. Das Auto blieb vor einem Haus stehen, das weiß war und aus zwei Stockwerken bestand.
Ich hatte die Familie schon einige Wochen vor meinem Einzug getroffen, zu einem ersten Kennenlernen. Damals lebte ich noch in einem Flüchtlingsheim in Sachsen. Verglichen damit, machte das Haus auf mich sofort einen sehr ordentlichen und sauberen Eindruck, von allen Seiten schien die Sonne hinein. Das Haus war groß; auch wenn unser Haus in Syrien noch größer war: die Fläche doppelt so groß, fünf Zimmer. Meine Mutter organisierte den Haushalt, mein Vater arbeitete auf unserem Acker. Wir waren dreizehn Geschwister: sechs Brüder und sieben Schwestern, die älteren waren bereits ausgezogen. So lebten wir, bevor der Krieg losbrach. Ein Unglück, das mir noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schien.
In meinem neuen Zuhause empfing mich die Familie herzlich. Nicole, Hennings Frau, führte mich im Haus herum. Zuerst zeigte sie mir das Zimmer unten, in dem ich wohnen würde – mein Zimmer. Es war anders, als ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, dass meine deutsche Familie in einer kleinen Wohnung lebte; und ich würde im Dachgiebel des Hauses unterkommen, der so winzig wäre wie die durch Holzwände abgetrennten Arbeitsbereiche in einem Großraumbüro, wie ich sie aus amerikanischen und europäischen Filmen kenne.
In meinem Zimmer standen leere Regale, ein paar Bilder hingen an der Wand. Auf einem Schreibtisch stand ein Apple-Computer, den ich benutzen könne, wann immer ich wolle, wie Henning sagte. Im Zimmer gab es auch ein Bett, oder besser: ein Schlafsofa. In Syrien hatte ich immer auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. An die Wände meines Zimmers dort hatte ich Karten gehängt, eine Karte der arabischen Welt, eine Syrienkarte und einige Koranverse. Auch wenn in meinem neuen Zimmer einiges anders war, fühlte ich mich doch wohl.
Überall im Haus standen Skulpturen, es gab viele Bücher und Aktenordner, deren Inhalt ich bis heute nicht kenne. Nicole zeigte mir noch die Zimmer der Kinder und das Zimmer von ihr und Henning. Alle liegen im oberen Stockwerk. Im Raum meiner Gasteltern stand eine Nähmaschine. Als ich sie sah, musste ich sofort an meine Mutter denken. Sie kann sehr gut nähen.
Die Tochter und der Sohn haben jeweils ein eigenes Zimmer, was, wie ich inzwischen weiß, in Deutschland normal ist. Nicht so bei uns zu Hause, denn wie sollte das gehen, wenn eine Familie fünf oder sieben Kinder hat? Auch ich habe mir in Syrien ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Wenn er von der Arbeit kam, schliefen wir beide dort, manchmal waren wir sogar zu dritt.
Seltsam fand ich, dass die Küche sich zum Wohnzimmer hin öffnet, wie das, glaube ich, in Deutschland oft der Fall ist. In meiner Heimat sind die Wohnzimmer strikt von der Küche getrennt. Wenn ich hier kochen möchte, zieht der Geruch durch die ganze Wohnung. Man stelle sich einmal vor, wie es ist, Fisch zu kochen!
Kein Zaun umgibt das Grundstück, keine Mauer. Es gibt keinerlei Schutz für das Haus und die Menschen, die darin leben – nicht nur das war neu für mich, als ich im Dezember 2015 bei dieser deutschen Familie einzog. Vieles, was mir heute vertraut ist, erschien mir damals höchst ungewöhnlich. Und manches, was ich anfangs gar nicht wahrnahm, ist mir bis heute fremd geblieben.
In Syrien sind die Häuser normalerweise von Mauern und Zäunen umgeben. Bei uns zu Hause verlief eine hohe Mauer um das Haus und den Garten, die einem das Gefühl von Sicherheit vermittelte. Hier öffnete ich manchmal die Türen, um zu lüften. In den ersten Tagen fürchtete ich mich ein wenig und schloss sie rasch wieder.
Doch auch in meiner Heimat schützten die Mauern die Hausbewohner nicht, niemand fühlte sich damals sicher, und keine Mauern konnten die Bewohner vor den Flugzeugen und der Artillerie bewahren. Die Häuser sind jetzt leer, täglich sterben Menschen.
Wir hatten von Amir erstmals per Mail erfahren, die unter dem Betreff «Hier bittet jemand um Hilfe» durch den Verlag kreiste, bei dem ich arbeite. Hier bittet jemand um Hilfe? Mit solchen Worten schleicht sich andauernd Spam in unsere Postfächer. Ich hätte die Mail ungelesen gelöscht, wäre nicht ein Kollege der Absender gewesen. Genauer: Der Kollege hatte da nur etwas weitergeleitet.
Das Schreiben kam ursprünglich aus Zschopau, einer Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge. Eine Frau namens Anne, die sich dort in einer Unterkunft um Flüchtlinge kümmerte, schrieb über Amir: «Er hat eine ganz typische schreckliche Fluchtgeschichte. Er kommt aus der Nähe von Deir ez-Zor, wo er auch studierte. Er flieht vor dem IS, dessen Anhänger ihm angekündigt haben, dass sie ihn enthaupten wollen, da er ‹westliche Wissenschaften› studiert (Mathe und Informatik). Und er flieht vor Assads Armee, die seine Uni und das Krankenhaus in seinem Heimatort bombardiert hat und zu der er eingezogen werden soll, wie jeder junge Syrer – töten oder getötet werden. Sein Weg: Türkei, Griechenland, Balkan, Inhaftierung in Ungarn und durch einen blöden Zufall (das GPS war ausgefallen und der Schlepper kannte den Weg nicht) ist er in Sachsen und nicht in Bayern über die Grenze gebracht und verhaftet worden.» Seit acht Monaten sitze Amir nun in Zschopau, ein Syrer unter Syrern in einem Sechsbettzimmer, in einem Heim am Waldrand. Er wolle nach Westen, in eine Großstadt, an eine Universität, sein Studium beenden. Erst so würde er seine Flucht vor sich und seiner Familie rechtfertigen können.
Der historische Kontext, in dem ein Mensch Entscheidungen fällt, ist aus der Froschperspektive des Einzelnen schwer zu erkennen – wenn überhaupt, dann meist erst im Rückblick. Heute wissen wir, dass Amirs Hilferuf genau in jene Phase seltsamer Stille hallte, in der in Deutschland die Stimmung von einem Extrem ins andere kippte. Die Zeit der spätsommerlichen Bahnhofs-Ergriffenheit (und auch der Ergriffenheit angesichts der eigenen Ergriffenheit) ging über in frühwinterliche Furcht vor zu vielen Flüchtlingen (und auch in Furcht, was diese Furcht alles anrichten könnte, wenn man sie ignorierte). Genau auf diesem Kipppunkt drückten wir auf den Antwortbutton unseres Mailprogramms und schrieben zurück, wir könnten uns vorstellen, diesen Fremden aufzunehmen. Zählten wir damit zu den letzten Gefühligen? Oder zu den Ersten, die sich dem emotionalen Hin und Her entzogen – einfach dadurch, dass wir mit unserer Entscheidung von Meinenden zu Wissenden werden würden? Anders als Politiker und Kommentatoren – ganz egal, welcher Weltanschauung – würden wir ja, wie Forscher, Tag für Tag Integrationsstudien betreiben können, am Flüchtling und an uns selbst.
Bevor es so weit kam, war allerdings noch eine heute grotesk anmutende Situation zu überstehen. Es gab nämlich vier Bewerber für diesen einen Flüchtling! So wurde aus Amir, dem Bittsteller, der Gastgeber einer Casting-Show, in der wir Gastgeber zu Bittstellern wurden. Deutschland sucht den Superstar? Germany’s next Topmodel? Voice of Germany? Jetzt war Der große Willkommens-Contest angesagt, Chef der Jury: Amir Baitar. Er würde vergleichen können, wir nicht.
Gemeinsam mit Anne, der Frau aus Sachsen, kam Amir für ein Wochenende nach Hamburg und besuchte Bewerber für Bewerber für Bewerber für Bewerber. Wir waren die Ersten. Auf dem Wochenmarkt hatten wir bei einer Iranerin Baklava gekauft, sirupsatte Süßigkeiten aus dem Nahen Osten.
Als wir Amir zum ersten Mal sahen, war ich ein wenig verblüfft – und erschrak gleich über diese Verblüffung. Amir sah nicht gerade ausgemergelt aus, nicht wie all die Fernsehflüchtlinge, eher wie ein gemütlicher Kerl, der viel rumgesessen hatte. Genau das hatte er in Sachsen auch gemacht, erzählte seine Begleiterin: auf seinem Zimmer gehockt, auf den Ausgang des Asylverfahrens gewartet und stark gesüßten Tee getrunken. Erst Monate später sollte Amir uns erzählen, wie wenig er seinen eigenen Körper mochte, als er sich bei uns vorstellte. Sogar der war ihm in der Fremde fremd geworden.
An jenem Wochenende saß Amir an unserem Küchentisch, und unsere Kinder – zehn und fünfzehn Jahre alt – bissen sich auf die Lippen, als sie sahen, wie er Löffel für Löffel kleine Zuckerpyramiden in seine Teetasse balancierte. War das bei uns zu Hause nicht verpönt? Und die Ellenbogen auf dem Tisch? Und beim Trinken schlürfen? Amir berichtete von den Islamisten des IS, die ihm vor der Universität die Jeans aufgeschnitten hatten, weil sie in ihren Augen zu eng waren. Mit unseren Fingerkuppen vollzogen wir im Atlas seine Flucht nach. Amir sprach passables Englisch, für sein Deutsch waren die weltpolitischen Verwicklungen noch zu kompliziert. Die Kinder hörten Amir zu, stumm und staunend. Unsere beiden Katzen strichen um seine Beine. Am Ende machten wir eine Stadtrundfahrt und tauschten Telefonnummern.
Richtig viel erfuhren wir an jenem Nachmittag von Amir nicht. Und er auch nicht von uns. Wir sprachen nicht darüber, wer seine Wäsche waschen würde. Ob wir gemeinsam kochen würden. Wie lange er bei uns wohnen könnte. Wir nannten seine Zeit bei uns unpräzise «eine Brücke in ein neues Leben». Höflichkeit schlug Offenheit. Wir fanden Amir nett, hinter seiner Zurückhaltung glaubten wir Zugänglichkeit zu erkennen. Das sollte vorerst reichen.
Wir haben bis heute nicht erfahren, wie Der große Willkommens-Contest weiterging. Was Amir bei den anderen drei Bewerbern erlebte, zwei alleinlebenden Männern und einem älteren Paar – Amir ist zu höflich, uns davon zu berichten. Er fuhr zurück nach Sachsen und schickte hin und wieder WhatsApp-Nachrichten, orthographisch so wacklig wie sein damaliger Status:
Es gefällt mir. We visited a lot of things. Everything there ist super. Ich wünsche dir eine gute nacht. Mit süßen träumen …
Hallo. Hamburg meine lieblingsstadt, ich hoffe, dass Hamburg my bright future ist.
I want to live mit euch …
Heute denke ich: Die Wahl muss Amir unendlich schwergefallen sein, trotz aller Vergleichsmöglichkeiten. Als er zu uns kam, war er zwar schon seit Monaten im Land, hatte aber erst ein- oder zweimal ein deutsches Haus betreten. Konnte er entschlüsseln, was er sah? Hatte er auch nur ansatzweise Antworten auf Fragen bekommen, die er nicht zu stellen wagte? Wochen später sollten wir merken: Der Umzug von der Asylunterkunft in unser Haus war für Amir ein ähnlich großer Schritt wie seine Flucht über zwei Kontinente. Er verließ seine syrische Sechsbettkapsel und betrat in unserem Haus gewissermaßen erstmals deutschen Boden.
Im März 2015 kam ich in Sachsen an. Meine Flucht hatte ich im Sommer zuvor geplant – das Ziel war Deutschland. Ich floh, um in Europa weiterstudieren zu können, am liebsten in England, aber Deutschland war auch attraktiv, weil es für seine Arbeits- und Studienmöglichkeiten bekannt war. Seit meiner Kindheit mochte ich das Land, weil ein Verwandter väterlicherseits dort lebte. Außerdem hatten die meisten meiner guten Universitätsdozenten in Deutschland studiert, weshalb ich bereits vor dem Krieg davon geträumt hatte, einmal in Deutschland eine Universität besuchen zu können. Ich hatte von Hamburg, Berlin und München gelesen und über Google-Recherchen herausgefunden, dass in Aachen, Stuttgart, Leipzig und Hamburg gute Universitäten für mein Fachgebiet waren.
Am Ende hat man wenig Einfluss darauf, wo einen die Schlepper über die Grenze führen. Mich hatte der Schlepper mit neun anderen syrischen Flüchtlingen über die tschechisch-deutsche Grenze gelotst, ich werde noch darüber berichten. Nach einigen Tagen in einem Übergangscamp brachte man uns in ein Heim in Zschopau. Die Menschen im Ort machten uns sehr deutlich, dass sie uns dort nicht haben wollten. Mit die ersten Worte Deutsch, die ich lernte, waren: «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.» Im Herbst fanden sich jeden Samstag rechte Demonstranten vor unserem Haus ein. Ich traute mich nicht allein auf die Straße. So hatte ich mir Deutschland nicht vorgestellt.
Es ist leider so, dass man als Asylbewerber erst umziehen kann, wenn der Asylantrag bewilligt ist. Man darf zunächst nicht arbeiten, und man durfte damals auch noch keinen Integrationskurs machen. Ein halbes Jahr nach meiner Ankunft erhielt ich einen Anruf, dass mein Asylantrag angenommen worden sei, und am 15. Dezember bekam ich einen Reiseausweis für Flüchtlinge, der mir gestattete, den Wohnort zu wechseln. In der ganzen Zwischenzeit passierte: nichts. Ich wusste, man muss Geduld haben, aber ich bin fast geplatzt vor Ungeduld. Die Tage wurden länger und länger, monatelang habe ich wenig anderes gemacht, als im Heim zu sitzen. Die anderen Syrer dort waren alles nette Menschen, wir kannten uns zum Teil schon seit der Flucht, trotzdem wollte ich irgendwann einfach allein sein und vor allem: etwas zu tun haben.
Den ganzen Tag surfte ich auf Facebook, sah Nachrichten, wurde träge und hatte kaum noch Hoffnung auf so etwas wie ein Leben in Deutschland. Die einzigen Deutschen, die ich in dieser Zeit kennenlernte, waren ein Sozialarbeiter und Anne, eine sehr nette junge Frau, die in der Nähe wohnte und ab und zu vorbeikam. Ich wusste nicht, wie die Deutschen leben und was sie denken. Ich wusste nur: Die Leute in Sachsen hießen uns nicht willkommen. In den Nachrichten las ich von der «Willkommenskultur», sah Bilder von klatschenden Menschen am Münchner Hauptbahnhof. In Sachsen war davon nichts zu spüren. Ich wollte einfach nur weg aus Zschopau, überall schienen die Menschen freundlicher als hier.
In Syrien hatte ich mir vorgestellt, ich könnte in einer Großstadt mein Studium weiterführen. Ich habe in einem Dorf am Rand von Deir ez-Zor gelebt, einer Stadt mit etwa 300000 Einwohnern. Nach Aufständen der Opposition wurde Deir ez-Zor 2011 zunächst von Truppen der Regierung besetzt. 2013 dann eroberte der «Islamische Staat» Teile der Stadt und terrorisierte die Bevölkerung. Viele Menschen litten Hunger. Irgendwann wurde es zu gefährlich, zur Uni zu gehen, der IS hat viele Studenten bedroht.
Als ich nach Monaten des Wartens die Nachricht erhielt, dass mir Asyl gewährt werden sollte, war ich überfroh. Sollte mein Traum wahr werden? Ich sprach mit Anne. Wir überlegten, wie ich am besten nach Hamburg kommen könnte. Anne schrieb eine Mail an einen Freund in Hamburg, dann ging plötzlich alles sehr schnell: Ich hatte vier Wohnungsangebote in Hamburg. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
Anfang Dezember fuhr ich nach Hamburg, als Erstes zu Hennings Familie. Ich war zunächst skeptisch. Ich wusste nicht, wo dieser Vorort liegt. Und ob ich von dort wirklich nach Hamburg zur Universität kommen würde. Aber die Familie empfing mich sehr warm. Als wir zusammen am Tisch saßen, ging der Sohn zum Sofa. Dort steckten noch Papierherzen mit Buchstaben, die zusammengenommen den Namen der Tochter ergaben – sie war kurz zuvor von einem Auslandsaufenthalt nach Hause gekommen. Der Sohn steckte die Herzen so um, dass plötzlich A M I R zu lesen war. Als ich das sah, bekam ich eine Gänsehaut. Bedeutete das nicht, dass sogar die Kinder mich willkommen hießen?
Am Nachmittag fuhr ich mit Anne zur nächsten Person, einem alleinstehenden Mann. Er fragte direkt, ob ich Muslim sei und ob ich bete. Natürlich bin ich Muslim, natürlich bete ich. Das hat ihm nicht gefallen, er hatte wohl Vorurteile wegen meines Glaubens. So etwas hatte ich befürchtet. Am nächsten Morgen stellten wir uns noch einem Ehepaar vor. Die beiden waren sehr freundlich, aber die Chemie stimmte nicht richtig. Schließlich kamen wir zu einem älteren Mann, der im Norden Hamburgs wohnt. Ein unglaublich netter Mensch. Es ist mir schwergefallen, mich zwischen ihm und der Familie zu entscheiden.
In Syrien waren wir eine große Familie. Ich bin es gewohnt, dass viel los ist. Mir gefiel die Vorstellung, das Leben einer richtigen Familie in Deutschland kennenzulernen. In Sachsen hatte ich nicht herausfinden können, welche Gewohnheiten die Menschen in Deutschland haben, was sie essen, worüber sie sprechen, wie ihre Kinder aufwachsen. Das alles wollte ich wissen. Ich freute mich auf das Leben mit der Familie. Darauf, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden und mich richtig zu integrieren.
Eigentlich hatten wir für Amir (und auch für uns) eine Art assistiertes Einleben vorgesehen. Bevor Amir sich ordentlich integrieren würde – nach landläufiger Meinung: Deutsch lernen, Arbeit suchen und dann vierzig Jahre in die Sozialkassen einzahlen –, davor jedenfalls würde er wissen müssen, wo in unserem Haus er frische Handtücher und neues Toilettenpapier findet, in welcher Küchenschublade die Brotmesser liegen und wo im Keller die Kartoffeln, wie die Waschmaschine funktioniert, wo sich die Spülmaschinentabs und der Sicherungskasten verbergen und wann er – falls wir mal weg sein sollten – Schneeschippen müsste (als Syrer womöglich erstmals im Leben). Auch wollten wir Amir in aller Ruhe den Weg zum Discounter und zum Bahnhof zeigen. Wir wollten schauen, ob er ein Paar feste Schuhe und einen Wollpulli für den Winter bräuchte, Handschuhe, Mütze und Regenschirm, auf dass sich in seinem Zimmer eine zweite Schublade fülle. Wir wollten ihn seine Flucht erzählen und einen Stammbaum seiner Familie zeichnen lassen. Wir wollten ihn unseren Nachbarn vorstellen und bald mit ihm ans Meer fahren, damit sein neues Zuhause kein winziger, bezugsloser Fleck in einem unendlichen Unbekannten bliebe.
In einem Film wären das alles Schlüsselszenen gewesen, auf die sich später vieles bezieht.
Es kam anders. Als sich Amir für uns entschieden hatte, hieß es, er werde «in einigen Monaten» aus Sachsen zu uns kommen, dann «in ein paar Wochen». Schließlich rief Amir an und sagte: «Ich komm in drei Tagen.»
Dummerweise war «in drei Tagen» genau vier Tage, bevor wir in einen lang geplanten Familienurlaub aufbrechen wollten, über Weihnachten und Neujahr. Kaum wäre Amir da, wären wir also weg, er zwei Wochen allein in unserem Haus – und unser Haus zwei Wochen allein mit ihm. Offenbar machte sich das Schicksal einen Spaß daraus, unsere Entscheidung und all ihre Konsequenzen kurzfristig mit einem Zeit- und Stressfaktor zu multiplizieren.
In den vier Tagen, die uns zwischen Amirs Ankunft und unserer Abreise blieben, besorgten wir ihm ein gebrauchtes Fahrrad, kramten für ihn einen Ersatzschlüssel aus den Tiefen unseres Garderobenschranks, erklärten ihm Spülmaschine, Waschmaschine und Staubsauger, meldeten ihn (weil die Ämter da keine Verzögerung dulden) beim Einwohnermeldeamt an, stellten ihn beim örtlichen Jobcenter vor und nahmen Kontakt zur Sprachschule auf, in der Amir seinen Deutsch- und Integrationskurs belegen sollte. Wir gingen mit ihm alle Küchenschubladen durch, klebten für die zu erwartende Behördenpost ein Schild mit seinem Namen an unseren Briefkasten, kauften mit ihm Grundnahrungsmittel ein (darunter sehr viel Zucker), halfen ihm bei der Eröffnung des ersten Girokontos seines Lebens (weil die Ämter danach gefragt hatten) und rannten mit ihm ins örtliche Büro der gesetzlichen Krankenkasse (weil Amir mit der Anerkennung seines Asyls nicht mehr über den Staat versichert war). Wir erklärten ihm die Schlaf-, Fress- und Kratzgewohnheiten unserer Katzen und verwandten sehr viel Zeit darauf, Amir das deutsche Mülltrennungssystem begreiflich zu machen. Braune Tonne? Schwarze Tonne? Papiermüll? Gelber Sack für grünen Punkt? Für ein ordentliches deutsches Leben braucht es eine Betriebsanleitung. Wir sahen Angst in Amirs Augen. Und hatten Sorge, er könnte uns für Superspießer halten.
Amir muss das alles wie in Trance wahrgenommen haben, ganz so, als habe Franz Kafka das Skript für jene Tage geschrieben. Syrien brannte, und wir raschelten mit Gelben Säcken vor ihm rum.
SMS
Einige Antworten verrieten Freude, andere Verblüffung. Eine lautete knapp: «Gut zu wissen.»
Als wir nach vier Tagen Turbo-Einweisung in ein deutsches Vorstadtleben ins Taxi zum Flughafen stiegen, stand Amir in Jogginghose und Schlappen vor unserem Haus und winkte. Noch vor dem Abflug erhielten wir eine WhatsApp-Nachricht:
Ich vermisse euch.
So ging es zwei Wochen lang weiter:
Jetzt bin ich bei unseren Nachbarn. Elisabeth und Dirk.
Ich habe ein Platz in Sprachschule !!!
Wie geht es euch? Wann kommt euch zurück nach Hause?
Als wir wiederkamen, standen Blumen auf dem Tisch, Amir wartete an der Tür wie der Hausherr. Auf die Frage, wie es ihm im leeren Haus ergangen sei, sagte er: «War okay.»