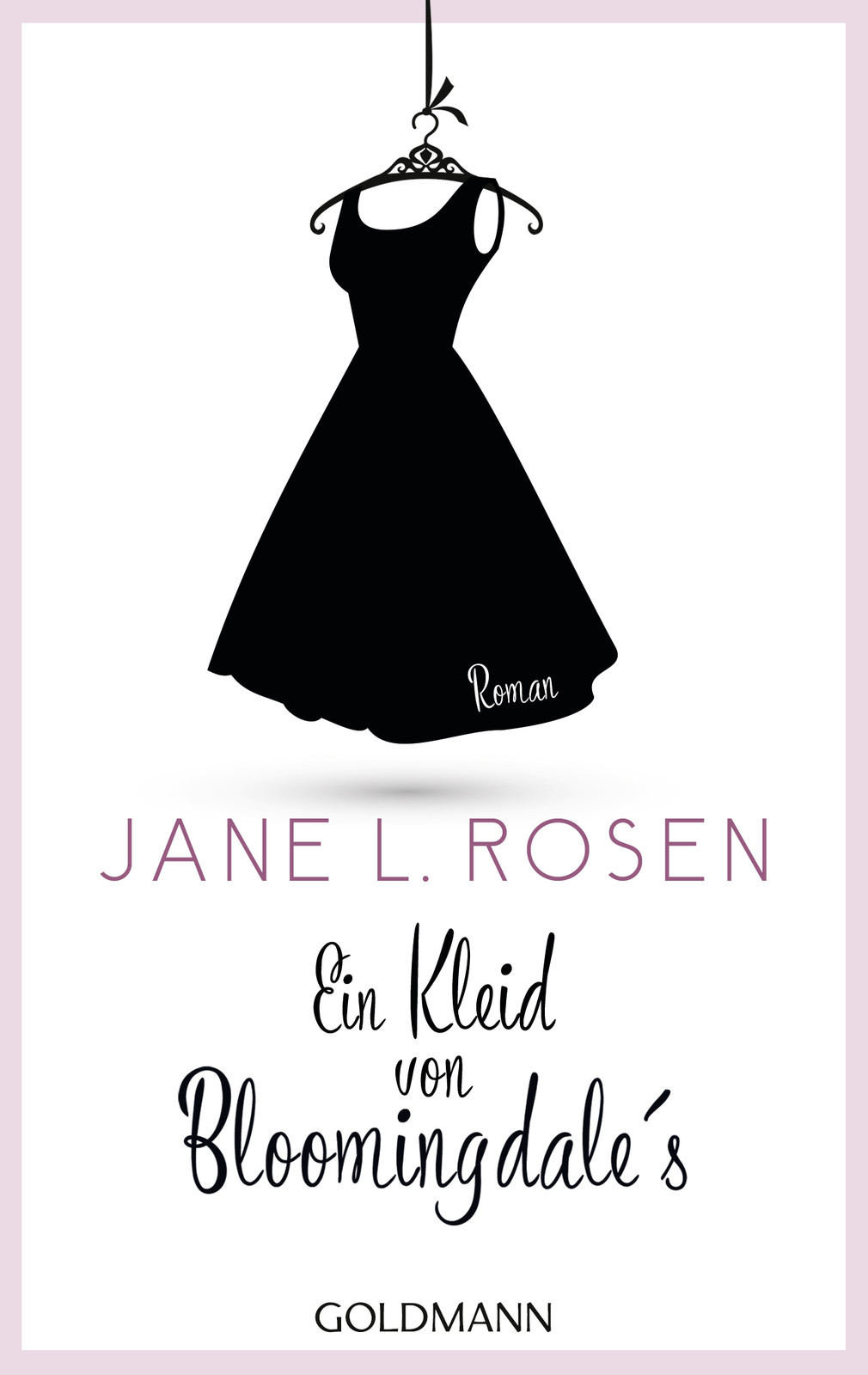
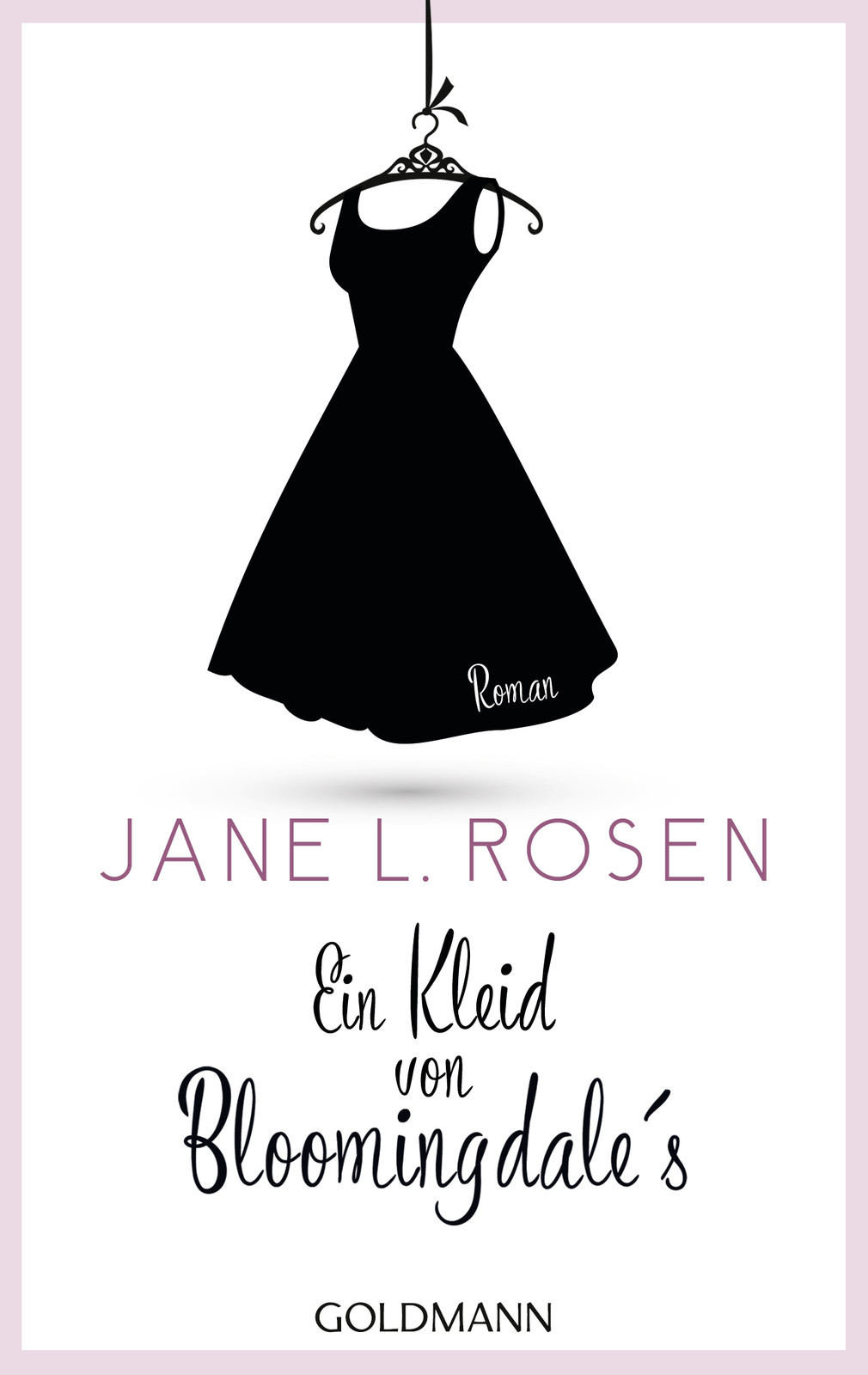
Buch
Im Kaufhaus Bloomingdale’s weiß man, dass so manche Saison ein besonderes Kleid hervorbringt. Ein Kleid, das mehr New Yorkerinnen tragen wollen als jedes andere. Ein Kleid, das Leben verändert. Und auch diese Saison scheint ein kleines Schwarzes Wunder zu vollbringen. Da ist zum Beispiel Natalie – Verkäuferin bei Bloomingdale’s –, deren Exfreund nach nur zwei Monaten Trennung neu verlobt ist. Als der umwerfende Schauspieler Jeremy Madison sie bittet, sie zur Premiere seines neuesten Films zu begleiten, ist das nicht nur die Gelegenheit, einmal das Kleid anzuziehen, sondern endlich mal wieder Spaß zu haben. Gott sei Dank ist Jeremy laut neuesten Presseberichten schwul, und Natalie kann einfach sie selbst sein. Das Kleid verändert auch das Leben der liebenswürdigen Felicia, die seit zwanzig Jahren heimlich in ihren Chef verliebt ist. Und auch Andrea, auf fremdgehende Männer spezialisierte Privatdetektivin, erlebt eine Überraschung. Und so macht das Kleid seinen Weg, heilt Herzen, lässt sie höher schlagen und führt sie auf wunderbare Weise zusammen …
Autorin
Jane L. Rosen lebt mit ihrem Mann und drei Töchtern im Teenageralter in New York City und auf Fire Island. Am liebsten lässt sie sich von ihrer Stadt und den Menschen, die dort leben, inspirieren. Sie schreibt unter anderem für die Huffington Post und hat auch schon in der Filmindustrie gearbeitet. »Ein Kleid von Bloomingdale’s« ist ihr erster Roman.
JANE L. ROSEN
Ein Kleid
von Bloomingdale’s
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Stefanie Retterbush
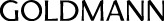
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel »Nine Women, One Dress« bei Doubleday,
a division of Random House LLC, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung
eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung April 2017
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Jane L. Rosen
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Sigrun Zühlke
MR · Herstellung: Str.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-18891-7
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

In liebevollem Andenken
an Ruthellen Levenbaum Holtz
»Das Entscheidende bei einem Kleid
ist die Frau, die es trägt.«
YVES SAINT LAURENT
Vorwort
Der Laufsteg
Von Sally Ann Fennely, Laufstegmodel
Alter: gerade 18
Mach da noch ’ne Nadel rein!« Die Garderobieren liefen hektisch durcheinander wie eine Schar kopfloser Hühner.
»Wo rein?«, dachte ich. »Autsch!« Da hatte ich meine Antwort: in mich.
Es war vollkommen irre. Seit dem Casting hatten sie mindestens fünfmal meine Maße genommen. Eigentlich hatte ich gedacht, das wäre das Schlimmste an der ganzen Geschichte: fünfzig hufescharrende Models, ordentlich aufgereiht wie Rennpferde, die in schwarzen Unterkleidchen sabbernd von Cheeseburgern träumen. Eine Fleischbeschau, aber so ganz anders als das, was wir zu Hause in Alabama darunter verstehen.
Zaghaft wagte ich einzuwenden: »Es ist mir zu groß. Vielleicht sollte es lieber eins der kräftigeren Mädchen tragen.«
»Kräftigere Mädchen gibt’s hier nicht«, murmelte der Garderobier mit den locker sitzenden Nadeln kaum hörbar.
Verstohlen schaute ich mich um – stimmt, er hatte recht. Letzte Woche war ich noch ein dürres, wenn nicht sogar das dürrste Mädchen südlich der Mason-Dixon-Linie. Früher nannten mich alle immer Bohnenstange und fragten, ob ich unter der Dusche tanzen müsse, um überhaupt nass zu werden. Und plötzlich bin ich die Kräftigste von allen.
»Aufstellen!«, bellte der Typ mich an. Brav stellte ich mich mit den anderen in eine Reihe.
Und versuchte, mich nur auf das Mantra in meinem Kopf zu konzentrieren: atmen, atmen, ein Fuß, der andere Fuß. Atmen. Atmen. Das Mädchen hinter mir störte meine Konzentration mit dem stärksten New Yorker Akzent, den ich je gehört hatte.
»Ich glaube, du trägst heute das Kleid«, sagte sie. Es klang mehr nach einer Warnung als nach einer Feststellung.
»Das Kleid?« Ich kapierte überhaupt nicht, wovon sie redete. Mir fiel schon das Atmen schwer. Und der Laufsteg rückte unerbittlich näher. Sie redete unverdrossen weiter.
»Jedes Jahr gibt es das eine Kleid, nach dem alle verrückt sind. Die VIPs in der ersten Reihe entscheiden, welches Kleid das Kleid wird. Siehst du?« Und damit zeigte sie zur Bühne, wo die beiden voluminösen Vorhänge sich trafen. Sie teilten und bauschten sich und fielen dann wieder zusammen, und währenddessen konnte ich einen kurzen Blick auf die Menschenmenge draußen erhaschen und wünschte mir sofort, ich hätte nicht gesehen, was mich hinter dem Vorhang erwartete.
Sie plapperte unbeeindruckt weiter. »Bis zum Herbst werden die Promis aus der ersten Reihe dieses eine Kleid auf die Zeitschriftentitel bringen, auf den roten Teppich und in die Schaufenster der großen Läden. Und normalerweise ist es ein kleines Schwarzes – so wie deins.«
Wenn man sie so reden hörte, konnte man glatt vergessen, wie umwerfend hübsch sie war. Wie bei den alten Stummfilmstars, von denen meine Großmama immer erzählte. Die waren auch aufgeschmissen, als der Tonfilm groß rauskam. In meinen Ohren klang sie so fremd, als käme sie von einem anderen Planeten. Aber hätte ich meinen Südstaatenakzent ausgepackt, hätte sie vermutlich auch kein Wort mehr verstanden. Weswegen ich, seit ich in New York war, kaum noch den Mund aufmachte. Wenn ich etwas sage, dann möglichst knapp und überdeutlich. Ein, zwei Sätze bekomme ich hin, ohne dass irgendwer was merkt. Ich muss mir große Mühe geben, mindestens dreimal so schnell zu reden wie gewöhnlich, weil mich die Leute sonst bald so ungeduldig angucken, als müssten sie mir jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Und meine Gedanken müssen mit dem, was ich sage, ja auch noch irgendwie Schritt halten, was gar nicht so einfach ist. Offensichtlich verstehen sie mich genauso wenig wie ich sie. Womit wir also eigentlich auf Augenhöhe sein müssten. Sind wir aber nicht. Nicht hier.
Reden ist nicht das einzige Problem. Ich versage schon beim Gehen. An meinem ersten Tag in New York habe ich den unverzeihlichen Fehler begangen, einfach wie angewurzelt stehen zu bleiben und staunend an einem Wolkenkratzer hochzuschauen, und, RUMMS, schon gab es den ersten Auffahrunfall. Ein Mann war ungebremst von hinten in mich reingelaufen und schrie mich an: »Hast du sie noch alle, blöde Tussi?« Als hätte ich mitten auf der Interstate 10 eine Vollbremsung hingelegt. Ich stellte mir den daraus folgenden Dominoeffekt vor – wie die ganze Stadt ins Straucheln gerät, alles nur meinetwegen.
Am nächsten Tag regnete es. Schon im Trockenen war es nicht einfach, heil durch die Stadt zu navigieren, ganz zu schweigen von einem sintflutartigen Wolkenbruch. Ich war so eingeschüchtert, als ich sah, wie die New Yorker leichtfüßig die Pfützen umrundeten und gekonnt die Regenschirme hoben und senkten wie in einem perfekt einstudierten Ballett, dass ich es nicht weiter als bis zum Vordach unseres Hauses schaffte. Es kam mir vor, als hätten alle anderen heimlich die Choreografie für jenen Tag einstudiert – alle, nur ich nicht. Starr blieb ich stehen und rührte mich nicht vom Fleck, bis irgendwann die Sonne wieder rauskam.
Währenddessen quasselte das Mädchen mit der unangenehmen Stimme immer noch über das Kleid. Zwischen uns und dem Laufsteg stand noch etwa ein Dutzend Mädchen.
»Es gibt noch ein anderes Kleid, das infrage käme, von einer Show gestern. Meine Freundin Adeline hat es getragen. Das könnte auch das Kleid gewesen sein. Adeline meinte, es war ein irres Blitzlichtgewitter, vor allem als sie ans Ende des Laufstegs kam. Sie hofft, dass es wirklich ihrs ist. Ich wäre gerne das Mädchen, das es seiner Freundin gönnt, das Kleid zu präsentieren. Bin ich aber nicht. Es würde mich fertigmachen, wenn sie es tatsächlich auf den Titel von Women’s Wear Daily schafft. Das Kleid erscheint immer auf dem Titel von Women’s Wear Daily. Und dann drehen plötzlich alle durch und wollen es unbedingt haben, und auf einmal ist es überall. Das Kleid kann über Nacht zum Star werden und das Model, das es trägt, gleich mit. Das Mädel vom vorletzten Jahr soll angeblich gerade eine Rolle im neuen Woody-Allen-Film bekommen haben. Ein ganz neues Gesicht, genau wie du. Du weißt ja, das neue Gesicht ist man nur einmal. Und das Kleid trägt meistens entweder das neue Gesicht oder ein sehr bekanntes Gesicht. Und jetzt macht Woody Allen ihr neues Gesicht weltbekannt! Meinst du, er ist pädophil? Ich will das gar nicht glauben.«
Sie schien keinen Gedanken ans Atmen zu verschwenden, während ich an nichts anderes denken konnte. Noch acht Mädchen zwischen uns und dem Laufsteg.
Sie redete weiter. »Letzte Woche hat mir jemand erzählt, die Zitronenscheiben, die immer an den Wassergläsern stecken, sollen lebensgefährlich sein. Total verkeimt und verunreinigt, sogar mit Fäkalien – hat dieses Mädchen jedenfalls behauptet. Weil die Kellner sich nicht die Hände waschen. Dabei kommt die Zitronenscheibe in meinem Wasser unter den Sachen, die ich in den letzten drei Jahren gegessen habe, einem Stück Kuchen noch am nächsten. Was soll ich denn jetzt machen? Manchmal glaube ich, ganz egal, wann ich sterbe, meine letzten Worte werden sein, ich hab immer noch Hunger. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles, was ich je über Zitronen und Woody Allen gehört habe, wieder ungehört machen. Ich will das gar nicht wissen.«
Eine Zitrone, dachte ich. Das Einzige, woran ich diese Mädchen zum Nachtisch je hatte nuckeln sehen, waren Zigaretten. Sie waren alle gleich. Aus einem Ei gezogen, wie man bei uns zu Hause sagen würde. Sie liefen alle gleich, federleicht und elfenhaft. Sie schwebten förmlich über den Laufsteg, während ich mir vorkam wie ein Bauerntrampel in Gummistiefeln. Und sie redeten alle gleich. Ihre Sätze bestanden aus Wörtern, die in meinen Ohren überhaupt keinen Sinn ergaben. Wie ernsthaft oder echt oder ehrlich. Ehrlich dies und ehrlich das. Man fragte sich, ob alles andere, was ihnen aus dem Mund sprudelte, Lügen waren. Und viele ihrer Geschichten begannen mit »Sei mir nicht böse«. Als wäre das eine »Du kommst aus dem Gefängnis frei«-Karte. »Sei mir nicht böse, aber ich habe mit deinem Freund geschlafen«, oder »Sei mir nicht böse, aber ich habe gestern Abend den ganzen Nusskuchen aufgegessen«. Wobei, ehrlich, den zweiten Satz würde echt keins der Mädchen je im Leben sagen. Ernsthaft, das ist echt ansteckend.
Noch sechs Mädchen vor mir. Ich weiß nicht mal, wie ich hierhergekommen bin. Na ja, wobei, das stimmt nicht so ganz. Ich bin mit einem Greyhound-Bus hierhergekommen. Wenn man mit einem Gesicht wie meinem geboren wird, und Beinen bis zum Kinn, dann braucht man sich gar nicht erst groß den Kopf zu zerbrechen, was man sonst noch so mit seinem Leben anfangen könnte. Ich war immer ganz gut in der Schule, aber das hat niemanden interessiert. Wenn meine nicht viel jüngere Schwester Carly und ich mit unseren Zeugnissen aus der Schule nach Hause kamen, schaute meine Mutter sich das von Carly immer ganz genau an. Meins überflog sie nur. Meine Schwester ist klein, so wie die ganze Familie meiner Mutter. Sie war ziemlich frühreif und in der Grundschule die Größte, aber in der Highschool haben die anderen sie alle überholt. Sie ist normal klug, kein Genie oder so. Ich bin genauso klug wie sie. Aber meine Zeugnisse schaute meine Mutter sich nicht mal richtig an. »Mit deinen Beinen«, sagte sie immer, »brauchst du dir nur den richtigen Mann zu suchen, um ihn damit einzuwickeln. Carly muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.« Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr, mich überhaupt anzustrengen.
Es waren ja auch nicht nur die Beine. Es war das Gesicht, die Haut, die Haare, das ganze Paket. Eine Schönheit, bei der die Leute auf der Straße stehen bleiben und starren, als würden sie ein Gemälde betrachten. Ein sehr großes Gemälde. Ich war makellos. Zumindest äußerlich. Innerlich verging ich fast vor Eifersucht auf Carly. Sie machte den Mund auf, und die Menschen mochten sie, oder sie mochten sie nicht. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich betrat einen Raum, und die Jungs mochten mich. Ohne ein Wort von dem zu hören, was ich zu sagen hatte. Ich fühlte mich so einsam, dass ich schließlich meine Sachen packte und nach New York ging, um mit Dutzenden anderer perfekter Wesen in einer Reihe zu stehen und mir dabei hundsgewöhnlich vorzukommen. Ein tolles Gefühl – bis gerade eben. Nur noch vier Mädchen vor mir, allesamt mit diesem Gesicht, dieser Haut und diesen Beinen … Moment, noch drei. Ich stemmte die Hände in die Rippen, damit sie nicht so zitterten.
Die nasale Quengelstimme riss mich aus meiner nervösen Grübelei.
»Und nicht nur die Zitronen, weißt du. Auch die Minzbonbons im Schälchen vorn an der Rezeption – die wurden auch getestet, und …«
Ich hoffte sehr, dass dies hier nicht das Kleid war. Es erschien mir so schlicht. Ich denke, das Kleid müsste doch spektakulär sein und laut, wie das Mädchen, das mir gerade ein Ohr abkaute. Das Kleid, das ich anhatte, war eher still. Wobei ich eigentlich so gut wie nichts von Mode verstehe. Ich weiß nur, was in den Modemagazinen steht, und in denen hatte ich auch bloß hin und wieder geblättert, wenn Mom mit Carly und mir zur Mani- und Pediküre nach Batesville gefahren war. So bin ich überhaupt erst in New York gelandet. In einer von diesen Zeitschriften stand ein Artikel: Hast du das Zeug zum Model? Ich bin die Checkliste durchgegangen. Mindestens eins fünfundsiebzig. Passt. Brustumfang 78–86 Zentimeter. Passt. Taille 55–60 Zentimeter. Passt. Hüftumfang 78–89 Zentimeter. Passt. Sie haben mich gleich im Nagelsalon vermessen. Und noch ehe die beiden Lackschichten »Cherry on Top« auf meinen Fingernägeln getrocknet waren, war mein Schicksal besiegelt. Meine Eltern hatten nur für eine von uns genug Geld fürs College zusammengespart, und »Carly ist nun mal die Schlaue«.
»Los!« Ein Schubser, und ich war draußen. Es war wie beim Fallschirmspringen. Wobei ich eigentlich so gut wie nichts vom Fallschirmspringen verstehe. Kaum hatte ich einen Fuß auf den Laufsteg gesetzt, blitzten die Blitzlichter wie irre, genau wie das Mädchen es vorausgesagt hatte. Ich wäre fast auf der Stelle in Ohnmacht gefallen. Ernsthaft, ehrlich und echt.
1
Seventh Avenue
Von Morris Siegel, Schnittmacher im Garment Center
Alter: beinahe 90
Im Aufzug auf dem Weg in den sechzehnten Stock erlaubte ich mir kurz, vom Titel der Women’s Wear Daily zu träumen. Im Laufe der Jahre hatte ich es zwar schon mehrmals auf die Titelseite geschafft, aber das war meine letzte Chance, bevor ich in Rente ging. Ich hatte ein gutes Gefühl bei diesem Kleid. Gleich vom ersten Moment an, als der Designer mir die Entwürfe gezeigt hatte, hatte ich gewusst, dass ich etwas ganz Besonderes in den Händen hielt. Damit konnte ich arbeiten. Durch die schwere Glastür sah ich, dass wie jeden Morgen die Zeitung schon durch den Briefschlitz gestopft worden war. Begierig stürzte ich mich darauf, und mein Herz setzte kurz aus. Da war es! Das diesjährige kleine Schwarze war meins. Perfekt getragen von einem rehäugigen Model, das aussah, als hätte es sich aus einem Märchenwald versehentlich auf den Laufsteg verirrt. Dieses Kleid hatte ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Das Kleid der Saison! Es würde erst im August in die Läden kommen, also erst in ein paar Monaten, und bis auch die allerletzte Nachbestellung verkauft war, würde es sicher Dezember werden, und ich wäre längst in Rente. Ein gutes Gefühl aufzuhören, wenn es am schönsten ist.
Morgens bin ich immer der Erste im Showroom von Max Hammer. Punkt sechs Uhr. Sogar heute, wo der letzte Schnee des Jahres Manhattan wie Puderzucker überstäubt, bin ich zur Zeit da. Zu meiner Zeit, versteht sich. Bis die anderen kommen, dauert es noch Stunden. Ich schließe die schwere Glastür auf, ziehe sie auf und komme mir vor wie ein echter Siegertyp. Gar nicht schlecht für einen Neunzigjährigen. Die Worte Max Hammer LTD prangen in goldener Schrift auf der Tür. Seit fünfundsiebzig Jahren stehen sie da. Und genauso lange öffne ich hier morgens diese Tür. Früher mühelos mit einem Zeigefinger, heute mit beiden Händen und einem triumphalen »Uff!«.
Acht Jahre ist es her, seit Max gestorben ist. Früher war er morgens immer der Erste. Manchmal hat er sogar hier übernachtet. Ganz im Gegensatz zu mir. Sechs Uhr rein, sechs Uhr raus. Nie habe ich auch nur ein einziges Abendessen mit meiner Frau Mathilda und unserer Tochter Sarah verpasst. Sie ist inzwischen Mitte sechzig und hat selbst zwei Söhne. Mein jüngerer Enkel Lukas ist Arzt in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Der ältere, Henry, spielt Cello bei den New Yorker Philharmonikern. Max hatte zwei Jungs. Andrew, der jüngere, führt heute das Unternehmen. Wobei man ihn mit Mitte fünfzig eigentlich auch nicht mehr als jung bezeichnen kann. Ein kluges Kerlchen, unser Andrew. Klug genug, um zu wissen, dass er, ganz im Gegensatz zu seinen Eltern, überhaupt kein Auge für Mode hat. Und trotzdem wollte er schon von klein auf unbedingt im Familienunternehmen mitarbeiten. Also hat er an der Wharton University studiert und übernahm das Tagesgeschäft, als sein Vater und seine Mutter Dorothy vor rund zwanzig Jahren in Rente gingen. Es dauerte kein Jahr, da war Max Hammer vom Nachmacherkönig der Seventh Avenue zum uneingeschränkten Modekönig der Seventh Avenue avanciert. Und das alles, ohne den Namen an der Tür zu ändern. Und immer war ich hier und habe für ihn die Schnitte gefertigt.
Max Hammer habe ich auf dem Schiff nach Amerika kennengelernt, das im Sommer 1939 von der polnischen Hafenstadt Gdynia auslief. Das Ticket für die Überfahrt war eigentlich für meinen älteren Cousin Morris gedacht. Mein Vater hatte mich mitgenommen, um Morris Lebewohl zu sagen. Es war eine Woche vor meiner Bar-Mizwa, und ich war todtraurig, weil mein Cousin nicht dabei sein würde. Als wir ihn am Morgen abholten, war er krank. Sehr krank. Er glühte vor Fieber. Seine Mutter sorgte sich zwar um ihn, bestand aber darauf, dass er die Reise trotzdem antrat. Wir sahen uns sehr ähnlich, Morris und ich. Er war zwar schon sechzehn, aber für sein Alter ziemlich klein, und obwohl ich erst zwölf war, war ich für mein Alter recht groß. Oft wurden wir für Zwillinge gehalten. Sein Vater war schon vor Jahren gestorben, und wir beide waren zusammen aufgewachsen und fast wie Brüder. Mein Vater war Schneider, und er hat uns beiden alles über sein Handwerk beigebracht. Angefangen davon, wie man nach einem Entwurf ein Schnittmuster anfertigte, bis hin zu der Kunst, Knopflöcher ohne Maschine zu sticken.
Am Schiff wollten sie Morris dann nicht an Bord lassen. Er hatte inzwischen Ausschlag am ganzen Körper – man konnte die Hitze beinahe in Wellen von ihm aufsteigen sehen. Nachdem ich fast jede Kinderkrankheit gesehen habe, vermute ich, er muss wohl Dreitagefieber gehabt haben. Die Stewards wiesen ihn rüde ab und herrschten ihn an, er wollte wohl das ganze Schiff anstecken.
Worauf mein Vater Morris Fahrkarte, Tasche und Papiere abnahm und kurz entschlossen mit uns zu einer anderen Gangway ging. Ich glaubte, er wolle es noch mal woanders versuchen, aber in letzter Sekunde gab mein Vater mir alles Geld, das er in der Tasche hatte, alles Geld, das Morris dabeihatte, und seinen goldenen Ehering. Er drückte mir einen Kuss auf den Kopf und sagte mir, ich solle an Bord gehen. Ich heulte, ich bettelte, ich flehte. Ich versuchte, ihn zu warnen, was für eine Szene meine Mutter ihm machen würde, wenn er ohne mich nach Hause käme. Eine Woche vor der Bar-Mizwa ihres Sohnes. Ich ließ den Kopf hängen, so schämte ich mich für meine heißen Tränen, und als ich wieder aufschaute, waren die beiden verschwunden. Ich habe meinen Vater und Morris nie wiedergesehen. Max Hammer, etwa sechs Jahre älter als ich, hatte die ganze Szene mitbekommen. Am Ärmel zog er mich hinter sich her auf das Schiff und erklärte mir, dass mein Vater mir gerade das Leben gerettet hatte.
Drei Tage vergingen, ehe ich wieder ein Wort herausbrachte, und in der Zwischenzeit hatte Max mir seine gesamte Lebensgeschichte erzählt – einschließlich dessen, was erst noch passieren sollte. Das Erste, was er tun wollte, sobald wir anlegten, sagte er, sei seine Freundin Dorothy ausfindig zu machen, die schon einige Monate früher ausgewandert war, und sie zu bitten, noch eine Weile auf ihn zu warten. Die beiden warteten schon seit geraumer Zeit. Er sagte, in dem Moment, als er sie zum ersten Mal durch das Fenster des Kleiderladens seines Vaters in Krakau gesehen hatte, habe er gewusst, dass er dieses Mädchen einmal heiraten würde. Da waren die beiden gerade mal zwölf Jahre alt. Er sagte, er wolle erst den Grundstein für sein zukünftiges Vermögen legen, sie dann heiraten und danach den Rest des Vermögens anhäufen. Selbst auf dem Zwischendeck eines rattenverseuchten Schiffs mit nicht viel mehr zu essen als einem Laib Brot für uns beide glaubte ich ihm jedes Wort. Er war mein Held. Überlebensgroß.
Ich erzählte ihm, dass am Samstag meine Bar-Mizwa hätte sein sollen, und er sorgte dafür, dass ich meine Bar-Mizwa bekam. Ich rezitierte meinen Text aus der Thora, und wir waren gerade auf halbem Weg über den Atlantik, als die Deutschen Polen aus fast allen Richtungen gleichzeitig überfielen. Ich wurde fast krank vor Sorge aus Angst, meine Familie und meine Heimat nie wiederzusehen. Als Junge war ich an Bord gegangen, als Mann verließ ich in Amerika das Schiff. Und das nicht nur wegen meiner Bar-Mizwa. Ich nahm den Namen meines Cousins an, Morris Siegel, sowie sein Alter, also knapp siebzehn. Ich kannte niemanden außer Max Hammer, aber ich hatte das Gefühl, es könnte reichen, ihn zu kennen. Alles, was er prophezeit hatte, wurde wirklich wahr. Wenn auch nicht unbedingt in der vorhergesagten Reihenfolge.
Als Allererstes machten wir uns auf den Weg nach Brooklyn, um Dorothy ausfindig zu machen. Das Foto, das sie ihm geschickt hatte, war an der Kreuzung Coney Island Avenue und Avenue J aufgenommen worden. Den ganzen Tag standen wir also vor den Straßenschildern von dem Bild herum und warteten. Während der Überfahrt hatte er mir das Bild so oft gezeigt, dass ich sie schließlich noch vor ihm entdeckte. Das Wiedersehen der beiden war unbeschreiblich – so etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich war zu jung für eine Freundin und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es sein musste, so für ein Mädchen zu empfinden. Die vielen Küsse, die vielen Tränen. Beide weinten hemmungslos. Noch nie hatte ich einen Mann so weinen sehen. Er hatte nicht bloß Tränen in den Augen, nein, sie liefen ihm unaufhaltsam über beide Wangen. Dorothy ging mit uns zu einem kleinen Molkerei-Restaurant, und wir futterten, als hätten wir seit einem Monat nichts mehr zu essen bekommen. Hatten wir ja eigentlich auch nicht. Ich vermisse diese kleinen Restaurants – die gab es in den alten jüdischen Vierteln früher an jeder Straßenecke, so wie heute Starbucks. Warme Blini und unterkühlte Kellner. Max erzählte ihr von seinem Plan, mit dem Heiraten zu warten, bis er sein eigenes Unternehmen gegründet hatte. Worauf sie ihm von ihrem Plan erzählte – dass es ihr schnurzpiepegal war, dass er kein Geld hatte, und sie ihn nie wieder gehen lassen würde. Sie heirateten noch in derselben Woche. Dorothy hatte eindeutig die Hosen an, gleich von Anfang an.
Irgendwie gelang es mir, Kontakt zu einem entfernten Cousin aufzunehmen, der in Jersey City wohnte und dort eine große Näherei besaß. Er stellte mich ein. Als Schnittmusterlehrling passte ich perfekt in Max’ Masterplan, und ich arbeitete nur zu gerne darauf hin, eine kleine Rolle bei der Verwirklichung seines großen Traums zu spielen. Außerdem waren die spärlichen Nachrichten, die aus der Heimat zu uns durchdrangen, alles andere als beruhigend. Und dieselbe Arbeit zu verrichten wie mein Vater gab mir das Gefühl, noch immer mit ihm verbunden zu sein. Der Schnittmeister nahm mich unter seine Fittiche, und ich lernte das Schnittmustermachen auf seine Weise, auch wenn mir die Art meines Vaters immer lieber war. Kein Jahr später hatte Max meinen Cousin bequatscht, ihm bei der Finanzierung eines eigenen Modehauses auf der Seventh Avenue zu helfen. Er lieh sich bei ihm nicht nur Geld, sondern auch mich, und im Handumdrehen war die Marke Max Hammer gegründet und hatte sich schon bald einen Namen gemacht.
An diese frühe Anfangszeit erinnere ich mich bis heute am liebsten. Damals konnte ich Schnitte in jedem Stil machen, wie ich gerade lustig war. Die anderen Modehäuser um uns herum beschäftigten exzentrische Modeschöpfer, die ihre eigenen Entwürfe zeichneten. Max dagegen verfolgte eine ganz andere Idee. Jeden Tag schickte er mich zum Zeitungskiosk, um die neuesten Hollywood-Zeitschriften zu kaufen: Film, Life und Motion Picture. Was immer Carole Lombard, Joan Crawford oder Bette Davis gerade trugen, wir kopierten es. Max hatte ein unglaubliches Gespür dafür, welche Kleider der Durchschnittsamerikanerin stehen und ihr noch dazu das Gefühl vermitteln würden, ein Hollywoodstar zu sein. Und während die meisten anderen Schnittmacher ein Kleid brauchten, um eine Kopie anzufertigen, reichten mir ein paar Fotos.
Wir wollten niemandem etwas vormachen und uns keinesfalls mit fremden Federn schmücken. In der Market Week, wenn die Einkäufer kamen, stellten wir die Fotos der Filmstars in ihren Roben mitten auf die Tische im Showroom. Die Kleider unserer ersten Kollektion waren sogar nach den jeweiligen Schauspielerinnen benannt. Dorothy hatte die perfekte Figur zum Vorführen der Musterkleider, und wenn sie in einem Kleid von Greta Garbo oder Loretta Young vor den Vorhang trat, zückten die Einkäufer die dicken Bleistifte, wie Max immer so schön sagte, und tätigten die ganz großen Bestellungen. Unsere Geschäftsidee erwies sich als durchschlagender Erfolg, und schon in der nächsten Saison begannen die anderen Häuser, unsere Erfolgsstrategie nachzuahmen. Aber wir waren die Ersten gewesen und waren offen gestanden auch die Besten. Es dauerte nicht lange, da zog Max mit seiner inzwischen schwangeren Frau von Coney Island nach Central Park West. Und keiner von beiden sah auch nur im Entferntesten danach aus, als hätte er jemals einen Fuß in ein polnisches Schtetl gesetzt, ganz zu schweigen davon, dort aufgewachsen zu sein. Dorothy wurde Stammkundin in den exklusivsten Boutiquen der Fifth Avenue und der Ladies Mile, wo sie die neuesten Modelle aus Paris und Mailand erstand. Weshalb ich dann plötzlich nicht mehr bloß Fotos als Vorlage für meine Schnittmuster hatte. Ich nahm ihre exquisiten Kleider auseinander, besah mir alles ganz genau, fertigte ein Muster an und setzte sie dann wieder zusammen. Wir waren ein Dreamteam, lange bevor es diesen Ausdruck überhaupt gab.
Und auch ich fand die Liebe. Ich sah Mathilda im L Train auf dem Heimweg nach Brooklyn, und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie schleppte in einem Sack Stoffreste nach Hause, die der Chef ihr mitzunehmen erlaubt hatte, und nach sechzehn Haltestellen hatte ich sie endlich dazu überredet, ihr den Sack tragen zu dürfen. Sie war sozusagen eine Amerikanerin erster Generation: Sie war während der Überfahrt auf dem Schiff zur Welt gekommen – ihre Eltern waren aus Österreich geflohen – und behauptete gerne, sie komme von überallher und nirgends. Ihre Eltern nahmen mich freundlich auf, und wieder eine Familie zu haben tröstete ein wenig mein wehes Herz. Das war im Sommer 1945, als der Krieg endlich zu Ende ging. Gelegentlich hatte ich durch den einen oder anderen Auswanderer etwas von meiner Familie erfahren, und mit jeder neuen schrecklichen Nachricht schwand die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen. Und ich wusste, dass ich ihnen allen zu Ehren ein volles Leben würde leben müssen. Ein Leben, groß genug für sie alle. Es dauerte nicht lange, bis Mathilda und ich heirateten und selbst ein Kind bekamen.
Irgendwann ging Max dann in Rente und zog mit Dorothy nach Palm Beach. Sein Sohn Andrew übernahm die Firma. Max hatte genau das Leben gelebt, das er mir damals auf dem Schiff in glühenden Farben ausgemalt hatte – seinen ganz eigenen amerikanischen Traum. Der einzige Haken an der Sache war, dass er Palm Beach nicht ausstehen konnte. Er sagte immer, da liefen alle Frauen in demselben Kleid herum, dem Lilly Pulitzer. Sein Sohn musste ihm hoch und heilig versprechen, es niemals zu kopieren. Aber das Kleidchen war sowieso keine Hammer-Kopie wert. Und Andrew hatte sowieso nicht vor, das Lilly Pulitzer oder sonst irgendetwas zu kopieren. Genau wie sein Vater vor ihm hatte er einen Plan. Sein Plan war, Max Hammer in bislang ungekannte Höhen zu führen, indem wir unser handwerkliches Können und die Qualität, für die wir standen, in eigene Entwürfe einfließen ließen. Ich bekam eine Entwurfszeichnung und machte daraus ein Schnittmuster. Ich machte aus einer Idee etwas Greifbares. Wir waren ein tolles Team, Andrew und ich, und ich glaube, der kreative Kitzel, echte Couture-Modelle zu kreieren, war es auch, der mich davon abgehalten hat, schon vor Jahren in Rente zu gehen.
Der Schnittmeister, der meine Aufgaben übernimmt, wird die Schnitte niemals so anfertigen, wie ich es immer gemacht habe. Ich bin einer der Letzten in unserer Branche, der noch alles von Hand macht. Ich drapiere Musselin an einer Schneiderpuppe und zeichne das Muster auf Karton. Ich nehme die abstrakten Entwürfe der Modeschöpfer und erwecke sie zum Leben – durch meine Hände, durch meine Arbeit. Heutzutage werden die Schnittmuster am Computer gefertigt. Manche Schnittmeister bekommen das Kleid erst bei der Anprobe zu Gesicht. Aber ganz gleich, wann sie es zum ersten Mal sehen, man kann nur hoffen, dass sie ihm auch den Respekt entgegenbringen, den es verdient. Denn in einem schönen Kleid steckt immer ein gewisser Zauber. Und der Schnittmeister ist der Zauberer, der es aus dem Zylinder zieht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schulterpolster aus den Achtzigerjahren bald wieder zurückkommen, aber ich werde nicht mehr hier sein, um sie einzusetzen. Das hier ist meine letzte Herbstkollektion. Wieder ging mein Blick zu meinem Kleid auf dem Titel der WWD. Es war ein gutes Leben.