

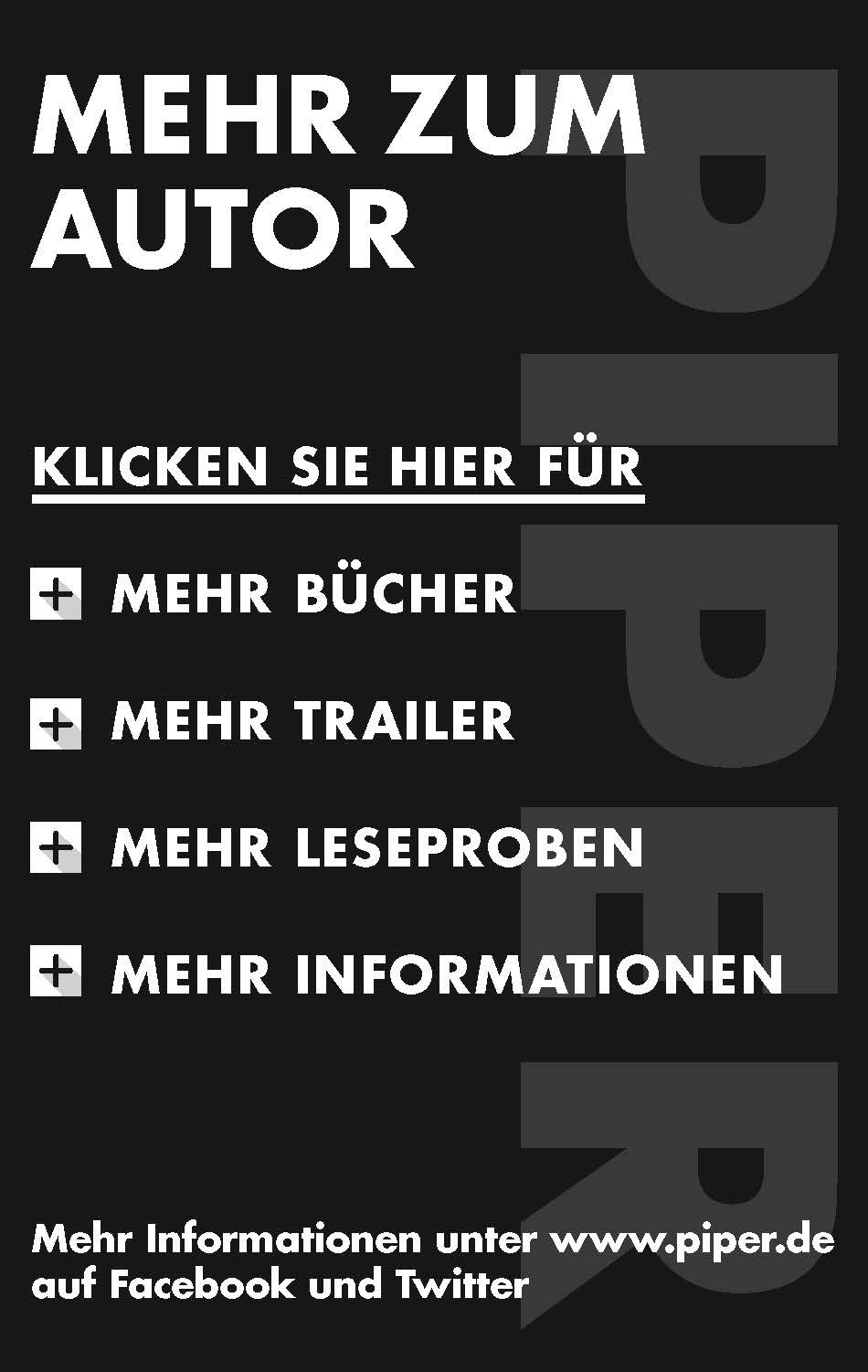
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97389-2
September 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel/punchdesign, unter Verwendung von pixabay.com
Datenkonvertierung: Kösel Media, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Sie wussten, dass sie nicht vom Weg abweichen durften. Wenn das Moor einen verschluckte, verschwand man auf Nimmerwiedersehen, so hatte Mutter es ihnen erklärt. Nimmerwiedersehen. Das Wort jagte Vera einen leichten Schauer über die Unterarme. Nimmerwiedersehen wurde ihr Name für das Moor, ihr eigenes, magisches Reich. Vi hielt sich nicht an Verbote, und Vera ließ sich jedes Mal überreden. Sie drangen nie sehr weit vor und kehrten um, wenn die dunkle Erde sich schmatzend an ihren Turnschuhen festsaugte. Doch es war nicht leicht, denn Nimmerwiedersehen lockte mit seinen bemoosten Baumstämmen, halb versunken in dunklem Wasser, mit seinem leisen Glucksen und Flüstern, mit Büscheln hüfthohen Grases, dessen Halme an den Handflächen kitzelten. Mücken wirbelten um sie herum wie goldener Staub. Vera hatte sie »Monaden« getauft, auch wenn sie nicht wusste, was das Wort bedeutete. Ihr Vater hatte es in einem Telefongespräch benutzt, dem sie vom Sofa aus im Halbschlaf gelauscht hatte. Monaden mussten eine Art Feen sein, und die winzigen Mücken, die von der Sonne vergoldet wurden, waren vielleicht genau das.
Sie jagten den winzigen braunen Fröschen nach, die man in die hohlen Hände schließen konnte und deren zarte Bewegungen auf der Haut kitzelten. Jetzt im Mai gab es Hunderte von ihnen, und sie sprangen wie Grashüpfer vor Veras und Violas Füßen auf.
Nimmerwiedersehen gehörte ihnen allein, es war ihr Geheimnis, das sie gemeinsam hüteten. Hier konnten sie so tun, als gäbe es nur sie beide auf der Welt, und gleichzeitig wussten sie hinter sich den Weg, der sie innerhalb einer Viertelstunde nach Hause zurückführen würde.
Sie folgten einem kleinen Bachlauf, der zwischen Moospolstern plätscherte und sie immer tiefer ins Moor führte, als sich plötzlich etwas veränderte. Vera blieb stehen. Sie wusste nicht genau, was es war, aber ein Rascheln ging durch die Sträucher, ein Schatten streifte kühl über ihre Arme, und als sie den Kopf wandte, kam es ihr vor, als huschte etwas aus ihrem Blickfeld.
»Vi«, sagte sie, »drehen wir lieber um.«
Vi war ihr mehrere Meter voraus und schien nichts bemerkt zu haben. Ihr blaues T-Shirt leuchtete zwischen den grünen Farnen.
»Vi!«, wiederholte Vera. Sie fröstelte und schlang die Arme um ihren Körper.
»Was ist denn?« Viola drehte sich um.
»Wir sind schon viel zu weit reingegangen.«
Vi verschränkte die Arme und knickte in der Hüfte ein. Die Kirschen an ihrem Haargummi leuchteten rot. »Hast du etwa Angst?«
Vera ging nicht darauf ein. »Ich hab noch Taschengeld«, sagte sie, »wir können uns in der Waldschänke ein Dolomiti holen.« Vi liebte Eis.
Aber so einfach wollte Viola nicht nachgeben. Sie kniff die Augen zusammen und überlegte einen Moment. »Das können wir später immer noch. Erst gehen wir auf Forschungsexpedition.«
Vera rührte sich nicht. Warum mussten sie immer alles so machen, wie es ihre Schwester wollte?
»Vi, ich dreh jetzt um!« Sie spürte, wie ihre Füße allmählich in den von Wasser durchtränkten Boden einsanken.
»Na, dann geh doch«, sagte Vi, die genau wusste, dass Vera sie nicht allein zurücklassen würde. Schon im Bauch ihrer Mutter waren sie zusammen gewesen, und bei der Geburt war Vera ihrer Schwester gefolgt wie seither überallhin. Aber dieses Mal nicht.
»Mache ich auch!« Als Vera sich umdrehte und begann, am Bachlauf entlang zurückzugehen, stieg ein helles Siegesgefühl in ihr auf. Sie hatte ungefähr zwanzig Schritte gemacht, da hörte sie hinter sich ihre Schwester rufen: »Warte auf mich!« Vera musste sich zwingen, nicht zurückzublicken.
»Na gut, wenn du unbedingt willst, holen wir uns eben ein Eis.« Vi konnte Dinge so sagen, als täte sie einem einen Gefallen, auch wenn es gar nicht so war.
Vera ging weiter, aber langsamer, sodass Vi sie einholen konnte. »Du zahlst aber.« Vi stieß sie mit dem Ellbogen leicht in die Seite.
Sie stiegen die Böschung hinauf, und Vera atmete erleichtert aus, als sie wieder auf dem Weg standen. Nimmerwiedersehen war ihr Reich, aber ob das auch die Wesen wussten, die dort lebten? Jetzt, wieder in Sicherheit, wurde das Schaudern zu einem wohligen Nachklang, während sich schon die Vorfreude auf das Eis in ihr ausbreitete. Bis zur Siedlung, deren Straßen die Namen von Bäumen trugen, war es nicht weit, und auf dem Weg zur Waldschänke am Ende des Fichtenwegs würden sie ihrer Mutter im Garten zuwinken können. Sie mussten nur den Waldweg hinuntergehen, noch einmal abbiegen, und fünf Minuten später wären sie am Haus von Frau Bartels, die in der Waldschänke als Bedienung arbeitete und ihnen manchmal ein Wassereis mit Kirsch- oder Waldmeistergeschmack umsonst gab.
Gedankenverloren trödelten sie vor sich hin, blieben immer wieder am Wegesrand stehen, um Gräser auszureißen oder nach frühen Walderdbeeren zu suchen. Die Zeit rollte sich zusammen, nichts schien sie zu drängen. Vera überließ sich dem köstlichen Gefühl, dass sie heil aus Nimmerwiedersehen zurückgekehrt waren und der Nachmittag erst in einer sehr fernen Zukunft in den Abend übergehen würde.
»Ich nehm ein Supercornetto!«, rief Vi, während sie auf einem Bein neben Vera herhüpfte.
»Ich glaub, bei dir piept’s!«, empörte sich Vera. Supercornetto kostete zwei Mark, Dolomiti nur sechzig Pfennige.
»Du hast gesagt, du bezahlst, jetzt musst du auch!« Vi hüpfte weiter, jeder Sprung eine kleine Explosion aus Staub und Schotterstückchen. »Ich hab aber nicht gesagt, dass du dir einfach irgendeins aussuchen darfst.«
»Du hast auch nicht gesagt, dass ich’s nicht darf, also darf ich’s!«
Vera befühlte die Münzen in ihren Shorts. Sie wusste, dass es zwei Mark achtzig waren. Wenn Vi das Supercornetto nahm und sie das Dolomiti, blieben nur noch zwanzig Pfennige. Die würden nicht mal mehr für ein Mini Milk reichen, und bis es wieder Taschengeld gab, waren es noch fast zwei Wochen hin. »Du kannst ein Ed von Schleck haben.«
»Nö-hö!«, sagte Vi im Rhythmus ihrer Hüpfer. »Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen! Sonst bist du ein Lügner, und das erzähl ich morgen allen in der Schule.«
Vi konnte die beste Schwester der Welt sein, das war sie sogar meistens. Sie kam zu ihr ins Bett, wenn sie sich vor den Schatten fürchtete, die die Straßenlaterne an die Wand warf, und erzählte ihr die Geschichte von Jonathan und Krümel. Sie ließ Vera, die im Rechnen viel langsamer war, die Hausaufgaben abschreiben, und sie hatte niemandem erzählt, dass Vera in Stefan aus der Sechsten verknallt war. Aber sie musste immer recht haben, immer bestimmen, und wenn Vera nicht mitmachte, konnte sie richtig gemein werden. Egal, was Vera sagte, Vi hörte einfach nicht hin, sondern bestand darauf, dass alles so gemacht wurde, wie sie es wollte.
»Supercornetto Erdbeer«, sang sie jetzt beim Hüpfen und zog dabei das »Erdbeer« so sehr in die Länge, wie es nur ging. Und das war zu viel. Vera streckte den Arm aus und schubste ihre Schwester, so fest sie konnte. Es sah komisch aus, als Viola fiel, ein Bein seitlich von sich gestreckt, den Mund so weit aufgerissen, dass die breite Zahnlücke sichtbar wurde – das Einzige, worin sie sich unterschieden, denn Vera hatte beide Vorderzähne noch.
Mit einem hässlichen Knirschen schlitterte Vis Fuß durch die kiesdurchsetzte Erde und hinterließ eine helle Schneise, dann krachte sie auf die Seite und blieb liegen. Ihre Jeans war voller Dreck. Vi rührte sich nicht, und Veras Beine wurden ganz steif, als sie Vi so dort liegen sah, die Arme und Beine verrenkt. Doch dann bewegte sie sich, setzte sich auf, die Beine angewinkelt. Vera atmete aus. Sie entdeckte Abschürfungen an Vis Oberarm, wie eine rosa Landkarte, aus der winzige rote Perlen quollen. Vis Mund bebte, weil sie nicht vor ihrer Schwester weinen wollte, aber dann heulte sie doch los. Vera ging in die Hocke und wollte ihr über den Arm streichen, aber Vi schlug nach ihr, und sie kippte um. Spitze Steinchen bohrten sich in ihre Oberschenkel.
»Hau bloß ab!« Vis Gesicht zog sich hasserfüllt zusammen. »Eine blöde Kuh bist du, richtig oberblöd!«
Vera, die den Schubser schon bereut hatte, war auf einmal so wütend auf Vi, dass sie ihr nicht einmal mehr in die Augen blicken konnte. »Ist doch nicht meine Schuld, wenn du hinfällst, du blöde Kuh!« Sie stand auf und ging einfach weiter, während Vi hinter ihr herschrie: »Ich will überhaupt kein Eis von dir!«
Das war der letzte Satz, den Vera je von ihrer Schwester hörte.
Um fünf nach zwei wurde Vera nervös. Sie trat auf den vorderen Balkon und sah die Straße hinunter. Von Tom und Finn war nichts zu sehen. Sie ging in die Küche zurück und schenkte sich aus der Thermoskanne nach, obwohl sie keine Lust auf Kaffee hatte. Wenigstens lenkte es sie ab. Tom kam häufig zu spät, wenn er Finn zurückbrachte. Vera wusste das, und trotzdem wurde sie jedes Mal fahrig, wenn die beiden nicht zur vereinbarten Uhrzeit auftauchten. Draußen knatterte ein Motor, und Vera zuckte zusammen. Doch Tom konnte es nicht sein, denn seine alte Kawasaki EN 500 wummerte wie eine Heavy-Metal-Band.
Zehn nach zwei, der Kaffeebecher war leer, und sie stellte ihn in die Spüle. In ihrem Kopf spielten sich Szenen ab, die mit quietschenden Reifen, zerbeultem Blech, Blut und zerquetschten Knochen zusammenhingen, und es gelang ihr nicht, sie zu verdrängen. Nichts unternehmen zu können war das Schlimmste. Jede Minute dehnte sich wie ein krümeliges Gummiband, kurz bevor es riss. Sie klappte die Spülmaschine auf, räumte die Tasse hinein und klappte die Spülmaschine wieder zu, den süßsauren Geruch nach Essensresten immer noch in der Nase, als sie sich wieder aufrichtete.
Viertel nach zwei. Unwillkürlich ging sie in die Diele, öffnete die Wohnungstür und trat auf den Treppenabsatz. Sie lauschte kurz. Tom wusste, dass sie sich schnell Sorgen machte, aber er hatte noch nie Rücksicht darauf genommen. Irgendwann hatte Vera begriffen, dass er sich einfach nicht vorstellen konnte, wie es sich anfühlte, ständig mit dem Schlimmsten zu rechnen. Wenn sie selbst mit Finn einmal zu spät dran war, fiel es ihm meistens gar nicht auf, und falls doch, kam er nicht auf die Idee, besorgt zu sein. Auch als sie noch zusammen gewesen waren, hatte er sich nie Gedanken gemacht, wenn er Vera nicht hatte erreichen können. Vera beneidete ihn um diese Sorglosigkeit, gleichzeitig trieb sie sie in den Wahnsinn.
Vera hängte sich ihre Tasche um, lief – das Telefon in der einen, den Schlüsselbund in der anderen Hand – die drei Stockwerke nach unten und stellte sich auf den Bürgersteig. Weshalb kamen die beiden nicht endlich? Vera presste ihre Daumenkuppe auf die Spitze des Haustürschlüssels. Nebenan trat Christine aus ihrem Laden, einen Stapel bedruckter Ethnoschals im Arm. Sie grüßten sich, Vera machte eine Bemerkung über die leuchtenden Farben der Schals, und Christine erkundigte sich, wie es beim Sender lief. Dann begann sie, die Schals auf dem Auslagentisch aufzufächern, und Vera war wieder sich selbst überlassen. Sie sah auf ihr Telefon: Zweiundzwanzig nach zwei. Sie hätte längst auf dem Weg nach Hakenfelde sein sollen, wo ihre Eltern sicher schon mit dem Kaffee warteten.
Ein dumpfes Grollen wurde hörbar, näherte sich, dann hielt die Kawasaki vor Vera, und Finn glitt von seinem Platz hinter Tom. Seine Augen strahlten unter dem riesigen Jethelm hervor. »Wir sind total schnell gefahren, das war klasse!«
»Toll, mein Äffchen!«, sagte Vera und klopfte leicht mit den Fingerknöcheln gegen Finns Helm, dann wandte sie sich an Tom. Sie schob Ärger und Sorge die Kehle hinunter, so weit sie konnte. »Na, hat’s ein bisschen länger gedauert?« Tom legte den Kopf schief. »Jetzt mach bitte keinen Stress, weil wir ein paar Minuten zu spät sind.«
»Fast eine halbe Stunde. Aber ist schon okay.« Am liebsten hätte sie Tom einen Vortrag gehalten, weil er so spät war, und ihm gesagt, dass er endlich einen Integralhelm für Finn kaufen sollte, aber dann würde sie wieder einmal die Spielverderberin sein, und diese Rolle hatte sie gründlich satt. Finn war heil angekommen, das war die Hauptsache.
Tom überging ihren Kommentar. »Na, alles gut bei dir?«
Vera nickte. »Ich hab wahrscheinlich ein neues Projekt. Könntest du Finn demnächst für ein paar Tage nehmen? Kann sein, dass ich für eine Recherche nach Italien muss.«
Tom fuhr sich durchs Haar und grinste ein bisschen schief – in diese Geste hatte sie sich damals verliebt, jetzt fand Vera sie nur noch aufgesetzt. Wahrscheinlich aus Top Gun oder einem anderen bescheuerten Actionfilm geklaut, dachte sie gehässig.
»Klar, ich hab Zeit. Hast du Lust, ein paar Tage mit mir rumzuziehen, Großer?«
Finn strahlte. »Logisch!«
Es war schön, dass er sich so gut mit seinem Vater verstand. Als Vera und Tom noch zusammengelebt hatten, war Tom immer beschäftigt gewesen und hatte Finn eigentlich nur bei den Mahlzeiten gesehen, aber seit der Trennung verbrachten die beiden wesentlich mehr Zeit miteinander. Finn ging gerne zu ihm, weil Tom meistens irgendetwas geplant hatte – Zoobesuche, Motorradausflüge oder anderes. Manchmal kam es Vera vor, als bliebe immer ihr die undankbare Rolle, dafür zu sorgen, dass Finn seine Hausaufgaben machte, sein Zimmer aufräumte und ab und zu mal duschte, während Tom für Spaß und Abenteuer sorgte. Doch wenn Finn Kummer hatte oder krank war, wollte er nur sie um sich haben und sonst niemanden. Manchmal kroch er sogar noch nachts zu ihr unter die Decke, während er sich bei Tom bemühte, möglichst erwachsen zu wirken.
»Ist noch was?«, fragte Tom. »Ich muss los, bin mit Melanie verabredet.«
Vera schüttelte den Kopf. »Ich geb dir Bescheid wegen der Recherche. Wir fahren jetzt zu meinen Eltern.«
»Schöne Grüße. Ich vermisse Carinas Apfelkuchen.«
»Sie kann dir das Rezept ja mailen.« Vera legte den Arm um Finns Schulter. Er war beinahe schon so groß wie sie. »Gib Papa den Helm.«
»Tschau, Großer! Bis Mittwoch!« Tom hängte Finns Helm an den Lenker und startete das Motorrad. Das satte Dröhnen vibrierte in Veras Magen und wirbelte Sehnsucht auf, selbst wieder zu fahren. Aber ihre Virago stand seit Finns Geburt mit einer Plane abgedeckt in der Garage in Hakenfelde. Tom hatte versucht, sie von ihrer Entscheidung abzubringen, hatte sie an die vielen gemeinsamen Touren erinnert, aber für Vera war klar gewesen, dass sie nicht mehr fahren würde. »Wenn mir etwas passiert«, hatte sie gesagt, »wer kümmert sich dann um Finn?« Das Motorradfahren aufzugeben war kein Opfer gewesen, sie hatte es einfach nicht mehr über sich gebracht.
Sie strich Finn über das verwuschelte Haar. »Musst du noch mal rauf, oder können wir gleich los? Opa wartet bestimmt schon auf dich. Er hat irgendwas von einer ferngesteuerten Drohne mit Kamera erzählt.«
»Super!« Er löste sich von ihr und lief in Richtung Parkplatz voraus. Als sie ihm nachsah, fiel ihr auf, wie erwachsen er aus der Entfernung wirkte. Er bewegte sich nicht mehr wie ein Kind, sondern hatte die schlaksigen Bewegungen eines Jugendlichen.
Als Veras Mutter die Haustür öffnete, quoll ein Schwall Kuchenduft heraus. »Hallo, ihr beiden!« Sie drückte Finn einen Kuss auf die Wange. »Ja, ja, ich weiß, du bist zu groß dafür«, sagte sie, als er das Gesicht verzog und sich mit der Handfläche übers Gesicht wischte, »aber gönn mir die Freude.«
»Passt schon, Oma, ist nur ’n bisschen eklig.« Finn grinste und hob beide Hände als Friedenszeichen, worauf seine Großmutter ihn abklatschte.
»Schau mal hinters Haus und pass auf, dass Opa dieses fliegende Monstrum nicht gegen eine Wand steuert. Und weg ist er.« Ihr Lachen klang, als würde es sich nur kurz aus der Deckung wagen, dann verschluckte sie es und hielt Vera beide Wangen zum Kuss hin. »Ciao, cara, gab es viel Verkehr?«
»Nein, Tom war ein bisschen zu spät dran, aber ich musste sowieso noch ein Interview abtippen. Er lässt dich grüßen und hätte gerne dein Apfelkuchenrezept per Mail.«
»Das überlege ich mir noch. Komm rein, tesoro, der Kaffee ist aufgesetzt, und der Prosecco gekühlt.«
»Du weißt doch, dass ich nichts trinke, wenn ich mit Finn im Auto unterwegs bin.« An der Garderobe schlüpfte Vera aus den Turnschuhen. Wie immer gab ihr der Anblick der froschgrünen Gummistiefel Größe fünfunddreißig einen Stich. Auf dem Weg ins Wohnzimmer versuchte sie, an der Fotowand vorbeizusehen, doch es gelang ihr nicht ganz. Da waren sie und Vi als Babys im Zwillingskinderwagen, mit identischen Schultüten vor dem Haus, beim Frisbeespielen im Garten, in einem gelben Schlauchboot auf dem Plattensee, in weißen Kleidern bei der Erstkommunion. Und dann nur noch sie, als spindeldürre Zwölfjährige beim Voltigieren (von der Psychiaterin empfohlen), als Gothic-Mädchen mit schwarz umrandeten Augen, in einem schulterfreien Kleid bei der Abiturfeier in der Schulaula.
Vera atmete auf, als sie ins Wohnzimmer kam. Sonnenlicht fiel auf die mit hellem Leinen bezogene Sofalandschaft, und durch die geöffnete Schiebetür sah sie auf dem Rasen ihren Vater und Finn, der eine Fernsteuerung in den Händen hielt. Beide blickten konzentriert in den Himmel. Das Surren der Drohne wurde mal lauter, mal leiser, während Finns Finger sich über den Controller bewegten. Wie intuitiv er mit technischen Geräten umging, brachte Vera immer wieder zum Staunen.
»Bin gleich wieder da«, sagte ihre Mutter und verschwand in der Küche. Vera trat auf die Terrasse und winkte ihrem Vater zu. Er hob die Hand. »Kann gerade nicht!«
»Hauptsache, ihr stürzt nicht ab!« Vera wurde warm, als sie die beiden so vertraut miteinander sah. Die Drohne wirkte wie ein monströses Insekt, das aus einem Labor entkommen war. Vera stellte sich vor, wie das digitale Auge sie beobachtete. Doch die Leerstelle, die überall im Haus spürbar war, würde es nicht erfassen.
Vera ging zurück ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Sofa und zog die Beine an. Auf dem Couchtisch lag ein alter Koffer von der Größe eines überdimensionalen Schuhkartons. Vera stellte überrascht fest, dass er tatsächlich aus Pappe bestand, in die eine Lederstruktur geprägt war. Die Ecken waren mit echtem Leder verstärkt, und hinter dem Tragegriff befand sich ein kleines Schloss.
Veras Mutter kam aus der Küche und stellte zwei riesige, handgetöpferte Schalen mit Milchkaffee auf den Tisch.
»Scheußlich, nicht?« Die vielen Armreifen und Ketten klimperten, als sich ihre Mutter auf dem Sofa gegenüber niederließ. »Hab ich auf dem Wohltätigkeitsbasar der Kirchengemeinde gekauft.«
»Den Koffer?«, fragte Vera, die sich nicht ganz sicher war, was ihre Mutter meinte. Lachend erwiderte diese: »Nein, die Tassen. Den Koffer hab ich auf dem Dachboden gefunden. Du wolltest doch für deine Sendung wissen, ob wir noch Sachen von nonna Teresa haben. Ich glaube, der Koffer hat ihr gehört. Allerdings ist er abgeschlossen, und ich konnte den Schlüssel nirgendwo finden.«
Vera konnte sich nur vage an die Mutter ihrer Mutter erinnern. Teresa war an Krebs gestorben, als Vera und Viola fünf gewesen waren. Vielleicht war sie deswegen eine Art mythische Figur für Vera. Sie hatte sich völlig der Wissenschaft verschrieben, und das zu einer Zeit, als eine Frau in der Forschung noch als absolute Ausnahme galt. Vera arbeitete als freie Journalistin für einen Berliner Radiosender. Ein Porträt ihrer Großmutter würde perfekt in die Reihe über ungewöhnliche Frauen passen, die jeden Sonntag ausgestrahlt wurde.
Sie hatte das Bedürfnis, mehr über ihre Großmutter zu erfahren, vor der sie als Kind immer ein bisschen Angst gehabt hatte. Sie erinnerte sich nicht daran, dass Teresa je mit ihr und Vi gespielt hätte, aber sie wusste noch, dass sie manchmal bei ihren Großeltern übernachtet hatten, wenn ihre Eltern ausgegangen waren, und dass sie dann alte Piratenfilme gesehen und Kakao getrunken hatten.
»Hast du schon mit deiner Recherche angefangen?«
»Ich war beim Max-Planck-Institut, aber da konnten sie mir auch nur die Jahre nennen, in denen Oma dort beschäftigt war. Und im Netz gibt es nur einen einzigen Hinweis auf eine Veröffentlichung. Sie muss doch Versuchsreihen gemacht haben, da müsste es Unterlagen geben.«
»Früher war es oft so, dass die männlichen Chefs die Leistungen ihrer weiblichen Mitarbeiter für sich beansprucht haben«, sagte ihre Mutter. »Das habe ich selbst im Medizinstudium noch erlebt. Ich fände es wunderbar, wenn aus der Sendung – wie heißt das noch gleich? Feature? –, also, wenn dein Sender das machen würde.«
»Ich bin nachher mit dem Ressortleiter verabredet, dann kriege ich hoffentlich grünes Licht.«
»Es tut mir wirklich leid, dass ich so wenig beitragen kann. Ich weiß nicht, was Opa mit ihren Unterlagen gemacht hat. Vielleicht sind sie auch alle im Institut geblieben. Briefe hat sie jedenfalls keine hinterlassen. Sie hatte ja gar keine Zeit, welche zu schreiben. Die Fotoalben kennst du ja schon, aber die Fotos stammen alle aus der Zeit, nachdem sie und dein Opa nach Deutschland kamen.«
»Hat sie denn wirklich nie von früher erzählt?« Vera beugte sich vor.
Ihre Mutter seufzte und lehnte sich in die Sofakissen. »Nein, da hat sie immer abgeblockt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie, Tante Lidia und Alessandro es schwer hatten, weil ihre Eltern kurz vor Kriegsende gestorben sind. Sie waren wohl auch einige Zeit in einem Waisenhaus, das hat Tante Lidia mal erwähnt.«
»Und wie war sie so als Mutter?« Vera ärgerte sich, dass sie ihr Aufnahmegerät nicht dabeihatte.
»Sie war für mich immer irgendwie verschwommen, nicht so richtig präsent. Sie hatte Wichtigeres zu tun, als Essen zu kochen oder sich um meine Schulprobleme zu kümmern.« Veras Mutter strich sich ihr schönes, eisengraues Haar aus dem Gesicht und sah in den Garten hinaus, während sie weitersprach. »Für sie waren ihre Forschungen wichtiger als alles andere. Sie hat oft mit papà beim Abendessen darüber gesprochen. Eigentlich ist die Züchtung künstlicher Haut ein ganz schön ekliges Thema, aber ich verstand sowieso kein Wort davon. Aber ich habe sie immer so gerne angesehen, wenn sie sich in Begeisterung redete. Ihr ganzes Gesicht leuchtete dann geradezu. Sie war wirklich mit Leib und Seele Forscherin.«
»Aber sie muss sich doch ab und zu um dich gekümmert haben«, sagte Vera.
»Natürlich, sie war abends und am Wochenende zu Hause, es sei denn, sie musste irgendwelche Versuchsreihen überwachen. Aber sie hat sich eigentlich nie Zeit genommen, mir mal etwas vorzulesen oder mit mir zu spielen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, das hat sie gelangweilt. Als ich größer wurde, wurde das etwas besser, aber meine Erziehung hat sie zum Großteil papà überlassen. Nur bei einer Sache war sie eisern: Ich durfte nie alleine das Haus verlassen. Wenn ich mit einer Freundin spielen wollte, musste papà mich dorthin bringen, und wenn ich auf den Spielplatz wollte, musste er dabeibleiben. Natürlich hatte er nicht immer Zeit. Er war zwar oft zu Hause, aber er musste ja seine Vorlesungen vorbereiten, und so war ich meistens allein in meinem Zimmer. Das war nicht schön, und deshalb wollte ich das bei meinen eigenen Kindern ganz anders machen.« Sie verstummte und sah auf die Terrasse hinaus. Vera beugte sich über den Tisch und strich ihrer Mutter über die Hand, auf der die ersten Altersflecke sichtbar wurden.
Ihre Mutter drehte den Kopf, sah sie an und lächelte traurig. »Geht schon, mein Schatz. Also, meine Mutter war ein Rätsel für mich und ist es noch. Deshalb fände ich es großartig, wenn du mehr über sie herausfinden könntest.«
»Hast du auch nach ihrem Tod mit Opa nicht über alte Zeiten geredet?« An ihren Großvater konnte Vera sich gut erinnern, er war ein ruhiger, etwas unbeholfener Mann gewesen, den sie sehr gemocht hatte. Lorenzo hatte bis 1998 gelebt und war mit dreiundsiebzig Jahren friedlich im Schlaf gestorben.
Veras Mutter schüttelte den Kopf, langsam, als wäre es ihr selbst unbegreiflich. »Da war etwas wie eine Grenze, unsichtbar, aber jeder wusste, dass es sie gab. Auch Lidia hat immer das Thema gewechselt, wenn wir darauf zu sprechen kamen. Aber wir hören uns ja höchstens zweimal im Jahr.«
Lidia, die Schwester ihrer Großmutter, musste steinalt sein, aber sie lebte noch. Vera kannte sie nur von einem kurzen Besuch, als sie mit ihren Eltern auf der Durchreise zu einem Urlaubsort an der ligurischen Küste gewesen waren. Damals war sie zwölf oder dreizehn gewesen, und sie konnte sich nur noch daran erinnern, dass es ihr peinlich gewesen war, mit ihrem Großcousin Maurizio Italienisch zu sprechen. Seine dunklen Augen und sein schöner Mund hatten sie so verwirrt, dass ihr eigentlich recht gutes Italienisch sich bis auf ein paar Brocken verflüchtigt hatte. Wenn sie sich richtig erinnerte, war er verheiratet und arbeitete im Café der Familie mit.
Vera trank den Rest ihres Kaffees. Er war kalt geworden und schmeckte bitter. »Dann rufe ich Lidia an, sobald ich das Okay vom Sender habe.« Sie stellte die Tasse ab. »Wie geht’s dir und Papa? Ist alles in Ordnung?«
»Eigentlich ganz gut. Na ja, dein Vater sollte sich mehr bewegen, aber das weißt du ja. Und ich wurstel so vor mich hin. Die Website hält mich auf Trab und meine Patienten auch. Die kommen wegen jedem Zipperlein in die Praxis. Allerdings öfter, um zu reden, anstatt sich behandeln zu lassen.«
»Wird es dir auch nicht zu viel?« Veras Mutter war immer eine engagierte Ärztin gewesen, sie wäre auch mitten in der Nacht durch einen Schneesturm gefahren, wenn einem ihrer Patienten der Zeh schmerzte. Fast zu engagiert, fanden Vera und ihr Vater. Erst seit einigen Jahren trat sie etwas kürzer. Doch Carina konnte nicht anders, es war ihre Überlebensstrategie, in der Betreuung anderer aufzugehen, bis sie sich selbst und den eigenen Schmerz nicht mehr spürte.
»Ach, es gibt doch Neuigkeiten! Wir haben für die Website ein neues Age-Progression-Bild machen lassen.« Ihre Mutter stand auf. »Komm, ich zeig’s dir!«
»Sollen wir nicht erst den Koffer öffnen?« Vera wollte dieses Bild nicht sehen.
»Der läuft uns nicht weg. Na los, komm!«
Widerstrebend stand sie auf. Bevor sie ihrer Mutter in den Flur folgte, blickte sie noch einmal in den Garten hinaus, doch Finn und ihr Vater waren nicht mehr zu sehen.
Mit einem flauen Gefühl im Magen betrat Vera hinter ihrer Mutter das kleine Büro, dessen Wände mit Vis Gesicht tapeziert waren, mit all den Suchmeldungen, die ihre Eltern im Lauf der Jahre in Westberlin und Umgebung an jeden Laternenmast geklebt hatten. Dazwischen Zeitungsartikel, die neben Vis Foto meist den Waldweg oder den Teufelsbruch zeigten, weil es sonst einfach nichts zu zeigen gab. Am Anfang hatte es viele Hinweise gegeben, die sich aber alle als nutzlos herausgestellt hatten. Später hatten sich dann angebliche Hellseher oder Privatdetektive gemeldet, die gegen horrende Honorare ihre Dienste anboten.
Ihre Mutter schaltete den Rechner ein, der von Papierstapeln und Aktenordnern umgeben war, und klickte im Stehen auf der Maus herum, bis ein Bild zu sehen war. »Hier, ist doch richtig schön geworden, nicht?« Sie trat zur Seite, und Vera überwand sich, auf den Monitor zu sehen. Das Bild zeigte eine Frau Anfang oder Mitte dreißig, die Vera entfernt ähnlich sah. Sie hatte das gleiche mittelbraune Haar, die gleichen blaugrauen Augen, doch Vera suchte vergeblich ihre Schwester im Gesicht dieser Frau, die es nicht gab, die nur eine von einem Computer berechnete Näherung war.
Ihre Eltern hatten schon früher solche Bilder anfertigen lassen, obwohl sie sehr teuer waren. Sie zeigten Vi erst mit fünfzehn Jahren, dann im Alter von fünfundzwanzig. So könnte sie aussehen, hatten die Bilderexperten betont. Oder auch ganz anders. Lebensumstände, Ernährung, Kleidungsstil, Frisur – all das ergab unzählige mögliche Vis, und keine von ihnen existierte wirklich. Vi war wie Schrödingers Katze, gebannt in einen Schwebezustand, weder tot noch lebendig, solange keine Verbindung zum Rest der Welt bestand.
»Ich stelle das auf Facebook und alle Seiten über vermisste Kinder. Vielleicht bringt das den Durchbruch.«
Die Überzeugung in der Stimme ihrer Mutter machte Vera hilflos. Die Hoffnung war das Floß, mit dessen Hilfe sich ihre Mutter über Wasser hielt, das ihrem Leben Struktur gab, und nicht zuletzt der Grund, überhaupt weiterzumachen. Sie betrieb die Suche nach Vi wie andere ein leidenschaftliches Hobby.
Und wir?, hätte Vera sie gerne gefragt und fühlte sich schlecht dabei. Finn und ich, sind wir nicht Grund genug? Doch Vi war unverrückbar der unsichtbare Mittelpunkt der Familie, und ihre Abwesenheit nahm so viel Raum ein, dass alles andere an den Rand gedrängt wurde. Da es ihrer Mutter so wichtig zu sein schien, auf diese Art wenigstens irgendetwas tun zu können, wollte Vera es ihr nicht nehmen. Es war schäbig, auf jemanden eifersüchtig zu sein, der seit achtzehn Jahren verschwunden war.
»Ist wirklich gut geworden«, sagte sie und lächelte ihrer Mutter zu. »Im Internet verbreiten sich solche Sachen unheimlich schnell.« Sie nahm zwei Büroklammern aus dem blauen Plastikschälchen neben dem Bildschirm, schob den Drehstuhl zurück und stand auf. »Wollen wir uns jetzt den Koffer vornehmen?« Sie war froh, Vis vielfachen Blicken mit den darin liegenden Vorwürfen entrinnen zu können.
Erst im Wohnzimmer konnte Vera wieder frei atmen. Sie setzte sich und nahm den kleinen Koffer auf den Schoß, um sich den Verschluss genauer anzusehen. Es war ein einfacher Klappriegel, der mit einem Schloss gesichert war. Sie bog eine der Büroklammern auf und stocherte damit im Schlüsselloch herum, nahm dann die zweite zu Hilfe. Im Inneren des Mechanismus bewegte sich etwas zur Seite, und als Vera fester drückte, sprang der Riegel auf.
»Großartig!« Ihre Mutter setzte sich neben sie, Vera klappte den Deckel auf, und sie beugten sich gemeinsam über den Inhalt. Ein staubiger, leicht muffiger Geruch stieg ihnen in die Nase. Der Koffer enthielt mehrere zusammengerollte Bögen aus dickem, handgeschöpftem Papier. Vera nahm einen heraus und rollte ihn auf. Es war die Zeichnung eines Blutkreislaufs mit lateinischen Benennungen in gestochener Schreibschrift, die Blutbahnen waren bis in feinste Verästelungen in blauer und roter Aquarellfarbe ausgeführt. Auch die anderen Bögen enthielten anatomische Zeichnungen: eine Lunge, ein Querschnitt der Hautschichten, eine Hand mit teilweise bloßgelegtem Muskelgewebe. Signiert waren sie mit Teresa Molinari, in derselben musterhaften Schrift wie die der lateinischen Namen.
»Ich wusste gar nicht, dass mamma so zeichnen konnte«, sagte Veras Mutter. »Die lasse ich rahmen und hänge sie in der Praxis auf.«
Vera legte die Papierrollen auf den Couchtisch und sah nach, was sich noch in dem Koffer befand. Ihr war, als hätten sie eine Zeitkapsel geöffnet. In einer marmorierten Bakelitdose lagen Haarbänder aus Samt und zwei Messingringe, die so klein waren, dass sie einem Kind gehört haben mussten. Der eine hatte einen grünen Stein, wahrscheinlich aus Glas, der andere ein vierblättriges Kleeblatt. »Das sind bestimmt Kindheitserinnerungen.« Vera schloss die Dose wieder und legte sie ebenfalls auf den Tisch.
Die nächsten Fundstücke stellten sie vor ein Rätsel. Es waren drei Spatel, einer schmal und vorne abgerundet, der andere breit und rechteckig, der dritte trapezförmig wie ein Gipsspachtel. Das Holz der Griffe war durch die häufige Benutzung dunkel und glatt geworden.
»Ist das was Medizinisches?«, fragte Vera, aber ihre Mutter schüttelte den Kopf. »So was habe ich noch nie gesehen. Eigenartig.«
Ganz unten im Koffer lagen einige Fotos in unterschiedlichen Formaten, manche auf Papier, dessen Ränder in Wellenform geschnitten waren, andere auf Karton. Veras Mutter setzte ihre Brille auf, die an einer dünnen Goldkette um ihren Hals hing. »Das hier muss Teresa als Kind sein.« Sie zeigte auf das Porträt eines ungefähr siebenjährigen Mädchens mit geflochtenen Zöpfen, das auf einem Hocker saß und ernst in die Kamera blickte. Im Hintergrund umrahmten üppige Stoffbahnen eine gemalte Landschaft. Ein anderes Bild zeigte eine hohe Glastür, an die sich zu beiden Seiten große Fensterfronten anschlossen. Über der Tür hing ein Schild mit der verschnörkelten Aufschrift Caffè Molinari. Lichter spiegelten sich in den Scheiben und verzerrten die Gestalten im Inneren, die Theke und das dahinterliegende Flaschenregal. »Ach, sieh mal, das Café!«, sagte Veras Mutter. »Was gab es da herrliche Nougatpralinen, weißt du noch?«
»Ja, die waren lecker. Haben deine Mutter und Tante Lidia sich eigentlich gut verstanden?«
Veras Mutter zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Viel Kontakt hatten sie nicht mehr, nachdem meine Mutter nach Deutschland gegangen war, aber es gab auch keinen Streit. Ich nehme an, ihre Leben waren einfach zu unterschiedlich. Lidia hat immer für das Café gelebt, aber das hat Teresa natürlich überhaupt nicht interessiert.«
Vera nickte und sah die restlichen Fotos durch. Eines zeigte ein Baby, das auf dem Schoß einer Frau mit üppigem Busen saß. Beide blickten starr in die Kamera, was wohl der langen Belichtungszeit und dem Versuch, den Säugling lange genug still zu halten, anzulasten war. Veras Mutter lachte leise. »Das ist deine Urgroßmutter, und das Baby muss Alessandro sein.«
»An den kann ich mich überhaupt nicht erinnern.«
»Er ist ein bisschen eigen, ich weiß gar nicht, ob er damals bei unserem Besuch dabei war.«
Es gab ein weiteres Bild, das vor dem gemalten Hintergrund mit den drapierten Stoffen aufgenommen worden war. Es zeigte drei junge Frauen, die die Arme umeinandergelegt hatten und so dicht zusammenstanden, als wären sie miteinander verwachsen. Alle drei trugen das gleiche lange Abendkleid, anscheinend aus Satin, wie die schimmernden Lichtreflexe auf dem Stoff vermuten ließen.
Die junge Frau auf der linken Seite lächelte etwas verhalten in die Kamera, die in der Mitte versuchte, mit ihren streng zurückgenommenen Haaren älter zu wirken, als sie war. Das Mädchen ganz rechts stach die anderen beiden mit ihrer jugendlichen Schönheit aus. Ihr offenes Haar bildete einen dunkel leuchtenden Rahmen um ihr Gesicht, das so zart und schön war, dass Vera das Wort »lieblich« in den Sinn kam. Sie reckte der Kamera das Gesicht entgegen und lächelte verheißungsvoll.
»Wer ist denn die ganz rechts? Die ist ja so schön, dass man es kaum aushält«, sagte Vera. Ihre Mutter rückte sich die Brille zurecht. »Das in der Mitte ist Lidia und links von ihr mamma, aber die dritte kenne ich nicht. Vielleicht eine Freundin?«
Vera drehte das Bild um. Auf der Rückseite stand in altertümlicher Schrift: 1948, Le sorelle Molinari. Lidia, Teresa, Aurora.
»Die Schwestern Molinari«, sagte Vera langsam und sah von dem Foto zu ihrer Mutter. »Sie waren drei, Mama. Warum hast du mir nie etwas von Aurora erzählt?«
Ihre Mutter sah immer noch das Foto an, und es dauerte einen Moment, bis sie antwortete. »Weil ich noch nie von ihr gehört habe.«
Auf dem Rückweg in die Stadt erzählte Finn ohne Pause, welche Manöver er und Opa mit der Drohne vollführt hatten. Doch nach einiger Zeit schweifte Veras Aufmerksamkeit ab. Sie dachte an den Inhalt des Koffers, der neben ihr auf dem Beifahrersitz lag. Damit würde sie Patrick, den Ressortleiter, überzeugen, eine Auslandsrecherche zu finanzieren. Wenn sie bei Großtante Lidia wohnen konnte, würde sie die Hotelkosten sparen.
Das Bild der drei jungen Frauen ging ihr nicht aus dem Kopf. Weshalb hatte ihre Großmutter niemals von der dritten Schwester gesprochen? Und was war mit ihr geschehen? Vera hatte nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken im Internet nach Aurora Molinari gesucht, jedoch nichts gefunden. Möglicherweise war ihre Großtante Aurora noch während des Krieges gestorben, ebenso wie Veras Urgroßeltern. Das Caffè Molinari war kurz vor Kriegsende ausgebrannt, so viel wusste Vera über die Familiengeschichte. Anscheinend hatte ihre Urgroßmutter die Kasse retten wollen und war von den Flammen eingeschlossen worden. War Aurora ebenfalls bei dem Brand umgekommen? Aber weshalb hatten die beiden anderen Schwestern nie über sie gesprochen? Etwas Einschneidendes musste damals passiert sein, und vielleicht war das sogar der Grund, weshalb Teresa ihre Heimat verlassen hatte?
Vera arbeitete lange genug als Journalistin, um eine gute Geschichte zu erkennen, wenn sie auf eine stieß, und eine Geschichte, die so viele Fragen aufwarf, war gut.
»Nächstes Wochenende gehen Opa und ich in den Forst und filmen mit der Drohne im Wald«, sagte Finn gerade, »vielleicht erwischen wir sogar ein Eichhörnchen!«
»Das wird sich bestimmt wundern, wenn es auf einmal eine riesige, brummende Fliege vor sich sieht«, sagte Vera, und Finn lachte sein glucksendes Kinderlachen, für Vera das schönste Geräusch auf der Welt. Sie hatte ihm vor nicht allzu langer Zeit einen Witz nach dem anderen erzählt und währenddessen sein Lachen aufgenommen, denn es würde nicht mehr lange dauern, bis es ihm abhandenkam. Einerseits wollte sie, dass er groß wurde, weil es sie zumindest teilweise aus der Verantwortung für ihn entließ, doch ein anderer Teil von ihr betrauerte, dass das Kind, das er jetzt noch war, für immer verschwinden würde.
Sie parkte vor dem Sendergebäude, und sie stiegen aus. »Dauert das lange?«, wollte Finn wissen.
»Eine halbe Stunde oder so.«
Finn ächzte. »Kann ich hierbleiben und Skateboard fahren?«
Vera sah sich um. In der Nähe waren nicht viele Leute unterwegs, aber im angrenzenden Park sah sie bunte Flecken zwischen den Büschen, Kinderstimmen drangen herüber. Falls etwas passierte, würde Finn Hilfe rufen können. Und er hatte ja auch sein Telefon. Sie wusste, wie neurotisch sie sich verhielt, konnte aber nichts dagegen unternehmen. Dass die Mütter von Finns Klassenkameraden zum Teil noch tiefer über ihren kostbaren Kindern kreisten als sie, war keine Entschuldigung. Sie wusste, dass es anders sein sollte, dass sie Finn zutrauen sollte, eine Zeit lang alleine auf einem Parkplatz Skateboard zu fahren, aber vermutlich würde sie keine ruhige Sekunde haben, solange sie in Patricks Büro saß.
»Du bleibst aber hier auf dem Parkplatz, klar?«, sagte sie, während sie den Kofferraum öffnete, sodass Finn sein Skateboard herausholen konnte.
»Ja, klar«, sagte er nachsichtig, stellte einen Fuß auf das Board und schob mit dem anderen an. Im Davonrollen hob er lässig die Hand, ohne sich umzusehen. Vera holte noch den Koffer aus dem Wagen und ging zum Haupteingang, wo sie sich noch einmal umdrehte. Beruhigt sah sie Finns knallgrünes T-Shirt am anderen Ende des Parkplatzes leuchten.
Im Gebäude war es kühl und wesentlich ruhiger als unter der Woche. Sie stieg die Treppe hinauf bis in den vierten Stock und trat leicht außer Atem in Patricks Büro, dessen Tür wie immer offen stand.
»Ah, die Sonne geht auf!« Patrick begrüßte so jeden, der in sein Büro kam, egal, ob es die Praktikantin oder der Hausmeister war.
»Allmählich könntest du dir ein paar neue Komplimente zulegen.« Vera legte den Koffer auf den Schreibtisch und küsste Patrick zur Begrüßung auf die Wange.
»Wenn ich Zeit dazu hätte, würde ich’s tun, aber du siehst ja – sogar am Sonntag prügelt man mich hinter den Schreibtisch.«
»Ich glaube eher, dass man dich prügeln müsste, um dich hier rauszujagen.« Vera nahm sich eines der Schokoladenbonbons, die auf Patricks Tisch standen und neben dem Kantinenessen mitverantwortlich für seinen Bauchansatz waren.
»Wo soll ich auch hin?«, sagte er mit Leidensmiene. »Keine Frau, keine Kinder, kein trautes Heim …«
»Mein Mitleid hält sich in Grenzen.« Patrick lebte mit seinem Freund, einem Banker, in einem Fabrikloft am Hackeschen Markt.
»Lass uns mal über dieses Feature sprechen, das ich dir anbieten will.«
»Das über deine Großmutter, die Wissenschaftlerin?«
»Genau. Meine Mutter hat ein paar Sachen von ihr auf dem Dachboden gefunden, und dabei ist eine ganz eigenartige Sache rausgekommen.« Sie erzählte Patrick von Aurora und zeigte ihm das Foto der Mädchen.
»Sehr geheimnisvoll.« Patrick strich sich über seinen Musketierbart. »Und das mit dem Café ist auch gut. Von der Gastronomie zur Wissenschaft, kann ich mir gut vorstellen.«
»Der Haken ist, dass ich für die Recherche nach Turin fahren müsste.«
»Für wie lange?«
»Ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie ich vorankomme. Ich wollte meine Verwandten befragen, die Schwester und ein Bruder meiner Großmutter leben noch. Und wegen der geheimnisvollen dritten Schwester werde ich mich vor Ort in Zeitungsarchiven umsehen.«
»Also, eine Tagespauschale kann ich dir leider nicht zahlen«, sagte Patrick. »Und auch kein Hotel. Zwei Tage gingen, aber zwei Wochen …«
»Ich kann sicher bei meiner Großtante wohnen«, sagte Vera schnell. »Im selben Haus ist auch meine Großmutter aufgewachsen.«
»Wunderbar, dann passt das doch. Dann machen wir wie immer Zweitausendachthundert für sechzig Minuten, plus Recherchepauschale von fünfhundert – als Beitrag zu den Reisekosten, Verpflegung undsoweiter. Gut für dich?«
»Perfekt.« Vera ließ sich nicht anmerken, wie zufrieden sie war. Sie hatte mit einer Länge von höchstens dreißig Minuten gerechnet, und die Recherchepauschale war Musik in ihren Ohren. Zusammen mit Toms Unterhaltszahlungen bedeutete das zwei Monate finanzielle Sicherheit für Finn und sie. »Danke, Patrick.«
Er winkte ab. »Ach, geh! Ist ein super Thema, ich hab zu danken! Kommst du heute Abend mit mir und Frank ins Geist im Glas?
»Geht leider nicht, Mutterpflichten, aber amüsiert euch gut.« Vera stand auf. »Ich muss los, Finn wartet unten auf mich.«
Patrick schniefte dramatisch und winkte ab. »Genießt nur alle das schöne Wetter!«
Vera lachte. »Der Kapitän bleibt auf der Brücke, so ist das nun mal.«
Als sie aus dem Haupteingang trat, kam ihr das Licht greller vor. Sie beschattete mit einer Hand ihre Augen und hielt Ausschau nach Finns grünem T-Shirt. Es war nirgendwo zu sehen. Vielleicht übte er gerade hinter einem der geparkten Autos. Sie ging über den Parkplatz auf ihren Wagen zu und behielt dabei die Umgebung im Auge. Kein Finn. Er muss hier irgendwo sein. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse und scannte den gesamten Parkplatz, mechanisch, Stück für Stück. Finn war nicht da. Die Angst packte ihre Eingeweide und wrang sie wie einen Putzlappen. Einen Moment lang fühlte sie sich vollkommen hilflos. Sie rief nach Finn, doch es kam keine Antwort. Erst dann fiel ihr das Telefon ein. Sie kramte in ihrer Tasche, fand es endlich, konnte in der Sonne das Display aber nicht erkennen und kauerte sich hinter ihrem Auto in den Schatten. Ihre Finger zitterten, als sie die PIN und dann die Kurzwahl für Finns Nummer eintippte. Sie presste sich das Telefon ans Ohr, verstopfte mit dem Zeigefinger das andere. Es klingelte. Zweimal, dreimal. Nach dem vierten Mal würde die Mailbox rangehen. Ihre Eingeweide zogen sich noch mehr zusammen.
»Hallo?«
Sie war so erleichtert, Finns Stimme zu hören, dass sie erst bewusst einatmen musste, bevor sie sprechen konnte. »Sag mal, wo steckst du denn? Ich bin hier am Auto.« Locker, damit er die Sorge in ihrer Stimme nicht wahrnahm.
»Ich bin im Park. Auf dem Parkplatz war es langweilig. Hier gibt’s so niedrige Geländer, da kann man super grinden.«
Vera schloss die Augen. »Ich bin fertig mit meinem Termin. Kommst du bitte?«
Keine Minute später rollte Finn auf sie zu, sprang im Fahren vom Board, trat auf das hintere Ende, sodass es in die Luft schnellte, und fing es geschickt auf. »Alles klar?«
»Bei mir schon. Aber bei dir nicht.« Weshalb äußerte sich Erleichterung so oft als Zorn? »Ich hab dir doch gesagt, du sollst hierbleiben. Wenn du dich nicht an unsere Absprachen hältst, kann ich dich nicht mehr alleine lassen.« Hör dir selbst zu, zum Kotzen.
»Och Mann, es ist doch gar nichts passiert!« Finn strich sich den verschwitzten Pony, der ihm bis zur Nasenspitze reichte, aus dem Gesicht.
»Ich muss aber wissen, wo du steckst. Schick wenigstens eine Nachricht, wenn du woanders hingehst als verabredet! Okay, Äffchen?« Sie strich ihm über den Kopf. Er ließ es sich eine Sekunde lang gefallen, bevor er ihre Hand abschüttelte.
»Ja, okay.«
»Komm, pack dein Board ein.«
Die ganze Rückfahrt lang war ihr übel. Dieses Mal war Finn nichts passiert, aber sie wurde das Gefühl nicht los, das Schicksal herausgefordert zu haben. Sie versuchte, es abzustreifen. Früher hatte sie vor nichts Angst gehabt, im Gegenteil, sie hatte es sogar genossen, möglichst riskante Dinge zu tun, aber seit Finn auf der Welt war, schien ihr gemeinsames Leben nur noch aus Gefahren zu bestehen. Was würde aus Finn, wenn ihr etwas zustieße? Sie flog nicht einmal mehr, wenn es nicht sein musste, so sehr hatte diese abergläubische Furcht sie im Griff. Sie musste wachsam sein, jeden Augenblick, sonst würde etwas Schreckliches passieren.
»Carinas Tochter? Wie schön, von dir zu hören, cara cugina.« Maurizios tiefe Stimme ließ Veras Trommelfell vibrieren.
»Ich weiß, ich hätte mich schon längst einmal melden sollen, aber du weißt ja …« Er unterbrach sie. »Natürlich, kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich freue mich, dass du dich jetzt meldest. Kaum zu glauben, du warst ein kleines Mädchen, als wir uns zuletzt gesehen haben. Ich wüsste zu gerne, wie du jetzt aussiehst.«
»Das lässt sich machen. Ich rufe an, weil ich in den nächsten Tagen nach Turin komme und mich gerne mit dir und Tante Lidia treffen würde.« Vera machte eine kleine Pause. »Ich arbeite als Radiojournalistin und mache eine Sendung über Teresas Leben. Meinst du, ich könnte ein Interview mit euch führen?«
»Was mich betrifft, gerne«, schnurrte Maurizio. »Was meine Mutter angeht, muss ich natürlich sie fragen. Warte bitte einen Moment.«
Im Hintergrund hörte Vera Stimmengewirr, Tellergeklapper und das Zischen einer Espressomaschine. Das Molinari schien gut besucht zu sein. Sie hörte Maurizio mit jemandem sprechen, dann war er wieder am Apparat.
»Vera? Tut mir sehr leid, aber sie sagt, sie möchte nicht über die Vergangenheit reden.«
Dass ihre Großtante kein Interesse an dem Feature haben würde, hatte Vera nicht einkalkuliert. Damit wäre das Projekt gestorben.
»Könnte ich kurz selbst mit ihr sprechen?«
»Ich frage sie.« Es dauerte eine halbe Minute, dann meldete sich eine brüchige Stimme. »Vera? Hier spricht deine Tante Lidia.«
»Wie geht es dir?«
»Hervorragend. Früh aufstehen und harte Arbeit machen ein langes Leben.«
»Das ist schön zu hören. Ich würde dich sehr gerne von meinem Vorhaben überzeugen. Es wäre für eine Sendereihe, in der es um Frauen geht, die etwas Besonderes erreicht haben, die ihren Weg gemacht haben, trotz aller Schwierigkeiten – so wie du und Teresa. Es war sicher nicht leicht, damals nach dem Krieg.«
»Ha, das könnt ihr Jungen euch gar nicht mehr vorstellen! Unser letztes Geld haben wir ins Café gesteckt und gearbeitet bis zum Umfallen.«
Jetzt einhaken! »Und genau das ist so interessant, Tante Lidia. Wie ihr das hinbekommen habt, trotz der miserablen Bedingungen, daran können sich junge Frauen heute ein Beispiel nehmen. Und natürlich wäre es auch Werbung für das Café und eure Pralinen – die Sendung wird bundesweit ausgestrahlt und kann per Internet auf der ganzen Welt gehört werden.«
»Tatsächlich? Du meinst, deine Sendung würde uns bekannter machen?« Lidia klang auf einmal viel lebhafter.