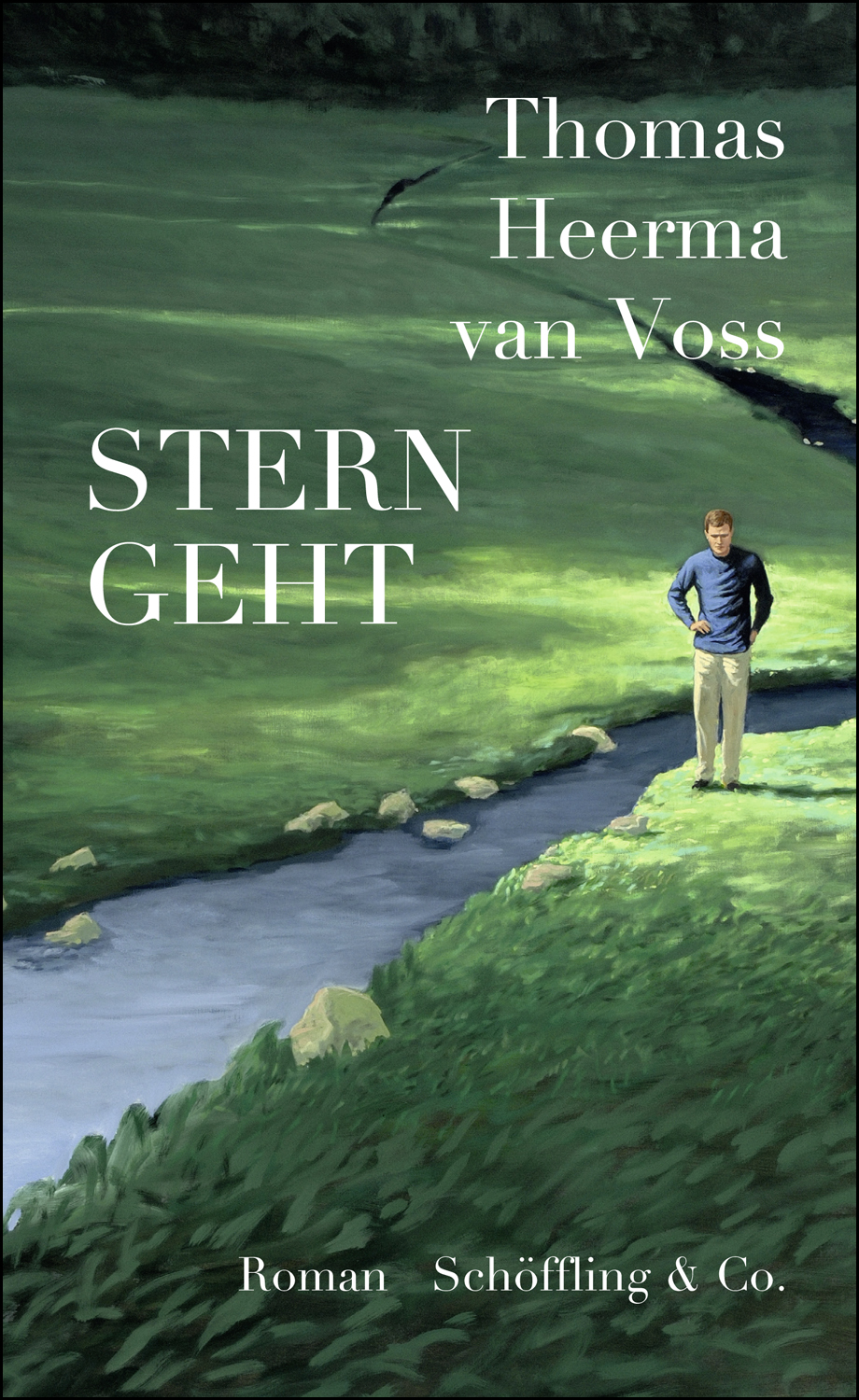
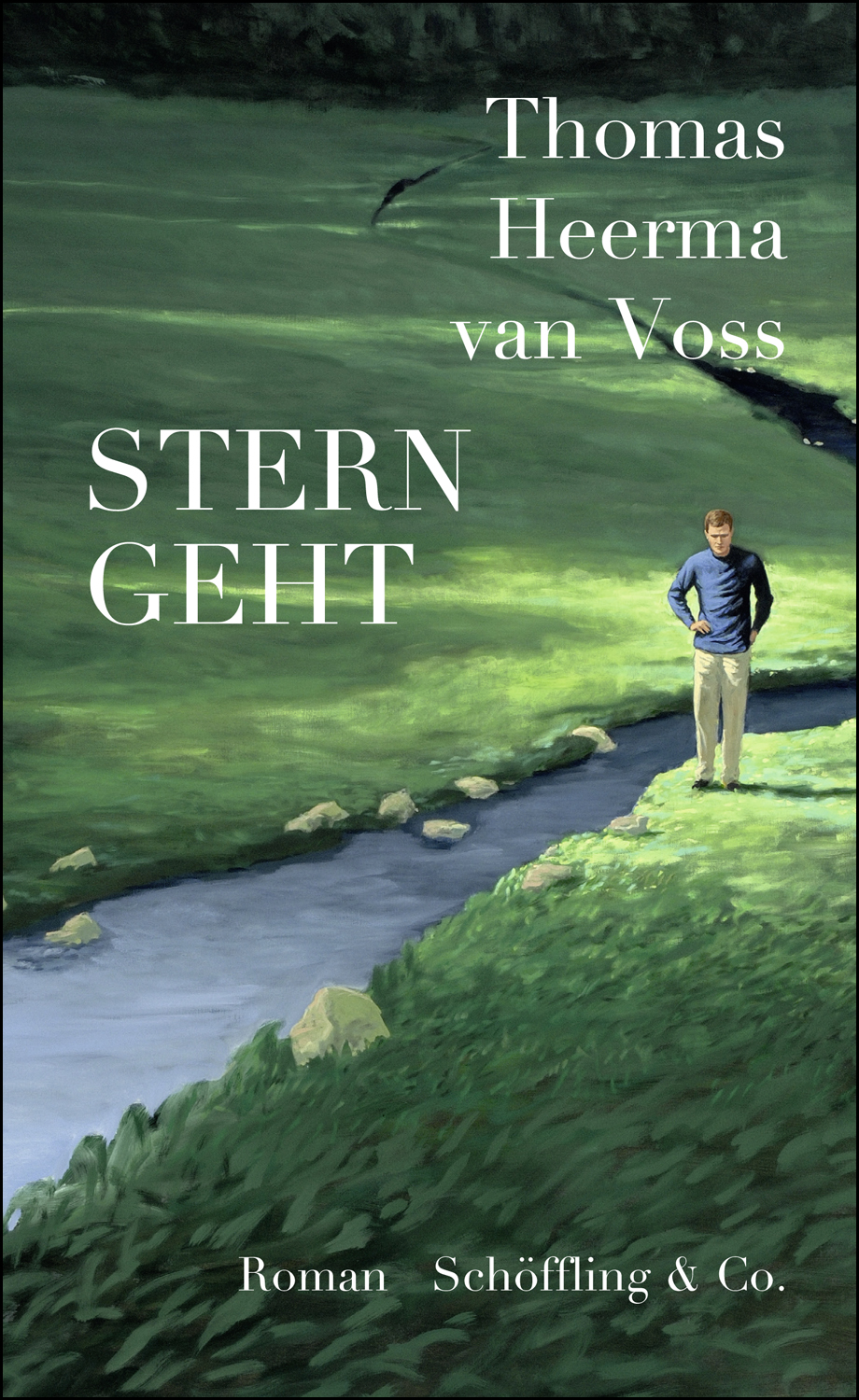
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
1. Teil: London
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2. Teil: Amsterdam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3. Teil: Seoul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dank
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
[Leseprobe – Zeuge des Spiels]
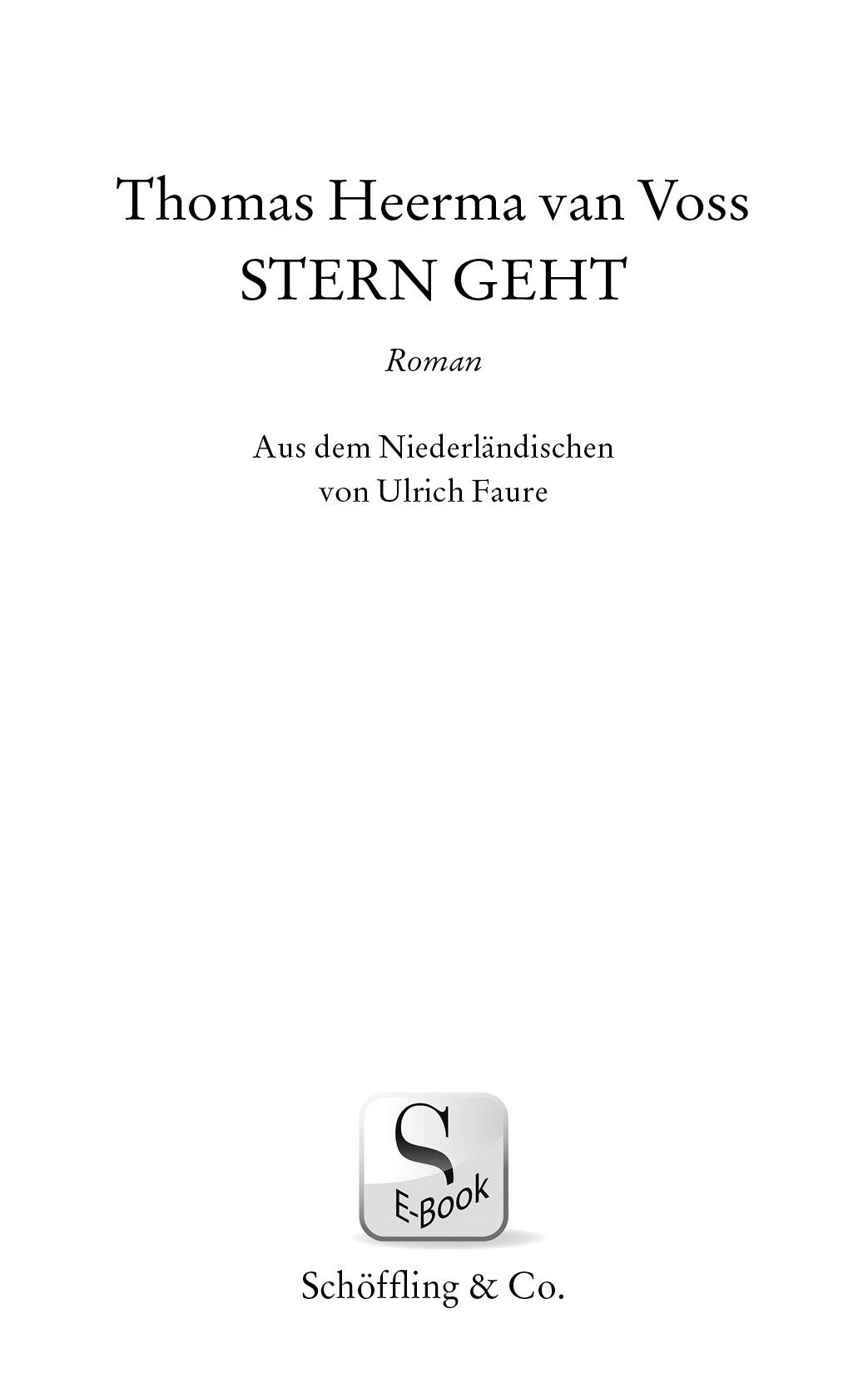
Now what you need is silence
And you don’t want no one to see you like this
Maybe you don’t recognize it
But this is your home, this is where your life lives
(Atmosphere: Your Glass House)
1. Teil
London
1.
»Sollen wir anfangen?«
Bestimmt schon eine Minute hält Hugo Stern die Bowlingkugel. Er sieht sich um, zu Bram, zu den Kindern an den Bahnen neben ihm, zu der blonden Frau hinter der Theke. Dann wirft er die Kugel, ohne weiter etwas zu sagen. Es gibt wenig, was ihn so beruhigt wie diese Bewegung. Vor allem in genau dem Moment, wenn seine Hand die Kugel gerade losgelassen hat, fühlt sich Stern unüberwindlich, alles ist exakt im Gleichgewicht, übersichtlich, wie es sein soll.
Patsch. Drei Kegel fallen um.
»Papa …«
»Moment.« Stern reibt sich die Hände, läuft zum Rack und nimmt eine neue Kugel. Er wirft mit aller Kraft. Wieder die unfassbare Kontrolle, aber es folgt kein erlösender Knall.
Die Kugel landet im Rücklauf.
»Papa …«
Stern spürt eine Hand auf seinem Rücken. Bram hat sich hinter ihn gestellt, hängende Schultern, müdes Gesicht. Stern beugt sich ein wenig hinunter, um auf gleiche Höhe zu kommen. »Was ist los?«
Während er fragt, sieht er Bram durchdringend an, direkt in seine dunkelbraunen Augen, von denen er vergeblich hofft, dass sie den seinen ähnlich sind.
»Ich will nicht.«
»Was?«
»Ich hab keine Lust zu spielen. Können wir gehen?«
»Bitte? Wir sind doch grad erst reingekommen. Du hast noch kein einziges Mal geworfen.«
»Weiß ich, aber ich will nicht. Heute nicht.«
Die Kugeln, die Stern eben gespielt hat, kommen zurückgerollt, bereit für den Nächsten.
»Warum heute nicht? Geht es dir nicht gut?«
»Nein, das hätte ich dann schon gesagt. Ich hab einfach keine Lust.«
»Aber wir gehen doch so gut wie jede Woche in De Kegel, mein Lieber. Das ist Tradition.« Stern tut sein Bestes, um überzeugend zu klingen, hört aber Gekränktheit in seiner Stimme, vielleicht sogar Entrüstung.
»Papa, bitte. Ich will einfach nicht mehr.«
Im letzten Monat hatte es bereits genügend Hinweise auf diesen Moment gegeben, wird Stern bewusst. Das eine Mal wollte Bram nicht spielen, weil er sich auf seine Abschlussprüfung vorbereiten musste, das nächste Mal, weil er sich nicht gut fühlte. Stern war jedes Mal allein gegangen. Und wenn er dann zwei Stunden später nach Hause kam, fand er Bram an seinem Computer. Manchmal beim Chatten auf Facebook, manchmal spielte er nur. Keinerlei Anzeichen von Unwohlsein oder Nervosität vor den bevorstehenden Prüfungen. »Alles in Ordnung?«, fragte Stern meist, worauf Bram antwortete: »Ach.« Oder: »Geht so.«
Er betrachtet die beiden Bowlingkugeln neben sich. Es ist, als würden sie ihn anflehen, aufs Neue benutzt zu werden. Stern kann der Verlockung nicht widerstehen, er nimmt die erste und wirft sie mit voller Kraft.
Patsch, sechs Kegel fallen um.
Bram setzt sich auf die Bank vor der Bahn. Er nimmt sein iPhone. Seit er es letzten Sommer gekauft hat, sind Bram und sein Smartphone unzertrennlich. Andauernd holt er das kompakte schwarze Gerät hervor und tippt hastig allerlei Nachrichten. Hin und wieder hat Stern den Eindruck, dass sein Sohn mehr über das Smartphone mitteilt als mündlich.
Andere Väter wären in diesem Moment eingeschritten. Sie hätten gesagt: Pack das Telefon weg, wir sind zusammen hier. Stern nicht. Er ist ruhig geblieben, als der Schuldirektor ihn vor Monaten zu einem Gespräch gebeten hatte, und auch jetzt lässt er sich nicht aus der Fassung bringen. Merel bezeichnet ihn in letzter Zeit schon mal als abwesend, oder, wenn sie einen schlechten Tag hat: teilnahmslos. »Wieso teilnahmslos?«, hatte er neulich gefragt. »Wie kommst du darauf? Ich nehme an allem Anteil, ich bin immer für euch da.« Sie hatte lange geschwiegen und schließlich gesagt: »Irgendwie bist du nicht richtig bei der Sache.«
Stern schaut zu der glänzenden Holzbahn und streckt schon die Finger aus, um eine neue Kugel zu greifen, zwingt sich dann aber, sich neben Bram zu setzen.
Schweigend ziehen sie die blauroten Bowlingschuhe, die sie beim Hereinkommen erhalten haben, wieder aus.
Mit den Schuhen in der Hand gehen sie zum Ausgang. Im Hintergrund spielt eintönige Discomusik aus den Achtzigerjahren, hin und wieder unterbrochen durch das beruhigende Geräusch einer rollenden Kugel und umfallender Kegel.
Am Tresen müssen sie warten, bis die Mitarbeiterin zu ihnen kommt. Sie steht hinter der Bar, serviert einer Gruppe von Kindern Limonadengläser und ein Schälchen Knackwurst. Stern beobachtet die Szene zufrieden. Dann merkt er, dass Bram seine Finger drückt, sanft, tastend, wie ein Baby, das zum ersten Mal eine erwachsene Hand berührt. »Papa, ich muss dir was sagen.« Er spricht die Worte im Flüsterton. »Ich hab so was wie eine Freundin. Da geh ich jetzt gleich hin.«
So was wie eine Freundin. Diese Formulierung suggeriert eine Menge, auch wenn Stern nicht genau weiß, was. Wer weiß, vielleicht ist die Beziehung nur sexuell oder gerade rein platonisch. Da schießt ihm der Gedanke durch den Kopf: Vielleicht findet das Mädchen Bram hässlich, stößt sein Äußeres sie ab.
»Meine Herren, wie kann ich euch helfen?« Die Mitarbeiterin am Tresen sieht Stern lange an. Nicht verführerisch, das tun Mädchen ihres Alters bei ihm schon seit Jahren nicht mehr, sondern freundlich, wie man Stammkunden behandelt.
»Claire, wir sind schon wieder fertig für heute«, sagt er. »Nächste Woche wieder.«
Sie nimmt die Bowlingschuhe und desinfiziert sie mit einem Spray, obwohl sie kaum getragen sind. Dann stellt sie Sterns Lederschuhe auf die Theke und danach Brams schäbige Turnschuhe.
Sie fahren mit dem Aufzug nach unten.
»Wie heißt sie?«, fragt Stern auf halber Strecke.
Die Discomusik verebbt, man hört nur noch leise eine Basslinie.
»Shayla.«
»Shai-la?«, wiederholt Stern. »Lustiger Name.«
»Lustig?«
»Auf jeden Fall ungewöhnlich.«
»Sie ist weiß, falls du das meinst.«
Die Aufzugtüren öffnen sich. Draußen ist es dunkel. Zehn Minuten, länger waren sie nicht drin. Stern versucht, noch etwas von Brams Gesicht abzulesen, doch es ist undurchdringlich. Er stellt keine Fragen mehr.
Auf dem Schulhof von De Regenboog hört er zu seinem Grauen immer wieder Väter über ihren Papa-Tag reden, als ob ein einziger Tag den Rest der Woche kompensieren könnte, als sei Vaterschaft ein Beruf, den man zu festgesetzten Zeiten ausübt. Sich für einen Moment interessiert geben, ein Späßchen machen, ein Butterbrot schmieren, und hoppla, die Arbeit ist wieder mal getan. Stern weiß es besser. Er ist jederzeit für seinen Sohn da, aber wenn Bram keine Lust auf ein Gespräch hat: auch gut. Er ist nun mal kein Plauderer. Außerdem: Gerade die Schweigsamen haben es in sich, eines Tages alle zu verblüffen. Mit einem Buch, einem Film, einer wissenschaftlichen Entdeckung, womit auch immer. Vielleicht bringt es Bram zum Psychiater. Oder zum Richter, oder wie wäre es mit einer Karriere als Mathematiker? Bis dahin wird Stern Abstand halten. Kein Jugendlicher will Eltern, die sich zu sehr aufdrängen.
2.
Im Büro hing ein Foto des Direktors mit seinen zwei halbwüchsigen Söhnen. Sie saßen zu dritt am Strand, von einer grellen Sonne beschienen, und hatten einander die Arme um die Schultern gelegt. Sooft Stern diesen Raum auch betrat, er brachte es nicht über sich, länger als ein paar Sekunden auf das Foto zu sehen, sonst wäre er von einer akuten Übelkeit befallen worden, einer Mischung aus Neid und Widerwillen.
Vor sieben Monaten war er zum letzten Mal dort gewesen. Der Direktor fing ihn am Ende eines angenehm verlaufenen Donnerstags – die Schüler hatten aufmerksam zugehört, es war hart gearbeitet worden – auf dem Flur ab und sagte: »Hugo, kann ich dich mal kurz sprechen?« Stern machte sich sofort Sorgen. Der Direktor war ein Typ, für den der Besitz von Macht Grund genug war, sie auch auszuüben. Noch keine drei Jahre im Amt, hatte er schon mehr Veränderungen veranlasst als alle seine Vorgänger zusammen. Die hervorragend intakte Sporthalle war renoviert worden, die Schulbibliothek bekam ohne Grund einen neuen Standort, und mehrere junge Praktikantinnen nahmen ihren Dienst auf, während geschätzten Teilzeitkräften ungerührt die Tür gewiesen wurde.
»So«, sagte der Direktor, sobald sie in seinem Büro waren. »Wie geht’s? Läuft in der Klasse alles rund?«
Stern nickte, antwortete aber nicht. Angespannt blickte er in das junge, joviale Gesicht ihm gegenüber.
»Hugo, lass mich ehrlich sein. Das hier wird ein Gespräch, das wir nicht gerne führen. Aber als Schulleiter habe ich eine gewisse Verantwortung. Also würde ich sagen, setz dich mal.«
Stern nahm Platz. Auf dem Schreibtisch vor sich sah er einen Stapel ungeöffneter Post liegen: mehr Karten und Kuverts, als er selbst in Monaten bekommen hatte.
»Schau, als Schule müssen wir gewisse Entscheidungen treffen. Wir müssen tun, was uns auf lange Sicht am besten erscheint. De Regenboog ist letztlich auch nur ein Unternehmen.« Es folgte eine detaillierte Geschichte, der Direktor sprach immerzu von »wir«, wenn er ganz klar »ich« meinte, doch ansonsten ging so ziemlich alles an Stern vorbei. Eigentlich drang nur ein einziges Wort zu ihm durch. Vorruhestand. Stern kannte den Begriff nur ungefähr, aber gerade deshalb war ihm sofort klar, dass es um etwas Schwerwiegendes ging.
Er dachte an seine Klasse, die 4. Klasse. An alle 4. Klassen, die er in der Vergangenheit unterrichtet hatte. Es waren Dutzende, jedes Mal wieder eine neue Ansammlung sieben-, achtjähriger Schüler. Alle hatte er sie auf die 5. Klasse vorbereitet, für die Zukunft getrimmt. Aber über eine Zukunft im Vorruhestand hatte er niemals etwas gesagt. Diese Zukunft hatte er während der Vorbereitungen versäumt.
»Ich verstehe, wenn dich das ziemlich unerwartet trifft«, sagte der Direktor. »Lass es erst mal sacken. Aber du bist mit Abstand der, wie sollen wir sagen, erfahrenste Lehrer des Kollegiums. Eigentlich der einzige alten Schlages. Du passt da nicht mehr so gut rein, das musst du selbst doch auch gemerkt haben? Die Idee ist, dass wir es in aller Ruhe reduzieren. Ende Mai wird ein neuer Lehrer übernehmen. Und keine Sorge, du wirst normal weiterbezahlt.«
Der Direktor lächelte, immer dieses selbstgefällige, unausstehliche Grinsen. Als ob das Leben ein einziges großes Fest wäre, ein Witz, dessen Pointe sich Stern nicht erschloss.
Stern schob seinen Stuhl etwas zurück. Sollte er jetzt etwas sagen? Den Gegenangriff starten? Er wusste nicht einmal, wogegen genau. Es erschien ihm klüger, erst einmal Abstand zu gewinnen und die Lage zu sondieren, bevor er reagierte. Das Familienfoto im Rücken, verließ er das Büro. An der Tür überlegte er es sich jedoch anders: »Wie ist das mit dem Sportfest?«, fragte er. »Kann ich das denn noch weiter koordinieren?«
»Mach dir keine Gedanken. Das Problem lösen wir intern.« Nachdem er einen Blick in sein MacBook geworfen hatte, erhob sich der Direktor ebenfalls von seinem Stuhl. »Das kommt für dich jetzt ziemlich überraschend, oder? Nun ja, das verstehe ich gut, so etwas wie das hier kommt immer unerwartet. Aber du weißt doch, Hugo: Manchmal ist eine Veränderung für beide Seiten einfach das Beste! De Regenboog muss sich weiterentwickeln.«
Aber warum, wollte Stern fragen, warum lässt du dann ausgerechnet mich ziehen? Und noch wichtiger: wohin? Wohin in Gottes Namen?
Er sagte es nicht. Er beherrschte sich, wie er es in der Schule immer getan hatte. Erst Tage später, als die Erinnerung an das Gespräch ein wenig in den Hintergrund gerückt war, wagte er es, jemand anderem davon zu erzählen. Er rief einen früheren Nachbarn an, inzwischen ein erfolgreicher Anwalt, dessen Firma jedes Jahr eine Weihnachtskarte an die Familie Stern schickte. Stern warf sie immer ungelesen weg, aber an den Namen erinnerte er sich noch.
»Das können sie nicht machen«, sagte er am Telefon. »Ich habe schließlich einen unbefristeten Vertrag, ich kann doch nicht so einfach entlassen werden?«
Der Anwalt, der sich hörbar kaum entsinnen konnte, wer Stern überhaupt war, versprach, sich der Sache anzunehmen. Vier lange Wochen verstrichen, bis er endlich zurückrief: »Rechtlich gesehen ist deine Position bombensicher«, sagte der Anwalt. »Aber du musst dich entscheiden. Entweder mit guten Voraussetzungen jetzt ausscheiden oder noch zwei Jahre vor der Klasse stehen, in der Gewissheit, dass sie dich loswerden wollen. Was ich auch für dich tue, es wird eine untragbare Situation schaffen. Sie brauchen dich nicht mehr, Hugo. Es kommt heutzutage oft vor, dass sich Betriebe drastisch verjüngen wollen. Aber das Angebot, das sie dir gemacht haben, ist finanziell sehr verlockend. Ich würde es akzeptieren. Und bis es so weit ist, einfach nicht zu viel darüber nachdenken.«
Das tat Stern, mit großer Mühe zwar, doch es gelang. Außer Bram und Merel sagte er niemandem etwas von seinem Vorruhestand. Ob seine Kollegen informiert waren, wusste er nicht, sie sprachen ihn jedenfalls nicht darauf an. Und obwohl er beim Betreten seines Klassenzimmers immer ein leises Echo des Wortes Vorruhestand hörte, wechselte er auch mit seinen Schülern kein Wort über den nahenden Abschied. Die letzten Wochen sollten nicht im Zeichen eines Endes stehen, diese Klasse sollte ebenso unbeschwert sein wie alle Klassen davor.
Heute Nachmittag, nach dem Unterricht, rief Stern seine Schüler zu sich. Sie setzten sich im Kreis um ihn herum. »Ich muss euch was sagen. Etwas Schlimmes, aber ihr müsst es wissen. De Regenboog und ich werden uns trennen.« Er atmete tief ein. »Ich scheine nicht mehr gebraucht zu werden.«
Die Kinder sahen ihn verwirrt an, nicht imstande zu erfassen, was er meinte, doch sie begriffen, dass es um eine ernste Angelegenheit ging. Um sie zu beruhigen, teilte Stern persönlich zusammengestellte Tüten mit Süßigkeiten aus. Die Schüler nahmen sie dankbar in Empfang. Kaum, dass sie die Süßigkeiten gesehen hatten, schienen sie Sterns Abschied bereits wieder vergessen zu haben. Und bei so viel Freude fühlte sich Stern seltsamerweise auch schon wieder besser.
Im nächsten Moment ertönte die Schulglocke, und die Kinder stürmten hinaus. Durchs Fenster sah er, wie sie von ihren Eltern in Empfang genommen wurden, übertrieben fröhliche Väter und Mütter, die ihre Schätzchen umarmten und mit einer schwungvollen Bewegung hinten aufs Fahrrad setzten. Stern unterdrückte das Bedürfnis, seinen Schülern etwas hinterherzurufen, eine letzte Lebenslektion, eine Sentenz, die ihnen für immer im Gedächtnis bleiben würde.
Als sie alle fort waren, räumte er sein Klassenzimmer auf. Er wischte mit einem kleinen Lappen die Tische ab, warf ein paar zertretene Süßigkeiten in den Papierkorb, rückte die Stühle zurecht und steckte schließlich sein Unterrichtsmaterial in vier Albert-Heijn-Beutel. Er nahm alles mit, was er sah: Kulis, Bleistifte, Radiergummis, Lineale, Hefte, einen Taschenrechner, ein Etui. Und natürlich die Ordner, die er vom ersten Arbeitstag an geführt hatte.
Fast anderthalb Stunden war Stern beschäftigt. Er machte so lange weiter, bis in seinem Klassenzimmer nichts mehr an ihn erinnerte. Er verwischte seine Spuren.
3.
Hinter dem geschlossenen Fenster brennt Licht. Merel sitzt, mit einem Ausdruck ihres neuen Buchs vor sich, am Tisch. Stern beobachtet sie vom Bürgersteig der Heinzestraat aus. Große hellblaue Augen, kein Make-up oder Lippenstift. Er erinnert sich noch gut daran, wie er dieses Gesicht neunundzwanzig Jahre zuvor zum ersten Mal gesehen hat, bei einer Weinprobe, wo sie bis zum Umfallen tranken. Er fühlte sich sofort zu ihr hingezogen. Ihr Aussehen, ihr Humor, ihr Scharfsinn – alles gefiel ihm. Drei Wochen später war ihm klar: Mit dieser Frau will ich den Rest meines Lebens teilen, eine Familie gründen. Kein Jahr später war sie schwanger.
Durch den engen Flur geht er zu ihr. Er will ihr einen Kuss geben oder fragen, wie ihre Arbeit vorankommt – eine eingeschliffene Routine, die zum Familienleben dazugehört. Als er das Zimmer betritt, wird seine Aufmerksamkeit jedoch durch ein Papier auf dem Tisch gefesselt. Ein kleiner grünroter Flyer mit der Preisliste einer Pizzeria. Bram steht handschriftlich oben drauf. Stern kann seinen Blick nicht davon abwenden. Es ist, als sähe er einen Fleck auf einer sonst sauberen Tischplatte, eine Unregelmäßigkeit, die er beseitigen muss. Nur kann er das hier nicht so ohne Weiteres wegputzen. Dieser Fleck ist mit Absicht so auffällig auf dem Tisch platziert worden.
»Was macht der Flyer mit Brams Namen hier?« Bevor Merel antworten kann, redet er weiter. »Hast du das geschrieben? Gestern Abend habe ich die Küche noch aufgeräumt, und da war das bestimmt noch nicht da. Ich habe noch nie von dieser Pizzeria gehört.«
»Wir gehen morgen hin.«
»Was? Wir? Aber … wir gehen doch immer in andere Restaurants. Ich habe noch einige Adressen, wo wir hin müssen.« Stern schluckt. Erst das Bowlen, jetzt das. Fast, als ob Bram und Merel das so geplant hätten: Jetzt, da er nicht mehr unterrichten darf, ihn gleich zusammen auf die Probe stellen. Er schaut nach den vier Beuteln, die er heute Nachmittag aus der Schule mitgebracht hat, sie stehen in der Zimmerecke. Einen Augenblick überlegt er, Merel etwas von seinem letzten Arbeitstag zu erzählen, von den Schülern, die sich nun ohne ihn durchschlagen müssen, oder über das Bowlen eben. Aber ihm fallen die passenden Worte nicht ein.
»Das weißt du doch schon lange!« Merel gibt sich keine Mühe, ihre Ungeduld zu verbergen. Früher hat sie nicht so mit ihm geredet. Damals haben sie sowieso viel mehr gesprochen, vor allem abends im Bett erzählten sie sich ausführlich, was sie tagsüber erlebt hatten. Jetzt verbringt sie die Hälfte der Zeit in ihrem Apartment in Castricum. Eines Morgens vor etwa drei Jahren war sie ohne jede Begründung ins Gästezimmer in der zweiten Etage umgezogen. Sie hat nie erklärt, warum. Er seinerseits hat sich nicht getraut, danach zu fragen.
»Verstehst du? Diese Pizzeria, da will Bram schon seit Wochen hin, das hast du doch nicht etwa vergessen?«
»’türlich nicht, ’türlich nicht«, sagt Stern schnell. Er muss die Ruhe bewahren. Wenn seine Familie in diese Pizzeria will, kein Problem, er wird mitgehen. »Übrigens, Bram hat eine Freundin. Das hat er mir ganz von selbst erzählt. Shirley, Shayla, so ähnlich.«
»Weiß ich. Liebling, setz dich doch erst mal hin, nimm noch was zu essen, komm runter. Ich habe gerade mit meinem letzten Kapitel zu tun, aber wollen wir morgen früh nicht irgendwo Kaffee trinken gehen, zwischendurch?« Bei dem letzten Wort hält sie inne, ihr scheint klar zu werden, wie peinlich ihr Vorschlag eigentlich ist. Zwischendurch. Sie kann ihren Ehemann nur noch zwischen ihren Tätigkeiten unterbringen, als Intermezzo. Wie man einen Hund von Zeit zu Zeit rauslassen muss.
»Muss nicht sein. Ich komme schon klar. Morgen früh habe ich sowieso einen Termin bei Dr. Janovitz. Und wenn es dir nichts ausmacht, gehe ich jetzt nach oben.«
Einen Augenblick ist es still. Stern will noch sagen, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, dass er einer ist, der die Ruhe behält, wenn es gerade schlecht läuft. Aber stattdessen schnappt er die vier Albert-Heijn-Beutel und rennt aus dem Zimmer.
*
An seinem Bücherregal ist schon seit Jahren nichts verändert worden. Einige Fotoalben von früher, diverse Schulbücher, eine Reihe Romane, deren Inhalt er längst vergessen hat. Stern packt sie alle in einen Umzugskarton. Den Karton schiebt er unter sein Bett, und mit einem Lappen putzt er die Bretter des Regals.
Danach nimmt er sich die vier Beutel vor, die er mitgeschleppt hat. Er holt nur die Ordner heraus. Vierunddreißig sind es insgesamt, für jedes Schuljahr einer. Große, dunkle Mappen, die er immer zu Hause überarbeitet hat. Aber waren sie erst einmal abgeschlossen, landeten sie in seinem Klassenzimmer. Da standen sie in einer schönen Reihe hinter seinem Schreibtisch. Wenn ihm, was selten geschah, im Gespräch mit seinen Schülern nichts mehr einfiel, nahm er einen Ordner und blätterte genau so lange darin, bis er wieder etwas zu sagen hatte.
Er stellt sie in chronologischer Reihenfolge auf. Jetzt, da er sie nacheinander durch seine Hände gleiten lässt, kann er seinen Stolz nicht unterdrücken. All die Notizen, all die Informationen über Hunderte Kinder, die er auf das Leben vorbereitet hat.
Im vergangenen Schuljahr war eine Kollegin unangekündigt in seinem Klassenzimmer aufgekreuzt. »Ordner?«, hatte sie geradewegs gefragt. »Wer benutzt heutzutage noch Ordner? Ich habe alle meine Unterlagen einfach auf einem USB-Stick. Ein Ordner ist echt was aus einem anderen Zeitalter, haha.« Stern hatte höflich zugehört, nach einem Moment hatte auch er gelacht. Aber seither ging er der Kollegin tunlichst aus dem Weg, er hat nie wieder ein Wort mit ihr gewechselt.
Als er so vor seinem Bücherregal steht, muss er zum ersten Mal seit Langem wieder an sie denken. Sie würde ihren Fehler sicher einsehen, wenn sie hier wäre. Vierunddreißig identische dicke Mappen, zum ersten Mal komplett außerhalb der Schule, und noch immer haben sie nichts von ihrer Aussagekraft verloren. Der Fortschritt, die Schwächen, die Schwerpunkte: Von all seinen Schülern kann Stern die ausschlaggebenden Informationen nachschlagen: 3. April 1994. Johan muss jetzt wirklich mit dem Dividieren anfangen, sonst sehe ich Probleme in der Zukunft. Und: 29. Januar 2005. Barbara entwickelt sich gut, hauptsächlich bei Diktaten macht sie einen starken Eindruck. Von jedem Schüler existieren Seiten voller Notizen, immer angereichert mit sachlichen Informationen wie Passbild und Adresse – Stern musste jeden innerhalb eines Augenaufschlages von den anderen unterscheiden können. So viele Jahre er auch unterrichtete, er durfte niemals die Übersicht verlieren. Wenn er seine Arbeit nicht mit äußerster Genauigkeit tat, konnte er das auch nicht von seinen Schülern erwarten.
Zweimal kontrolliert er, ob die Ordner in richtiger Reihenfolge stehen. Dann zieht er einen aus dem Schrank und vertieft sich in die Unterlagen.
4.
Die Wohnung befand sich mitten in Camden Town. Es war ein gerade eröffneter Betonbau, der wie eine Lagerhalle wirkte. Das Erdgeschoss bestand aus einem lang gestreckten Frühstückssaal, in den zwei Etagen darüber gab es Dutzende kleiner Studentenzimmer. Für mehr als ein Bett und einen Schreibtisch war kaum Platz. Nur ein paar reiche Studenten konnten sich einen Schwarz-Weiß-Fernseher leisten. Die anderen mussten mit Penguin Classics, Postkarten von zu Hause, lebensgroßen Postern von Filmstars und Musikern auskommen.
Als Hugo hier zum ersten Mal hereinkam, gerade achtzehn Jahre alt und mit nicht mehr als einem Rucksack als Gepäck, versuchte er so locker wie möglich zu wirken. Es war die zweite Wohnung, die er besichtigte. Bei der ersten auf der Grenze zwischen Bloomsbury und Holborn hatte man ihm höflich, aber entschieden die Tür gewiesen, weil er, wie der Hausmeister meinte, »erkennbar kein Student« war. In Camden, eine Gegend, in die er mehr oder weniger zufällig geraten war, sah man seiner Ankunft wohlwollender entgegen. Der Empfangschef inspizierte seinen Pass, forderte eine Kaution von zwanzig Pfund und händigte ihm den Schlüssel aus. »Eigentlich ist dieses Zimmer nur für Leute, die an der Universität eingeschrieben sind, aber ich will diesmal eine Ausnahme machen. Meinetwegen kannst du bis zu den Sommerferien bleiben. Das Collegejahr läuft ja doch schon seit Monaten, und wir haben noch genügend Zimmer frei. Also, willkommen in der neuen Wohnung, son.«
Hugos erste Tage in London waren fantastisch. Mit großen, neugierigen Schritten erkundete er die Stadt. Anfangs nur die Straßen von Camden, danach wagte er sich auch in andere Viertel. Manchmal nahm er die Underground, fuhr zu irgendeiner Station und blieb den ganzen Nachmittag in der Gegend. Alles war hier so unendlich viel größer als in St. Michielsgestel, so viel mehr Menschen, so viel mehr Häuser und Geräusche – allein schon das permanente Sirenengeheul im Hintergrund.
Stundenlang lief er durch Straßen und Parks, die er allenfalls von Ansichtskarten, Monopoly oder Tausend-Teile-Puzzlen kannte. Einen Stadtplan benutzte er nicht. Niemand sollte sehen, dass er aus dem Ausland kam. Er musste Teil der Stadt werden, ein echter Londoner, den Touristen nach dem Weg fragten und von dem die Passanten dachten: Der ist hier zu Hause.
Nur im Frühstückssaal zwischen allen anderen Mitbewohnern hielt er sich noch zurück. Am ersten Morgen hatte er verschlafen – es verwirrte ihn, dass hier die Zeit eine Stunde hinterherlief –, und auch an den Tagen danach hoffte er vergebens, dass sich jemand neben ihn setzte. Am fünften Morgen beschloss er, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Er wollte seine Eindrücke nun auch mit anderen teilen, Freundschaften gehörten natürlich zum Leben in einer Weltstadt. Ohne zu zögern, betrat er den Frühstücksraum, wo er sich einen Teller auftat und nicht wie sonst zu den freien Plätzen nach hinten ging, sondern zu den dicht besetzten Tischen am Eingang.
Niemand beachtete ihn. Seine Mitbewohner sahen an ihm vorbei, ihre Mienen zwischen müde und unbeteiligt, und während sie ihre Bohnen mit Speck in sich hineinschaufelten, führten sie lebhafte Gespräche, redeten alle gleichzeitig, sodass Hugo nichts verstand.
Er ging zum zweiten Tisch, zum dritten, zum vierten. Dann endlich entdeckte er einen freien Platz zwischen einer Betonmauer und einem rothaarigen Jungen. »Good morning. Darf ich mich zu dir setzen?«
Seit er hier war, hatte er an seinem Englischakzent gearbeitet. Er wollte die Wörter so britisch wie möglich aussprechen, ohne Spur seines brabantischen Zungenschlags.
»Setz dich hin, wo du willst«, sagte der Rothaarige. Er war in Hugos Alter, vielleicht etwas älter.
Vor dem Jungen stand ein Teller mit einem halben Würstchen und den Resten eines Rühreis.
»Ich bin Hugo Stern. Ich komme aus den Niederlanden.« Nach einer Pause setzte er hinzu: »Und du?«
»Frankreich«, sagte der Junge.
Um sie herum herrschte Stimmengewirr, Gabeln und Messer, die über Teller kratzten.
»Studierst du?«
»Natürlich«, sagte der Junge gleichmütig. »Jeder studiert hier.«
»Ich nicht.« Hugo strahlte. »Das kommt erst später.«
Sie schwiegen.
Dann schaute der Junge Hugo ernst an. »Du bist bestimmt neu hier.«
Für einen Moment war Hugo verwirrt. Augenscheinlich war ihm anzusehen, dass er ein Frischling war, offenkundig unterschied ihn noch etwas sehr deutlich von den anderen. Aber er ließ sich nichts anmerken. »Neu, neu, was ist neu? Das tut doch nichts zur Sache. Ich wohne jetzt in London.«
Mit dem letzten Satz klang er plötzlich zufrieden, als wolle er damit das Vorhergehende erklären, seine ganze bisherige Existenz: Alles war nur ein Anlauf gewesen für seinen Aufenthalt in London.
Der Junge schien es nicht zu hören und nahm unbeirrt den letzten Happen von seinem Rührei. Hugo griff nun auch nach seinem Besteck, wurde aber abgelenkt, weil an den anderen Tischen Leute aufbrachen. Sie stapelten ihre leeren Teller übereinander und schlenderten nach draußen. Die Frühstückszeit ging zu Ende, noch ehe Hugo etwas gegessen hatte, noch bevor er jemandem von seinen Entdeckungstouren erzählt hatte. »Swinging London, kennst du den Ausdruck?«, fragte er. »Das ist, wo wir jetzt sind.«
»Nie gehört.« Der Junge kaute ohne Unterbrechung. Die übrig gebliebene Wursthälfte machte ein knackendes Geräusch zwischen seinen Zähnen.
»Schade«, sagte Hugo. »Hast du eigentlich schon viel von der Stadt gesehen? Klingt vielleicht komisch, aber wenn du nach dem Frühstück nichts weiter vorhast, könnten wir losziehen, durch das Viertel und …«
»Ich muss an meiner Abschlussarbeit weitermachen. Sonst schaffe ich meinen BSC nicht.«
Hugo fragte nicht, was BSC bedeutete. Langsam verzehrte er sein Frühstück. Bohnen, Speck, Grilltomaten, alles Sachen, die er zu Hause selten gegessen hatte. Seine Verdauung hatte noch Schwierigkeiten damit, aber die Gerichte selbst waren beeindruckend.
Beim Essen räusperte er sich hin und wieder, wie ein Pfarrer zu Beginn der Messe. Als er dann endlich allen Mut zusammengenommen hatte, den rothaarigen Jungen zu einem Morgenspaziergang einzuladen, fing der Student von selbst an: »Kommst du heute Abend mit ins Marquee? Da spielt eine klasse neue Band.«
Ein Prickeln ging durch Hugos Bauch. »Ja«, wollte er antworten, er hätte es durch den ganzen Frühstückssaal rufen mögen. Dann sah er, dass der Junge sich jemand anderem zugewendet hatte. Einem Mädchen. Nach ihrem Aussehen zu urteilen, eine aus dem Süden. Sie sah den rothaarigen Jungen wohlwollend an. Ihre Mundwinkel bewegten sich nach oben, ihre Augen schossen schalkhaft hin und her. Hugo allerdings würdigte sie keines Blickes. Nicht einmal, als er seinen Stuhl zurückschob und aufstand.
»Vielleicht sehe ich dich morgen«, war das Einzige, was er sagte. Sie schienen es nicht zu hören.
Einen Moment blieb er direkt neben dem Tisch stehen. Obwohl er keine Ahnung hatte, worauf er eigentlich wartete. Er drehte sich langsam um. Als er den Frühstückssaal verließ, wurde ihm klar, dass diese Leute schon seit Monaten jeden Morgen hier saßen. Da waren längst Freundschaften entstanden, Bündnisse geschlossen, Beziehungen eingefädelt worden. Jeder hier würde sich exakt genauso verhalten, wenn Hugo vergangene Woche einfach zu Hause geblieben wäre und seine Mutter nicht allein gelassen hätte.
Mit niedergeschlagenem Blick ging er nach draußen. Auf der Treppe vor dem Studentenwohnheim standen zwei Mädchen und rauchten. Sie sagten nichts zu Hugo, und Hugo sagte deshalb auch nichts zu ihnen.
London gefiel ihm an diesem Nachmittag weniger als davor. Alles war dasselbe, das scheinbare Wirrwarr an Straßen, die imposanten Gebäude, der chaotische Verkehr, aber bei jedem Schritt wurde Hugo nun auf einmal klarer, dass er ganz allein war. Dass niemand einen Unterschied merkte, wenn er den ganzen Tag im Bett bleiben oder zurück nach St. Michielsgestel fahren würde. Und je länger er unterwegs war, desto klarer wurde es ihm: Er musste auf sich aufmerksam machen.