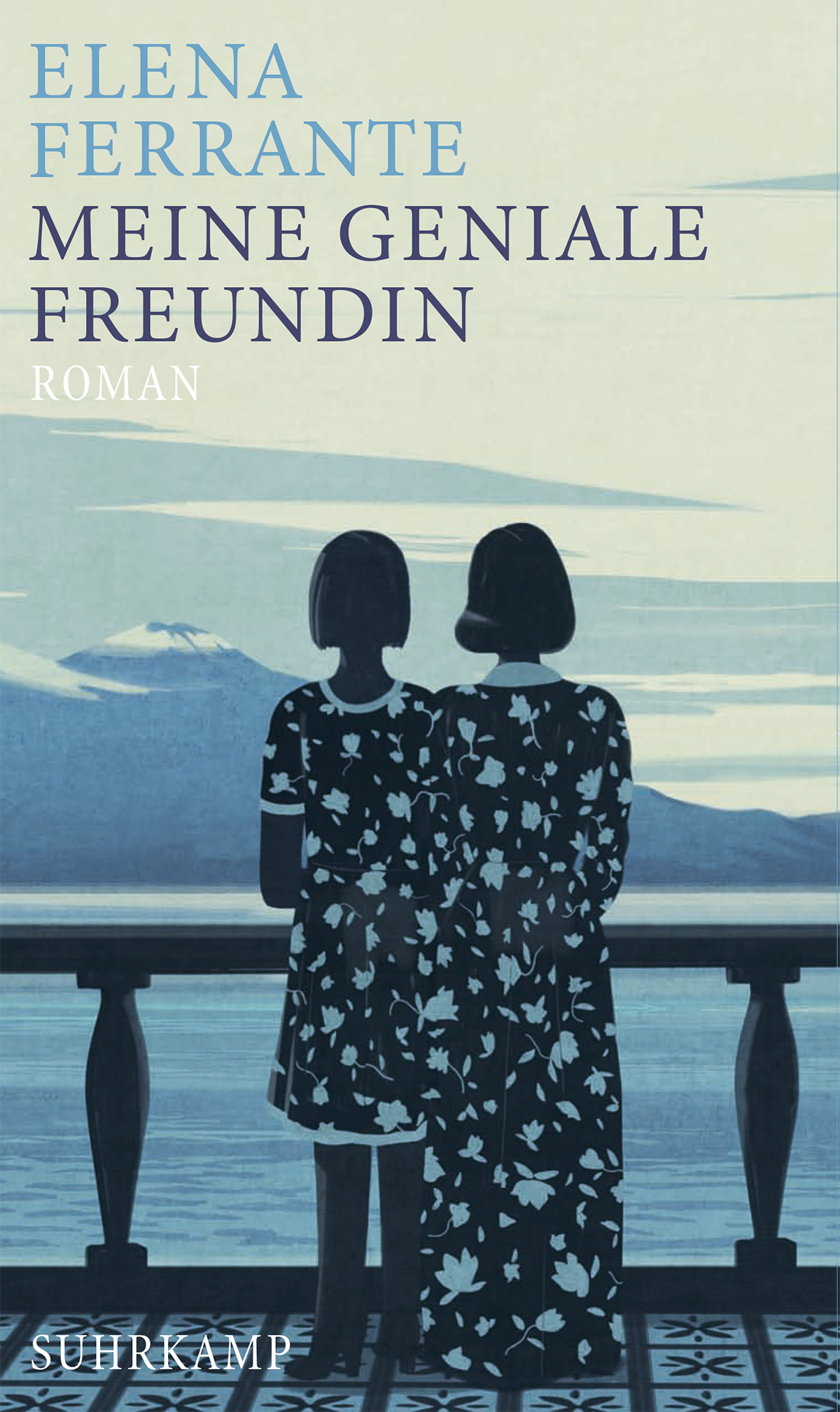
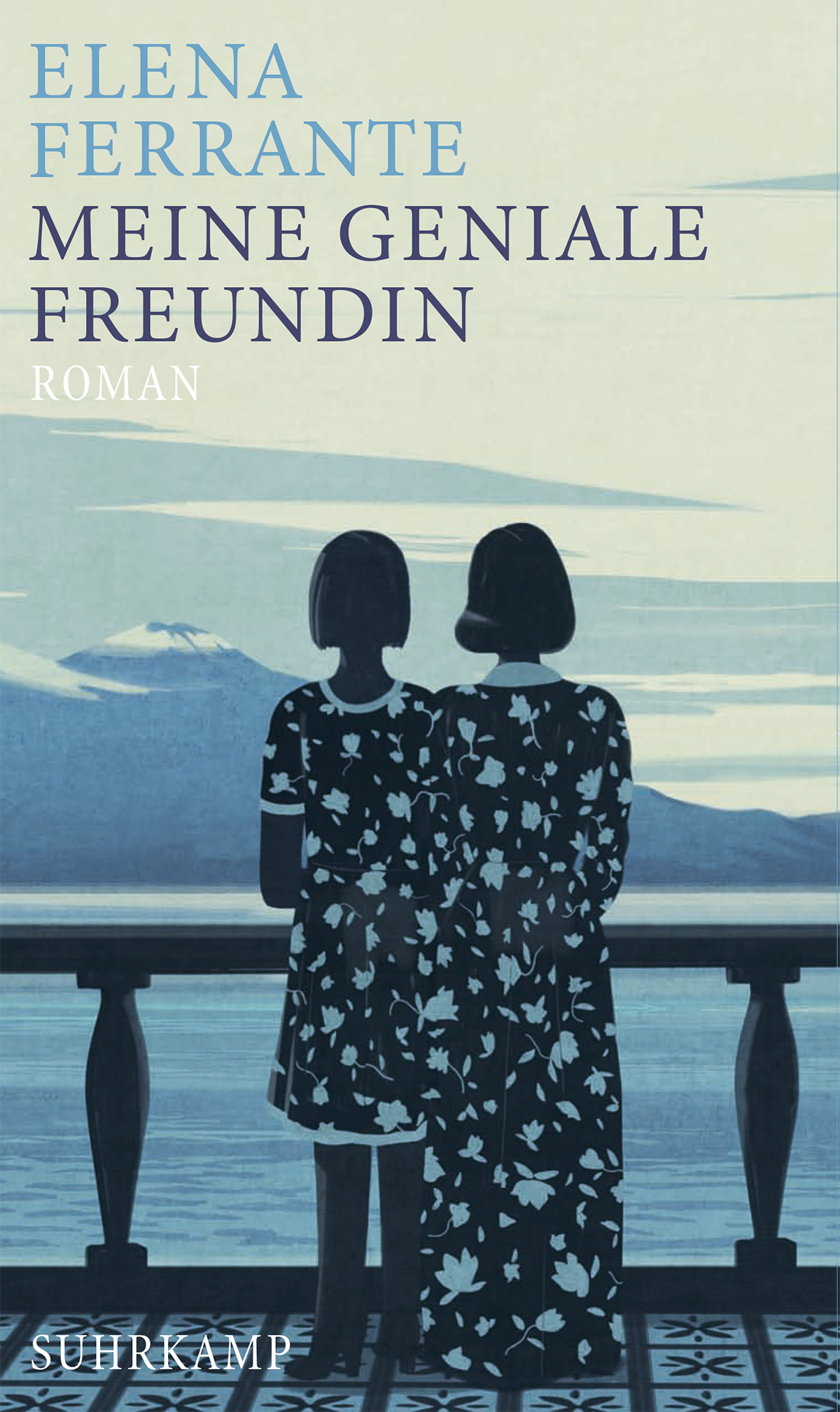
In einem volkstümlichen Viertel Neapels wachsen sie auf, derbes Fluchen auf den Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei aus. Hier gehen sie gemeinsam in die Schule, die unangepasste, draufgängerische Lila und die schüchterne, beflissene Elena, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die andere. Bis Lilas Vater sein brillantes Kind zwingt, in der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohrenden Verdacht zurückbleibt, das Leben zu leben, das eigentlich ihrer besten, ihrer so unberechenbaren Freundin zugestanden hätte.
Elena Ferrante ist die große Unbekannte der Gegenwartsliteratur. In Neapel geboren, hat sie sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans im Jahr 1992 für die Anonymität entschieden. Meine geniale Freundin ist ein weltweiter Bestseller und der erste Band der gleichnamigen Neapolitanischen Saga. Die übrigen drei Bände – Die Geschichte eines neuen Namens, Die Geschichte der getrennten Wege und Die Geschichte des verlorenen Kindes – werden in rascher Folge im Suhrkamp Verlag veröffentlicht werden.
Karin Krieger übersetzt vorwiegend aus dem Italienischen und Französischen, darunter Bücher von Claudio Magris, Anna Banti, Armando Massarenti, Margaret Mazzantini, Ugo Riccarelli, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco und Giorgio Fontana. Sie war mehrfach Stipendiatin des Deutschen Übersetzerfonds und erhielt 2011 den Hieronymusring.
Elena Ferrante
Meine geniale Freundin
Kindheit, frühe Jugend
Roman
Aus dem Italienischen
von Karin Krieger
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel L'amica geniale
bei Edizioni e/o, Rom.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© 2011 by Edizioni e/o
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagillustration: © Emiliano Ponzi/2agenten
Umschlaggestaltung: Schimmelpenninck.Gestaltung, Berlin
eISBN 978-3-518-74797-1
www.suhrkamp.de
Die Personen und die Handlung des vorliegenden Werkes sowie die darin vorkommenden Namen und Dialoge sind sämtlich erfunden und Ausdruck der künstlerischen Freiheit der Autorin. Jede Ähnlichkeit mit realen Begebenheiten, Personen, Namen und Orten wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
der herr. Du darfst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.
Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen. –
J. W. Goethe, Faust
Familie Cerullo
(die Familie des Schuhmachers)
Fernando Cerullo, Schuster
Nunzia Cerullo, seine Frau
Ihre Kinder:
Raffaella Cerullo, von allen Lina gerufen, nur Elena
nennt sie Lila
Rino Cerullo, Lilas großer Bruder, ebenfalls Schuster
(Rino wird später auch eines von Lilas Kindern heißen.)
Weitere Kinder
Familie Greco
(die Familie des Pförtners)
Elena Greco, Lenuccia oder Lenù genannt
Sie ist das älteste von vier Kindern, nach ihr kommen
Peppe, Gianni und Elisa.
Ihr Vater ist Pförtner in der Stadtverwaltung.
Ihre Mutter ist Hausfrau.
Familie Carracci
(die Familie von Don Achille)
Don Achille Carracci, der Unhold aus den Märchen
Maria Carracci, seine Frau
Ihre Kinder:
Stefano Carracci, Lebensmittelhändler in der Salumeria
der Familie
Pinuccia Carracci
Alfonso Carracci
Familie Peluso
(die Familie des Tischlers)
Alfredo Peluso, Tischler
Giuseppina Peluso, seine Frau
Ihre Kinder:
Pasquale Peluso, der älteste Sohn, Maurer
Carmela Peluso, die sich auch Carmen nennt, Kurzwarenverkäuferin
Weitere Kinder
Familie Cappuccio
(die Familie der verrückten Witwe)
Melina Cappuccio, die verrückte Witwe, mit Lilas Mutter
verwandt
Melinas Mann, schleppte Kisten auf dem Obst- und
Gemüsemarkt.
Ihre Kinder:
Ada Cappuccio
Antonio Cappuccio, Automechaniker
Weitere Kinder
Familie Sarratore
(die Familie des dichtenden Eisenbahners)
Donato Sarratore, Zugschaffner
Lidia Sarratore, seine Frau
Ihre Kinder:
Nino Sarratore, der Älteste
Marisa Sarratore
Pino Sarratore
Clelia Sarratore
Ciro Sarratore
Familie Scanno
(die Familie des Gemüsehändlers)
Nicola Scanno, Gemüsehändler
Assunta Scanno, seine Frau
Ihre Kinder:
Enzo Scanno, ebenfalls Gemüsehändler
Weitere Kinder
Familie Solara
(die Familie des Besitzers der gleichnamigen
Bar-Pasticceria)
Silvio Solara, Padrone der Solara-Bar
Manuela Solara, seine Frau
Ihre Kinder:
Marcello Solara
Michele Solara
Familie Spagnuolo
(die Familie des Konditors)
Signor Spagnuolo, Konditor in der Solara-Bar
Rosa Spagnuolo, seine Frau
Ihre Kinder:
Gigliola Spagnuolo
Weitere Kinder
Gino, der Sohn des Apothekers
Die Lehrer
Maestro Ferraro, Grundschullehrer und Bibliothekar
Maestra Oliviero, Grundschullehrerin
Professor Gerace, Gymnasiallehrer in der Unterstufe
Professoressa Galiani, Gymnasiallehrerin in
der Oberstufe
Nella Incardo, Maestra Olivieros Cousine,
wohnt auf Ischia
Die Spuren verwischen
Heute Morgen hat mich Rino angerufen, ich dachte, er wollte wieder einmal Geld, und wappnete mich, es ihm zu verweigern. Doch der Grund seines Anrufs war ein anderer. Seine Mutter war unauffindbar.
»Seit wann?«
»Seit zwei Wochen.«
»Und da rufst du mich erst jetzt an?«
Mein Tonfall muss ihm feindselig vorgekommen sein, obwohl ich weder verärgert noch aufgebracht war, es lag nur eine Spur von Sarkasmus in meiner Stimme. Er, versuchte dagegenzuhalten, tat es jedoch unbeholfen, verlegen, halb im Dialekt, halb auf Italienisch. Er sagte, er sei fest davon überzeugt, dass seine Mutter irgendwo in Neapel herumstreife, wie immer.
»Auch nachts?«
»Du weißt doch, wie sie ist.«
»Ich weiß es, aber findest du zwei Wochen ohne ein Lebenszeichen normal?«
»Ja. Du hast sie lange nicht gesehen, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie schläft überhaupt nicht mehr, kommt, geht, macht, was sie will.«
Immerhin war er am Ende doch besorgt. Er hatte überall herumgefragt, hatte die Runde durch die Krankenhäuser gemacht und sich sogar an die Polizei gewandt. Nichts, seine Mutter war nirgends zu finden. Was für ein reizender Sohn: ein dicker Kerl um die vierzig, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, immer nur krumme Geschäfte und ein Leben auf großem Fuß. Ich konnte mir denken, mit welcher Gründlichkeit er seine Nachforschungen angestellt hatte. Mit keiner. Er hatte nichts im Kopf, und am Herzen lag ihm nur er selbst.
»Sie ist nicht zufällig bei dir?«, fragte er mich unvermittelt.
Seine Mutter? Hier in Turin? Er wusste genau, wie die Dinge lagen, und redete nur, um irgendwas zu sagen. Er, ja, er war viel unterwegs, mindestens ein Dutzend Mal ist er schon uneingeladen bei mir aufgetaucht. Aber seine Mutter, die ich gern willkommen geheißen hätte, war zeit ihres Lebens nicht aus Neapel herausgekommen. Ich antwortete:
»Nein, zufällig nicht.«
»Bist du sicher?«
»Rino, also bitte: Ich habe gesagt, sie ist nicht hier.«
»Und wo ist sie dann?«
Er brach in Tränen aus, und ich ließ ihm seinen Auftritt, verzweifelte Schluchzer, die unecht begannen und echt weitergingen. Als er fertig war, sagte ich:
»Benimm dich bitte endlich mal, wie sie es gern hätte: Lass sie in Ruhe.«
»Was redest du denn da?«
»Ich meine es ernst. Es hat keinen Zweck. Lerne, auf eigenen Füßen zu stehen, und lass auch mich in Ruhe.«
Ich legte auf.
Rinos Mutter heißt Raffaella Cerullo, wurde aber von allen schon immer Lina gerufen. Von mir nicht, ich habe sie nie so genannt. Für mich ist sie seit mehr als sechzig Jahren Lila. Wenn ich plötzlich Lina oder Raffaella zu ihr sagte, würde sie denken, mit unserer Freundschaft wäre es vorbei.
Seit mindestens drei Jahrzehnten erzählt sie mir, dass sie spurlos verschwinden möchte, und nur ich weiß, was sie damit meint. Sie hat nie eine Flucht im Sinn gehabt, einen Identitätswechsel, den Traum, anderswo ein neues Leben zu beginnen. Sie hat auch nie an Selbstmord gedacht, ist ihr doch die Vorstellung zuwider, Rino könnte mit ihrem toten Körper zu tun haben und müsste sich um ihn kümmern. Nein, ihr schwebte etwas anderes vor: Sie wollte sich in Luft auflösen, wollte, dass sich jede ihrer Zellen verflüchtigte, nichts von ihr sollte mehr zu finden sein. Und da ich sie gut kenne oder zumindest glaube, sie zu kennen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie einen Weg gefunden hat, nicht einmal ein Haar auf dieser Welt zurückzulassen, nirgendwo.
Die Tage vergingen. Ich sah meine E-Mails durch, auch meine Papierpost, aber ohne viel Hoffnung. Ich hatte ihr oft geschrieben, sie hatte mir fast nie geantwortet. So ist es immer gewesen. Sie zog das Telefon vor oder die langen nächtlichen Gespräche, wenn ich in Neapel war.
Ich öffnete meine Schubladen und die Blechschachteln, in denen ich alles Mögliche aufbewahre. Nur Weniges. Vieles hatte ich weggeworfen, vornehmlich Dinge, die mit ihr zu tun hatten, sie weiß das. Ich stellte fest, dass ich rein gar nichts von ihr habe, nicht ein Bild, nicht einen Zettel, nicht das kleinste Geschenk. Ich wunderte mich über mich selbst. War es möglich, dass sie mir in all den Jahren nichts von sich gegeben hatte oder, schlimmer noch, dass ich nicht das Geringste von ihr hatte aufbewahren wollen? Möglich.
Diesmal rief ich Rino an, allerdings widerstrebend. Er antwortete weder auf dem Festnetz noch auf dem Handy. Erst am Abend rief er zurück, er hatte die Ruhe weg. Er schlug den Ton an, mit dem er gern Schuldgefühle auslöst.
»Du hast angerufen, wie ich sehe. Hast du Neuigkeiten?«
»Nein. Du?«
»Nein.«
Er redete wirres Zeug. Wollte sich ans Fernsehen wenden, an eine »Bitte melde dich«-Sendung, einen Aufruf starten, seine Mutter für alles um Verzeihung bitten, sie anflehen, nach Hause zu kommen.
Ich hörte ihm geduldig zu, dann fragte ich:
»Hast du mal einen Blick in ihren Schrank geworfen?«
»Wozu denn?«
Das Naheliegendste war ihm natürlich nicht eingefallen.
»Sieh nach.«
Er ging zum Schrank und entdeckte, dass nichts darin war, kein einziges Kleid seiner Mutter, weder für den Sommer noch für den Winter, nichts als alte Kleiderbügel. Ich schickte ihn auf eine Suchaktion durch die Wohnung. Ihre Schuhe, weg. Die wenigen Bücher, weg. Sämtliche Fotos, weg. Die Filme, weg. Ihr Rechner, weg, und auch die alten Disketten, die man früher benutzte, einfach alles; alles, was mit ihrer Tüftelei eines Computerfans zu tun hatte, der schon Ende der sechziger Jahre, noch in der Lochstreifen-Ära, mit Rechenmaschinen herumexperimentiert hatte. Rino staunte. Ich sagte:
»Lass dir so viel Zeit, wie du willst, doch dann ruf mich an und sag mir, ob du auch nur eine Stecknadel gefunden hast, die ihr gehört.«
Er meldete sich am nächsten Tag, in höchster Aufregung.
»Da ist nichts!«
»Gar nichts?«
»Nein! Sie hat sich aus allen Fotos herausgeschnitten, auf denen wir gemeinsam waren, auch aus denen meiner Kindheit.«
»Hast du auch wirklich gründlich nachgesehen?«
»Überall.«
»Auch im Keller?«
»Ich sag' doch, überall. Sogar der Karton mit den alten Papieren ist verschwunden, mit, was weiß ich, Geburtsurkunden, Telefonverträgen, Quittungen. Was hat das zu bedeuten? Waren das Einbrecher? Und was haben die gesucht? Was wollen die von mir und meiner Mutter?«
Ich beruhigte ihn, riet ihm, sich nicht aufzuregen. Es sei unwahrscheinlich, dass jemand ausgerechnet von ihm etwas wolle.
»Kann ich eine Weile bei dir wohnen?«
»Ausgeschlossen.«
»Bitte, ich kann nicht schlafen.«
»Du musst allein klarkommen, Rino, ich kann da auch nichts machen.«
Ich legte auf, und als er wieder anrief, reagierte ich nicht. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch.
Lila will wie immer zu weit gehen, dachte ich.
Sie übertrieb die Sache mit den Spuren maßlos. Sie wollte nicht nur verschwinden, jetzt, mit sechsundsechzig Jahren, sondern auch das ganze Leben auslöschen, das hinter ihr lag.
Ich war unglaublich wütend.
Mal sehen, wer diesmal das letzte Wort behält, sagte ich mir. Ich schaltete den Computer ein und begann unsere Geschichte aufzuschreiben, in allen Einzelheiten, mit allem, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Die Geschichte von Don Achille
Als Lila und ich uns entschlossen, die dunkle Treppe nach oben zu steigen, die, Stufe für Stufe, Absatz für Absatz, zu Don Achilles Wohnungstür führte, begann unsere Freundschaft.
Ich erinnere mich noch an das violette Licht im Hof, an die Gerüche dieses lauen Frühlingsabends. Unsere Mütter kochten das Abendessen, es war Zeit, nach Hause zu gehen, doch wir trödelten und stachelten uns zu Mutproben an, ohne dabei auch nur ein Wort zu wechseln. Seit einer Weile taten wir nichts anderes, in der Schule und außerhalb. Lila steckte ihre Hand und den ganzen Arm in den schwarzen Schlund eines Gullylochs, und ich tat es kurz darauf auch, mit Herzklopfen und in der Hoffnung, dass die Kakerlaken nicht auf meiner Haut hochkrabbelten und die Ratten mich nicht bissen. Lila kletterte bei Signora Spagnuolo im Erdgeschoss am Fenster hoch, hängte sich an die Eisenstange für die Wäscheleine, schaukelte und ließ sich auf den Gehsteig fallen, und ich tat es kurz darauf auch, voller Angst, herunterzufallen und mir wehzutun. Lila nahm eine rostige Sicherheitsnadel, die sie irgendwann auf der Straße gefunden hatte und in ihrer Tasche mit sich herumtrug wie das Geschenk einer guten Fee, schob sie sich unter die Haut, und ich sah zu, wie die Metallspitze einen weißlichen Tunnel in ihre Handfläche grub. Als sie die Nadel herauszog und sie mir gab, tat ich es ihr nach.
Eines Tages warf sie mir ihren typischen Blick zu, diesen entschlossenen, mit zusammengekniffenen Augen, und steuerte auf das Haus zu, in dem Don Achille wohnte. Ich war starr vor Schreck. Don Achille war der Unhold aus den Märchen, ich hatte das strikte Verbot, mich ihm zu nähern, mit ihm zu sprechen, ihn anzusehen oder ihm nachzuspionieren, wir sollten so tun, als gäbe es weder ihn noch seine Familie. Bei mir zu Hause, aber nicht nur dort, löste er Angst und Hass aus, ohne dass ich den Grund dafür kannte. Mein Vater sprach in einer Weise von ihm, dass ich ihn mir plump vorstellte, mit rotblauen Pusteln übersät, ein Wüterich trotz des »Don«, das ich sonst immer mit einer ruhigen Autorität verband. Er war ein Wesen aus einem unergründlichen Stoff, Eisen, Glas, Brennnesseln, doch feurig, mit einem glühend heißen Atem, der ihm aus Mund und Nase drang. Ich glaubte, selbst wenn ich ihn nur aus der Ferne sähe, würde mir etwas Scharfes, Brennendes in die Augen fahren. Und wäre ich so verrückt, mich seiner Tür zu nähern, würde er mich töten.
Ich wartete eine Weile, um zu sehen, ob Lila es sich anders überlegte und umkehrte. Ich wusste, was sie vorhatte, vergeblich hatte ich gehofft, sie würde es vergessen, doch nein. Die Straßenlaternen brannten noch nicht und auch das Treppenlicht nicht. Aus den Wohnungen drangen gereizte Stimmen. Um Lila zu folgen, musste ich den bläulichen Schimmer des Hofes verlassen und in das Schwarz des Hauseingangs tauchen. Als ich mich endlich dazu entschloss, sah ich zunächst nichts. Ich spürte nur den Geruch nach altem Plunder und DDT. Dann gewöhnte ich mich an die Dunkelheit und sah Lila auf der ersten Stufe des untersten Treppenabschnitts sitzen. Sie stand auf, und wir begannen mit unserem Aufstieg.
Wir hielten uns an der Wandseite, ich zwei Stufen hinter ihr und unschlüssig, ob ich den Abstand verringern oder vergrößern sollte. Ich erinnere mich noch an das Gefühl an meiner Schulter, als ich die Wand mit dem abblätternden Putz streifte, und an den Eindruck, dass die Stufen sehr hoch waren, höher als die des Hauses, in dem ich wohnte. Ich zitterte. Jedes Geräusch – Schritte oder Stimmen – war Don Achille, der uns einholte oder uns entgegenkam, mit einem großen Messer, so einem, mit dem man Hühnern die Brust aufschlitzt. Es roch nach frittiertem Knoblauch. Maria, Don Achilles Frau, würde mich mit siedendem Öl in der Pfanne braten, seine Kinder würden mich verschlingen, und er würde meinen Kopf auslutschen, wie mein Vater es mit den Meerbarben tat.
Wir blieben oft stehen, und jedes Mal hoffte ich, dass Lila sich zur Umkehr entschloss. Ich war vollkommen durchgeschwitzt, ob sie auch, weiß ich nicht. Manchmal schaute sie nach oben, doch wohin genau, konnte ich nicht erkennen, nur das Grau der großen Fenster auf jedem Absatz war zu sehen. Plötzlich ging das Licht an. Es war funzlig, staubig und ließ weite Bereiche voller Gefahr im Schatten liegen. Wir warteten, um zu ergründen, ob es Don Achille gewesen war, der am Lichtschalter gedreht hatte, doch wir hörten nichts, weder Schritte noch eine Tür, die sich öffnete oder schloss. Lila ging weiter und ich hinterher.
Sie war davon überzeugt, etwas Richtiges und Notwendiges zu tun. Ich hatte jeden guten Grund vergessen und war garantiert nur dort, weil sie dort war. Langsam gingen wir dem größten unserer damaligen Schrecken entgegen. Wir stellten uns der Angst und spürten ihr nach.
Auf der vierten Treppe tat Lila etwas Überraschendes. Sie blieb stehen, wartete auf mich, und als ich zu ihr kam, griff sie nach meiner Hand. Das änderte alles zwischen uns, für immer.
Es war ihre Schuld. Nicht lange zuvor – zehn Tage, ein Monat, wer weiß, wir hatten keine Vorstellung von Zeit damals – hatte sie mir hinterrücks meine Puppe weggenommen und sie in ein Kellerloch geworfen. Nun stiegen wir nach oben, der Angst entgegen. Vorher hatten wir, noch dazu in aller Eile, nach unten steigen müssen, dem Unbekannten entgegen. Ob nach oben oder nach unten, immer war uns, als gingen wir auf etwas Schreckliches zu, das, obwohl es schon vor uns da gewesen war, stets auf uns und nur auf uns wartete. Wenn man noch nicht lange auf der Welt ist, fällt es schwer, zu verstehen, welche Katastrophen dem Gefühl des Unheils zugrunde liegen, und vielleicht hält man dieses Verständnis nicht einmal für nötig. Erwachsene bewegen sich mit Blick auf das Morgen in einer Gegenwart, hinter der das Gestern und das Vorgestern liegt, bestenfalls noch die vergangene Woche. An den Rest wollen sie nicht denken. Kinder kennen die Bedeutung von gestern, vorgestern und auch von morgen nicht. Alles ist hier und jetzt: Hier ist die Straße, hier ist der Hauseingang, hier ist die Treppe, hier ist Mama, hier ist Papa, hier ist der Tag, hier ist die Nacht. Ich war noch klein, und im Grunde wusste meine Puppe mehr als ich. Ich sprach mit ihr, sie sprach mit mir. Sie hatte ein Zelluloidgesicht mit Zelluloidhaaren und Zelluloidaugen. Sie trug ein blaues Kleid, das ihr meine Mutter in einem seltenen Moment des Glücks genäht hatte, und war wunderschön. Lilas Puppe dagegen hatte einen mit Sägespänen ausgestopften, gelblichen Stoffkörper, ich fand sie hässlich und abstoßend. Die beiden schauten sich neugierig an, taxierten sich und waren drauf und dran, in unsere Arme zu flüchten, sobald ein Gewitter losbrach, sobald es donnerte, sobald irgendwas, das größer und stärker war, mit spitzen Zähnen nach ihnen schnappte.
Wir spielten im Hof, doch so, als spielten wir nicht zusammen. Lila saß auf dem Boden, auf der einen Seite eines kleinen Kellerfensters, und ich auf der anderen. Dieser Platz gefiel uns, vor allem deshalb, weil wir sowohl die Sachen meiner Puppe Tina als auch die von Lilas Puppe Nu auf den Beton zwischen die Gitterstäbe des Fensters legen konnten, hinter dem sich ein Metallrost befand. Wir drapierten dort Steine, Kronkorken von Limonadenflaschen, Blümchen, Nägel und Glasscherben. Was Lila zu Nu sagte, griff ich auf und sagte es in leicht abgewandelter Form leise zu Tina. Wenn sie einen Kronkorken nahm und ihn ihrer Puppe als Hut auf den Kopf setzte, sagte ich im Dialekt zu meiner Puppe: »Tina, setz deine Königskrone auf, sonst erkältest du dich noch.« Wenn Nu auf Lilas Arm »Himmel und Hölle« spielte, ließ ich Tina kurz darauf das Gleiche tun. Aber noch war es nicht so weit, dass wir uns absprachen und zusammen spielten. Sogar diesen Platz suchten wir ohne Verabredung aus. Lila steuerte darauf zu, und ich schlenderte herum, als hätte ich ein anderes Ziel. Dann, wie zufällig, ließ auch ich mich an der Lüftungsöffnung nieder, doch auf der anderen Seite.
Am meisten gefiel uns der kalte Hauch aus dem Keller, ein Luftzug, der uns im Frühling und im Sommer Abkühlung brachte. Außerdem mochten wir die Gitter mit den Spinnweben, die Dunkelheit und das engmaschige, rötlich verrostete Metallnetz, das sich sowohl auf meiner als auch auf Lilas Seite aufbog und zwei parallele Spalte aufwies, durch die wir Steine in die Finsternis fallen lassen konnten, um dann auf das Geräusch ihres Aufpralls zu horchen. Damals war alles schön und beängstigend zugleich. Durch diese Öffnungen konnte uns die Finsternis unversehens unsere Puppen wegnehmen, die manchmal sicher in unseren Armen lagen, doch viel öfter absichtlich neben den verbogenen Metallrost gelegt und so dem kalten Hauch des Kellers ausgesetzt wurden und den bedrohlichen Geräuschen, die von dort heraufdrangen, dem Rascheln, Knistern und Kratzen.
Nu und Tina waren nicht glücklich. Die Schrecken, die wir Tag für Tag erlebten, waren auch ihre. Wir trauten dem Licht auf den Steinen nicht und auch nicht dem auf den Häusern, auf dem Umland und auf den Menschen draußen und in den Wohnungen. Wir ahnten die dunklen Winkel, die unterdrückten Gefühle, die immer kurz vor dem Ausbruch standen. Und diesen schwarzen Löchern, diesen Abgründen, die sich dahinter unter den Wohnblocks unseres Viertels auftaten, schrieben wir alles zu, was uns am helllichten Tag erschreckte. Don Achille, zum Beispiel, befand sich nicht nur in seiner Wohnung im obersten Stockwerk, sondern auch darunter, er war eine Spinne unter Spinnen, eine Ratte unter Ratten, eine Gestalt, die jede Gestalt annahm. Ich stellte mir vor, dass sein Mund wegen seiner langen Hauer offen stand, dass er einen glasierten Steinkörper hatte, auf dem Giftpflanzen wuchsen, und dass er ständig darauf lauerte, alles, was wir durch die kaputten Ränder des Metallrosts fallen ließen, mit einer riesigen schwarzen Markttasche aufzufangen. Diese Tasche war Don Achilles Markenzeichen, er trug sie ständig bei sich, auch zu Hause, und verstaute lebende und tote Sachen darin.
Lila wusste um meine Angst, meine Puppe sprach laut davon. Deshalb schob sie Tina, kaum dass sie sie bekommen hatte, gerade an dem Tag, als wir ohne ein einziges Wort, nur mit Blicken und Gesten, zum ersten Mal unsere Puppen getauscht hatten, durch den Spalt im Metallrost und warf sie in die Finsternis.
Lila trat in der ersten Grundschulklasse in mein Leben und beeindruckte mich sofort, weil sie ausgesprochen frech war. Wir Mädchen in dieser Klasse waren alle ein bisschen frech, doch nur, wenn Maestra Oliviero es nicht sah. Sie dagegen war immer frech. Einmal riss sie Löschpapier in kleine Stücke, tauchte sie eines nach dem anderen ins Tintenfass in der Bank, fischte sie mit dem Federhalter wieder heraus und bewarf uns damit. Sie traf zweimal meine Haare und einmal meinen weißen Kragen. Die Lehrerin gellte, wie nur sie es konnte, mit einer uns erschreckenden Nadelstimme, lang und spitz, und befahl Lila, sich zur Strafe sofort hinter die Tafel zu stellen. Lila gehorchte nicht, sie war nicht einmal eingeschüchtert und warf stattdessen weiter mit den tintengetränkten Papierkügelchen. Maestra Oliviero, eine schwerfällige Frau, die uns uralt vorkam, obwohl sie kaum über vierzig gewesen sein dürfte, kam drohend von ihrem Pult herunter, stolperte, verlor das Gleichgewicht und schlug mit dem Gesicht gegen die Kante einer Bank. Wie leblos blieb sie auf dem Boden liegen.
Was dann geschah, weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nur noch an den reglosen Körper der Maestra, ein dunkles Bündel, und an Lila, die sie mit ernster Miene betrachtete.
Ich habe zahllose Unfälle dieser Art in Erinnerung. Wir lebten in einer Welt, in der Kinder und Erwachsene sich häufig verletzten; die Wunden bluteten, eiterten, und manchmal starb jemand daran. Eine Tochter von Signora Assunta, der Gemüsehändlerin, hatte sich an einem Nagel verletzt und war an Tetanus gestorben. Signora Spagnuolos jüngster Sohn war an Krupp gestorben. Ein Cousin von mir, zwanzig Jahre alt, ging eines Morgens Trümmer wegräumen und war am Abend tot, zerquetscht, das Blut lief ihm aus Mund und Ohren. Der Vater meiner Mutter starb, als er beim Bau eines Hochhauses in die Tiefe stürzte. Signor Pelusos Vater fehlte ein Arm, er war versehentlich in eine Drehbank geraten. Die Schwester von Signor Pelusos Frau Giuseppina war mit zweiundzwanzig Jahren an Tuberkulose gestorben. Don Achilles ältester Sohn – ich hatte ihn nie gesehen, glaubte aber trotzdem, mich an ihn zu erinnern – war in den Krieg gezogen und zweimal gestorben, zunächst im Pazifik ertrunken, dann von den Haien gefressen. Alle Mitglieder der Familie Melchiorre starben aneinandergeklammert und vor Entsetzen schreiend bei einem Luftangriff. Die alte Signorina Clorinda starb, als sie Gas statt Luft einatmete. Giannino, der in die vierte Klasse ging, als wir in der ersten waren, starb, weil er eine Bombe gefunden und sie angefasst hatte. Luigina, mit der wir auf dem Hof gespielt hatten oder vielleicht auch nicht, vielleicht war sie nur ein Name, Luigina war an Flecktyphus gestorben. So war unsere Welt, voller Wörter, die töteten: Krupp, Tetanus, Flecktyphus, Gas, Krieg, Drehbank, Trümmer, Arbeit, Luftangriff, Bombe, Tuberkulose, Vereiterung. Mit diesen Wörtern und diesen Jahren rufe ich die vielen Ängste wieder wach, die mich mein Leben lang begleitet haben.
Man konnte auch an scheinbar normalen Dingen sterben. Man konnte, zum Beispiel, sterben, wenn man schwitzte und dann kaltes Leitungswasser trank, ohne dass man sich zuvor auch Wasser über die Handgelenke hatte laufen lassen. Dann konnte es passieren, dass man mit roten Pünktchen übersät war, Husten bekam und nicht mehr atmen konnte. Man konnte sterben, wenn man Schwarzkirschen aß, ohne den Kern auszuspucken. Man konnte sterben, wenn man Kaugummi kaute und ihn versehentlich verschluckte. Vor allem konnte man sterben, wenn man einen Schlag gegen die Schläfe bekam. Die Schläfe war eine hochempfindliche Stelle, wir gaben alle sehr auf sie acht. Es genügte schon ein Steinwurf, und Steinwürfe waren an der Tagesordnung. Nach der Schule warf eine Bande von Jungen aus dem Umland, angeführt von einem, der Enzo oder Enzuccio genannt wurde und der Sohn der Gemüsehändlerin Assunta war, mit Steinen nach uns. Sie waren sauer, weil wir Mädchen besser in der Schule waren als sie. Als die Steine flogen, liefen wir alle weg, nur Lila nicht, sie ging mit ruhigen Schritten weiter und blieb manchmal sogar stehen. Sie konnte die Flugbahn der Steine genau abschätzen und wich ihnen gelassen – heute möchte ich sagen: elegant – aus. Sie hatte einen großen Bruder, und vielleicht hatte sie das ja von ihm gelernt, keine Ahnung. Auch ich hatte Geschwister, allerdings jüngere, und von denen hatte ich rein gar nichts gelernt. Jedenfalls blieb ich trotz meiner großen Angst stehen, als ich sah, dass sie zurückgeblieben war, und wartete auf sie.
Schon damals war da etwas, das mich davon abhielt, sie im Stich zu lassen. Ich kannte sie nicht gut, wir hatten nie ein Wort miteinander gewechselt, obwohl wir ständig im Wettstreit miteinander standen, in der Schule und außerhalb. Doch ich hatte das dunkle Gefühl, dass ich ihr etwas von mir überlassen hätte, was sie mir nie zurückgegeben hätte, wenn ich mit den anderen weggelaufen wäre.
Zunächst versteckte ich mich hinter einer Ecke und beugte mich vor, um nach Lila Ausschau zu halten. Als ich sah, dass sie sich nicht von der Stelle rührte, überwand ich mich und ging zu ihr, versorgte sie mit Steinen und warf selbst auch welche. Doch ohne Überzeugung. Ich habe in meinem Leben vieles getan, doch nie mit Überzeugung, stets fühlte ich mich etwas losgelöst von meinen Handlungen. Lila dagegen zeichnete sich schon von klein auf durch eine absolute Entschlossenheit aus – heute kann ich nicht mehr sagen, ob bereits mit sechs, sieben Jahren oder erst seit wir im Alter von acht, fast neun Jahren zusammen die Treppe zu Don Achilles Wohnung hinaufgestiegen waren. Egal ob sie nach dem Federhalter in den Farben der Tricolore griff oder nach einem Stein oder nach dem Handlauf der dunklen Treppe, immer vermittelte sie den Eindruck, dass sie das, was darauf folgte – die Feder mit gezieltem Schwung ins Holz der Schulbank rammen, tintengetränkte Kügelchen durch die Gegend schießen, die Jungen aus dem Umland angreifen, zu Don Achilles Tür hinaufgehen –, ohne mit der Wimper zu zucken, tun würde.
Die Bande kam vom Eisenbahndamm, sie deckte sich zwischen den Gleisen mit Steinen ein. Enzo, der Anführer, war ein gefährlicher Junge, mindestens drei Jahre älter als wir, ein Sitzenbleiber, mit extrem kurzen, blonden Haaren und hellen Augen. Treffsicher warf er mit kleinen, scharfkantigen Steinen, und Lila wartete seine Würfe ab, um ihm zu zeigen, wie sie ihnen auswich, um ihn noch weiter zu reizen und um sofort mit nicht minder gefährlichen Angriffen zu antworten. Einmal trafen wir ihn am rechten Fußknöchel, und ich sage »wir«, weil ich es war, die Lila den flachen, an den Rändern abgesplitterten Stein gegeben hatte. Er schnitt in Enzos Haut wie ein Rasiermesser und hinterließ eine rote Stelle, die sofort zu bluten begann. Der Junge starrte auf sein verletztes Bein, ich sehe ihn noch vor mir: Er hielt den Stein, den er gerade hatte werfen wollen, zwischen Daumen und Zeigefinger, er hatte schon weit ausgeholt, hielt jedoch verblüfft inne. Auch die Jungen unter seinem Kommando starrten ungläubig auf das Blut. Lila zeigte nicht die geringste Genugtuung über diesen Treffer, sie bückte sich nur nach einem weiteren Stein. Ich packte sie am Arm, es war unsere erste Berührung, schroff und ängstlich. Ich ahnte, dass die Bande noch brutaler reagieren würde, und wollte, dass wir uns zurückzogen. Doch dafür blieb keine Zeit mehr. Enzo fasste sich wieder und warf ungeachtet seines blutenden Knöchels den Stein, den er in der Hand hatte. Ich hielt Lila noch immer fest, als der Stein sie an der Stirn traf und sie von mir riss. Einen Augenblick später lag sie mit einem Loch im Kopf auf dem Gehweg.
Blut. Meistens floss es erst, nachdem fürchterliche Flüche und dreckige Unflätigkeiten ausgetauscht worden waren. Es folgte immer diesem Muster. Mein Vater, den ich trotzdem für einen anständigen Mann hielt, stieß in einem fort Beschimpfungen und Drohungen aus, wenn jemand, wie er meinte, es nicht wert war, auf dieser Welt zu sein. Besonders auf Don Achille hatte er es abgesehen. Ständig hatte er ihm etwas vorzuwerfen, und manchmal hielt ich mir die Ohren zu, damit mich seine Flüche nicht zu sehr niederdrückten. Wenn er mit meiner Mutter über ihn sprach, nannte er ihn »dein Cousin«, aber meine Mutter verwahrte sich sofort gegen diese Blutsbande (sie war nur sehr entfernt mit ihm verwandt) und steigerte das Maß der Beschimpfungen noch. Die Wutausbrüche der beiden erschreckten mich, und vor allem erschreckte mich der Gedanke, Don Achille könnte so feine Ohren haben, dass er auch die in großer Entfernung ausgestoßenen Beleidigungen hörte. Ich fürchtete, er würde kommen und meine Eltern umbringen.
Don Achilles erklärter Feind war aber nicht mein Vater, sondern Signor Peluso, ein ausgezeichneter Tischler, der nie Geld hatte, weil er alles, was er verdiente, im Hinterzimmer der Solara-Bar verspielte. Peluso war der Vater unserer Klassenkameradin Carmela, ihres großen Bruders Pasquale und von zwei weiteren, kleinen Kindern, die ärmer waren als wir und mit denen Lila und ich manchmal spielten, die aber in der Schule und draußen ständig versuchten, unsere Sachen mitgehen zu lassen, einen Federhalter, einen Radiergummi, ein Stückchen Quittenkuchen, so dass sie von den Prügeln, die sie von uns bezogen, mit blauen Flecken übersät nach Hause gingen.
Immer wenn wir Signor Peluso sahen, erschien er uns wie der Inbegriff der Verzweiflung. Einerseits verspielte er alles, andererseits ohrfeigte er sich vor aller Augen, weil er nicht mehr wusste, wie er seine Familie ernähren sollte. Aus undurchsichtigen Gründen gab er Don Achille die Schuld an seinem Ruin. Er beschuldigte ihn, hinterhältig das gesamte Tischlerwerkzeug an sich gezogen zu haben, als wäre sein düsterer Körper ein Magnet, und so die Werkstatt kaputtgemacht zu haben. Er warf ihm vor, sich auch diese unter den Nagel gerissen und sie zu einer Salumeria umfunktioniert zu haben, wo er Wurst und andere Lebensmittel verkaufte. Jahrelang stellte ich mir vor, wie die Kombizange, die Säge, die Kneifzange, der Hammer, der Schraubstock und tausend und abertausend Nägel in Form eines metallischen Schwarms von Don Achilles Körper aufgesogen wurden. Jahrelang sah ich vor mir, wie sein aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzter, vierschrötiger, schwerer Körper ebenfalls schwarmartig Salami, Provolone, Mortadella, Schweineschmalz und Schinken absonderte.
Geschichten aus dunklen Zeiten. Don Achille musste sich früher, bevor wir geboren waren, in seinem ganzen abscheulichen Wesen offenbart haben. Früher. Lila gebrauchte dieses Wort damals oft, in der Schule und außerhalb. Doch es hatte den Anschein, als interessierte sie nicht so sehr, was vor unserer Zeit geschehen war – in der Regel undurchsichtige Dinge, zu denen die Erwachsenen entweder schwiegen oder sich nur mit größter Zurückhaltung äußerten –, sondern eher die Tatsache, dass es überhaupt ein Früher gegeben hatte. Gerade das verblüffte sie und machte sie zuweilen nervös. Als wir Freundinnen wurden, sprach sie so oft über diese absurde Sache – dieses Vor uns –, dass sie ihre Nervosität schließlich auch auf mich übertrug. Es ging um die lange, sehr lange Zeit, in der es uns noch nicht gegeben hatte; die Zeit, in der Don Achille sich allen gegenüber als das entpuppt hatte, was er war: eine niederträchtige Kreatur mit einem unbestimmten animalisch-mineralischen Äußeren, die – so schien es – anderen das Blut aussaugte, während sie selbst nie welches verlor. Vielleicht war es gar nicht möglich, ihm auch nur einen Kratzer zuzufügen.
Wir mochten in der zweiten Klasse gewesen sein und sprachen noch nicht miteinander, als das Gerücht die Runde machte, Signor Peluso habe nach der Messe ausgerechnet vor der Chiesa della Sacra Famiglia angefangen, lauthals gegen Don Achille zu wettern, und Don Achille habe seinen ältesten Sohn Stefano, Pinuccia, Alfonso, der so alt war wie wir, und seine Frau stehenlassen, um sich für einen Augenblick von seiner schrecklichsten Seite zu zeigen, sich auf Peluso zu stürzen, ihn hochzuheben, ihn in dem kleinen Stadtpark gegen einen Baum zu schmettern und dort liegen zu lassen, bewusstlos, aus unzähligen Wunden am Kopf und am ganzen Körper blutend, ohne dass der Ärmste auch nur »Hilfe« hätte sagen können.
Ich sehne mich nicht nach unserer Kindheit zurück, sie war voller Gewalt. Es passierte alles Mögliche, zu Hause und draußen, Tag für Tag, doch ich kann mich nicht erinnern, jemals gedacht zu haben, dass unser Leben besonders schlimm sei. Das Leben war eben so, und damit basta, wir waren gezwungen, es anderen schwerzumachen, bevor sie es uns schwermachten. Gewiss, mir wären die freundlichen Umgangsformen, die unsere Lehrerin und der Pfarrer predigten, auch lieber gewesen, doch ich merkte, dass sie für den Rione, für unser Viertel, nicht geeignet waren, auch für die Mädchen nicht. Die Frauen bekämpften sich untereinander noch heftiger als die Männer, zogen sich an den Haaren, fügten sich gegenseitig Leid zu. Leid zuzufügen war eine Krankheit. Als ich klein war, stellte ich mir winzige, unsichtbare Tierchen vor, die nachts im Rione einfielen, sie kamen aus den Teichen, aus den ausrangierten Eisenbahnwaggons hinter dem Bahndamm, aus den stinkenden Pflanzen, die bei uns fetienti genannt werden, aus den Fröschen, den Salamandern, den Fliegen, den Steinen, dem Staub, sie gelangten ins Wasser, ins Essen, in die Luft und machten unsere Mütter und Großmütter rasend wie durstige Hündinnen. Die Frauen waren schlimmer infiziert als die Männer, denn die Männer regten sich zwar ständig auf, beruhigten sich am Ende aber immer, während die Frauen scheinbar still und umgänglich waren, doch wenn sie in Fahrt kamen, fuchsteufelswild wurden und kein Halten mehr kannten.
Lila war sehr betroffen von dem, was Melina Cappuccio, einer Verwandten ihrer Mutter, zugestoßen war. Und ich auch. Melina wohnte im selben Haus wie meine Eltern, wir im zweiten Stock, sie im dritten. Sie war knapp über dreißig und hatte sechs Kinder, aber uns kam sie vor wie eine alte Frau. Ihr Mann war so alt wie sie, er schleppte Kisten auf dem Gemüsemarkt. Ich habe ihn klein und breit in Erinnerung, doch gutaussehend, mit einem stolzen Gesicht. Eines Nachts ging er wie gewöhnlich aus dem Haus und starb, vielleicht durch einen Mord, vielleicht vor Erschöpfung. Es gab ein todtrauriges Begräbnis, zu dem der ganze Rione kam, meine Eltern auch, Lilas Eltern auch. Dann verging einige Zeit, und wer weiß, was da mit Melina geschah. Nach außen war sie wie immer, eine schroffe Frau mit einer großen Nase, die Haare bereits grau, die Stimme schrill, wenn sie in wütender Verzweiflung mit langgezogenen Silben abends am Fenster ihre Kinder beim Namen rief: Aaa-daaa, Miii-chè. Anfangs erhielt sie sehr viel Unterstützung von Donato Sarratore, der direkt über ihr wohnte, im vierten und obersten Stockwerk. Donato war ein eifriger Kirchgänger in der Gemeinde der Sacra Famiglia, und als guter Christ kümmerte er sich sehr um sie, sammelte Geld, gebrauchte Kleidung und Schuhe für sie und verschaffte ihrem ältesten Sohn Antonio Arbeit in der Werkstatt eines Bekannten, bei Gorresio. Melina war ihm so dankbar, dass dies in ihrer verzweifelten Seele in Liebe umschlug, in Leidenschaft. Man erfuhr nicht, ob Sarratore das je bemerkte. Er war ein sehr herzlicher, doch grundsolider Mann, Heim, Kirche, Arbeit. Er gehörte zum fahrenden Personal der staatlichen Eisenbahn und hatte ein festes Gehalt, mit dem er seine Frau Lidia und die fünf Kinder rechtschaffen ernährte, sein Ältester hieß Nino. Wenn er nicht unterwegs war, auf der Strecke Neapel – Paola und zurück, reparierte er dies und das in der Wohnung, ging einkaufen und fuhr das Kleinste im Kinderwagen spazieren. Alles sehr unüblich in unserem Rione. Niemandem kam es in den Sinn, dass Donato sich in dieser Weise aufopferte, um seiner Frau Arbeit abzunehmen. Nein. Sämtliche Männer der Nachbarschaft, allen voran mein Vater, hielten ihn für einen Pantoffelhelden, der noch dazu Gedichte schrieb und sie gern jedem x-Beliebigen vorlas. Auch Melina war das nie in den Sinn gekommen. Die Witwe glaubte lieber, dass er sich von seiner Frau aus Gutmütigkeit herumkommandieren ließ, und beschloss, Lidia Sarratore unerbittlich den Kampf anzusagen, um ihn zu befreien und es ihm zu ermöglichen, sich dauerhaft mit ihr zu verbinden. Den Krieg, der daraus folgte, fand ich zunächst amüsant, sorgte er doch bei mir zu Hause und anderswo für Gesprächsstoff, begleitet von schadenfrohem Gelächter. Lidia hängte frisch gewaschene Laken auf, und Melina stieg aufs Fensterbrett, um sie mit der Spitze eines eigens dafür im Feuer geschwärzten Stocks zu beschmutzen; Lidia ging unterm Fenster vorbei, und Melina spuckte ihr auf den Kopf oder schüttete einen Eimer Schmutzwasser über ihr aus; Lidia machte tagsüber Lärm, da sie zusammen mit ihren ungestümen Kindern über Melinas Kopf herumtrampelte, und Melina schlug die ganze Nacht wie besessen mit dem Schrubber gegen die Zimmerdecke. Sarratore versuchte auf jede erdenkliche Weise, Frieden zu stiften, doch er war zu empfindsam, zu liebenswürdig. Eine Gemeinheit folgte auf die andere, und so feindeten sich die zwei Frauen mit harten, scharfen Tönen an, sobald sie sich auf der Straße oder auf der Treppe begegneten. Von nun an machten sie mir Angst. Eine der zahllosen schrecklichen Szenen aus meiner Kindheit beginnt mit Melinas und Lidias Geschrei, mit den Beschimpfungen, mit denen sie sich vom Fenster aus und dann im Treppenhaus überhäufen. Sie setzt sich fort mit meiner Mutter, die zur Wohnungstür läuft, sie öffnet und sich, gefolgt von uns Kindern, auf den Treppenabsatz stellt. Und sie endet mit dem für mich noch heute unerträglichen Bild der beiden Nachbarinnen, die aneinandergeklammert die Stufen herunterrollen, und mit Melinas Kopf, der nur wenige Zentimeter neben meinen Füßen auf dem Boden aufschlägt wie eine Honigmelone, die jemandem aus der Hand gerutscht ist.
Ich kann nicht sagen, warum wir Mädchen damals auf Lidia Sarratores Seite waren. Vielleicht weil sie ein ebenmäßiges Gesicht und blonde Haare hatte. Oder weil Donato zu ihr gehörte und wir verstanden hatten, dass Melina ihn ihr wegnehmen wollte. Oder weil Melinas Kinder zerlumpt und dreckig waren, während Lidias gewaschen und sorgfältig gekämmt waren und weil ihr Erstgeborener, Nino, der einige Jahre älter war als wir, so gut aussah und uns gefiel. Nur Lila fühlte sich zu Melina hingezogen, erklärte uns aber nie warum. Einmal sagte sie nur, dass es Lidia Sarratore ganz recht geschähe, wenn man sie umbrächte, und ich dachte, Lila sah sie so, weil sie eben einen schlechten Charakter hatte und weil sie und Melina entfernt miteinander verwandt waren.
Eines Tages kamen wir aus der Schule, wir waren vier oder fünf Mädchen. Darunter auch Marisa Sarratore, die für gewöhnlich nicht deshalb bei uns sein durfte, weil wir sie so gut leiden konnten, sondern weil wir hofften, durch sie an ihren großen Bruder Nino heranzukommen. Sie entdeckte Melina als Erste. Die Witwe ging mit langsamen Schritten auf der anderen Seite des Stradone, der großen Verkehrsstraße, die durch unser Viertel führte, und hielt eine Papiertüte in der Hand, aus der sie etwas aß. Marisa zeigte sie uns und bezeichnete sie als »die Nutte«, doch ohne Verachtung, sie wiederholte ganz einfach den Ausdruck, den ihre Mutter zu Hause verwendete. Sofort gab ihr Lila, obwohl sie kleiner war und spindeldürr, eine so heftige Ohrfeige, dass sie sie zu Boden schickte, und das tat sie ungerührt wie immer, wenn Gewalt im Spiel war, ohne Geschrei vorher und ohne Geschrei nachher, ohne ein warnendes Wort und ohne die Augen aufzureißen, eiskalt und bestimmt.
Ich half zunächst Marisa auf, die nun weinte, und drehte mich dann zu Lila um. Sie hatte den Gehsteig verlassen und ging über die Straße auf Melina zu, ohne auf die vorbeifahrenden Lastwagen zu achten. Ich sah – mehr in ihrer Haltung als in ihrem Gesicht – etwas, was mich verstörte und was ich bis heute nur schwer benennen kann, weshalb ich mich vorerst mit dem folgenden Bild begnügen möchte: Obwohl sie beim Überqueren der Straße in Bewegung war, und dies mit der üblichen Entschlossenheit, eine kleine, schwarze, markante Gestalt, war sie erstarrt. Erstarrt wegen dem, was die Verwandte ihrer Mutter da tat, erstarrt vor Schmerz, erstarrt wie eine Salzsäule. Teilnehmend. Vollkommen verschmolzen mit Melina, die die soeben in Don Carlos Keller gekaufte dunkle Schmierseife in einer Hand hielt, sich mit der anderen Hand davon nahm und es aß.
Am Tag als Maestra Oliviero vom Pult fiel und mit dem Jochbein gegen eine Schulbank schlug, hielt ich sie, wie gesagt, für tot, bei der Arbeit verunglückt wie mein Großvater oder wie Melinas Mann, und ich glaubte, dass auch Lila, wegen der schrecklichen Strafe, die sie erhalten würde, sterben müsse. Eine Weile, deren Dauer ich nicht näher bestimmen kann – kurz, lang –, geschah jedoch nichts. Beide, Lehrerin und Schülerin, verschwanden lediglich aus unseren Tagen und aus unserem Gedächtnis.
Damals kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Maestra Oliviero kehrte lebendig in die Schule zurück und fing an, sich um Lila zu kümmern, doch nicht zur Strafe, wie es uns eingeleuchtet hätte, sondern um sie lobend hervorzuheben.
Diese neue Phase begann, als Lilas Mutter, Signora Cerullo, in die Schule bestellt wurde. Eines Morgens klopfte der Schuldiener an die Tür und kündigte sie an. Kurz darauf trat Nunzia Cerullo ein und war nicht wiederzuerkennen. Sie, die wie die meisten Frauen im Rione stets ungepflegt herumlief, in Latschen und alten, verschlissenen Kleidern, erschien in Festgarderobe (für Hochzeit, Kommunion, Firmung, Begräbnis), ganz in Schwarz, mit einer schwarzen Lacktasche und in Schuhen mit leichtem Absatz, die ihre geschwollenen Füße malträtierten, und überreichte der Maestra zwei kleine Papiertüten, eine mit Zucker und eine mit Kaffee.
Die Maestra nahm die Geschenke gern an und sagte an sie und die ganze Klasse gewandt mit einem Blick zu Lila, die vor sich auf die Bank starrte, Sätze, deren Inhalt mich im Großen und Ganzen verwirrte. Wir waren in der ersten Klasse. Lernten gerade das Alphabet und die Zahlen von eins bis zehn. Die Klassenbeste war ich, denn ich kannte schon alle Buchstaben, konnte eins, zwei, drei, vier und so weiter sagen, wurde ständig für meine Schrift gelobt und gewann die von der Lehrerin genähten Kokarden in den drei Landesfarben. Trotzdem sagte Maestra Oliviero zu meiner Überraschung, obwohl sie durch Lilas Schuld gestürzt und im Krankenhaus gelandet war, dass Lila die Beste von uns sei. Zwar sei sie die Unartigste. Zwar habe sie sich schrecklich danebenbenommen und uns mit tintengetränkten Löschpapierkugeln beworfen. Zwar wäre sie, unsere Lehrerin, nicht vom Pult gestürzt und hätte sich nicht das Jochbein verletzt, wenn dieses Mädchen nicht so undiszipliniert gewesen wäre. Zwar sei sie in einem fort gezwungen, sie mit dem Stock zu bestrafen oder sie auf dem harten Boden hinter der Tafel knien zu lassen. Doch es gebe etwas, das sie als Lehrerin und auch als Mensch mit Freude erfülle, etwas Wunderbares, das sie einige Tage zuvor zufällig entdeckt habe.
An dieser Stelle redete sie nicht weiter, ganz als fehlten ihr die Worte oder als wollte sie Lilas Mutter und uns lehren, dass Tatsachen fast immer mehr als Worte zählten. Sie nahm ein Stück Kreide und schrieb etwas an die Tafel, was, weiß ich nicht mehr, ich konnte noch nicht lesen, daher denke ich mir jetzt ein Wort aus: Sonne. Dann fragte sie Lila:
»Cerullo, was steht hier?«
Im Klassenraum breitete sich eine neugierige Stille aus. Lila verzog den Mund zu einem leichten Lächeln, fast schon zu einer Grimasse, und warf sich zur Seite gegen ihre Banknachbarin, die das sichtlich störte. Dann las sie mürrisch:
»Sonne.«
Nunzia Cerullo schaute die Lehrerin an, ihr Blick war unsicher, fast erschrocken. Maestra Oliviero schien nicht sofort zu begreifen, warum ihre eigene Begeisterung sich in den Augen der Mutter nicht widerspiegelte. Doch dann muss ihr klargeworden sein, dass Nunzia nicht lesen konnte oder sich zumindest nicht sicher war, ob an der Tafel wirklich Sonne stand, und sie runzelte die Brauen. Dann sagte sie zu Lila, teils, um Nunzia Klarheit zu verschaffen, und teils, um unsere Schulkameradin zu loben:
»Sehr gut, hier steht wirklich Sonne.«
Dann forderte sie sie auf:
»Komm her, Cerullo, komm an die Tafel.«
Widerstrebend ging Lila nach vorn, die Maestra gab ihr die Kreide.
Sie sagte: »Schreib Kreide.«
Hochkonzentriert und mit zitternder Schrift, wobei mancher Buchstabe zu hoch und mancher zu tief geriet, schrieb sie: Kraide.
Maestra Oliviero tauschte das A gegen ein E aus, und Signora Cerullo, die die Korrektur sah, sagte enttäuscht zu ihrer Tochter:
»Du hast einen Fehler gemacht.«
Doch die Lehrerin beruhigte sie sogleich:
»Nein, nein, ganz und gar nicht: Lila muss zwar noch üben, aber sie kann schon lesen, und sie kann schon schreiben. Wer hat ihr das beigebracht?«
Signora Cerullo sagte mit gesenktem Blick:
»Ich nicht.«
»Gibt es vielleicht jemanden bei Ihnen zu Hause oder in der Nachbarschaft, der das getan haben könnte?«
Nunzia schüttelte energisch den Kopf.
Da wandte sich die Lehrerin an Lila und fragte sie mit aufrichtiger Bewunderung vor uns allen:
»Wer hat dir Lesen und Schreiben beigebracht, Cerullo?«
Die kleine Cerullo, mit dunklem Haar, dunklen Augen und dunklem Schulkittel, mit einer rosa Schleife um den Hals und mit ihren nur sechs Jahren antwortete:
»Ich.«