
Luise Rinser
Die Stärkeren
Roman
FISCHER Digital

Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden Stefanie und ihre ältere Schwester Klara aufs Land geschickt, um dort bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter zu leben. In einem bayerischen Städtchen erleben wir eine erstarrte Gesellschaft, die im Lauf der folgenden dreißig Jahre vom Krieg, der Machtergreifung der Nationalsozialisten und einem zweiten Krieg erschüttert wird. Generationenübergreifend und anhand der unterschiedlichen Lebenswege zweier Schwestern geht es dabei immer auch um die Frage: Soll man fortgehen, wenn man unglücklich ist? Oder soll man bleiben und versuchen, die Dinge zum Besseren zu verändern?
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Impressum der Reprint Vorlage
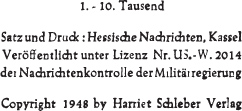
ISBN dieser E-Book-Ausgabe: 978-3-10-561215-6
Zwei Kinder gingen Ende Juli 1914 in der Mittagshitze auf der Bahnhofstraße stadteinwärts. Die Größere war etwa zehn Jahre, die Kleine vier oder fünf. Die Größere hatte eine Brille mit einem Stahlrand auf der Nase und hinkte ein wenig. Sie trug einen ziemlich schweren schäbigen Koffer in der einen Hand, in der anderen eine geflickte Reisetasche. Ohne nach rechts oder links zu schauen, ging sie so rasch sie konnte. Die Kleine lief hinterher. Sie schleppte einen schlecht verschnürten Karton. Manchmal fragte sie hoffnungslos: „Sind wir noch nicht bald da?“ Aber die Schwester gab keine Antwort. Alle Leute auf der Straße schauten den beiden nach. An jeder Straßenecke las die Große mit vorgestrecktem Kopf murmelnd die Straßenschilder. Einmal blieb die Kleine zurück. Sie hatte aus einem offenen Fenster Klavierspiel gehört. Sie blieb stehen, bohrte mit der Fußspitze im Straßenstaub und lauschte mit halb offenem Mund auf die Musik. „Komm doch!“ rief die Ältere ungeduldig. Langsam trottete die Kleine nach.
Sie kamen durch enge Gassen mit kleinen Läden und finsteren Werkstätten. Lehmgelbe Metzgerhunde, groß wie Kälber, lagen in den Toreinfahrten. Die Kleine redete sie in einer selbst erfundenen Sprache an. Aber sie lagen wie tot, die Beine weit von sich gestreckt, und kümmerten sich um nichts.
Einmal überquerten sie einen großen Platz mit einem Brunnen. Auf dem Steinrand saßen graue Tauben und rührten sich nicht. Die Kleine sagte: „Ich hab Durst.“ Aber die Größere hörte nicht darauf. Das Wasser rann in einem dünnen Strahl aus einem eisernen Rohr. Die Kleine konnte es nicht erreichen. Das Wasser im Becken schillerte ölig in den Regenbogenfarben. Man konnte es nicht trinken. Quer über den Platz kamen drei Pfarrer in langen schwarzen Talaren. Sie waren alle drei alt, gingen auf Stöcke gestützt und sprachen eifrig, alle zugleich. Die Kleine schaute ihnen neugierig und beklommen nach. Es war so heiß, daß die Luft flimmerte über dem Pflaster.
„Dauert es noch lang?“ fragte die Kleine. Aber sie verstand nicht, was die Größere sagte. Die Kleine seufzte. Die Große ging unentwegt weiter mit vorgestrecktem Kopf. Sie kamen an einem großen Haus vorbei, in dem Rotationsmaschinen ratterten. Alte Frauen und kleine Buben kamen mit großen Stößen Zeitungen aus einer Tür. Es roch streng nach frischer Druckerschwärze.
„Tageblatt, Tageblatt, das Neueste vom Tage“, sang ein Junge und fuhr der Kleinen mit einem Zeitungsblatt über das Gesicht. Er war nicht sehr viel älter als sie, braungebrannt und mager, und sein kariertes Hemd war über der Brust zerrissen.
Hinter dem „Tageblatt“ begann die Vorstadt mit niedrigen feuchten Häusern. Ein schmaler Bach mit dunkelgrünem Wasser floß da, und überall waren Waschbretter an den Ufern und kleine Büsche, von der Sonne verbrannt.
„So“, sagte die Größere aufatmend und stieß mit dem Fuß eine hölzerne Gartentür auf. Eine alte Frau kam aus dem Haus gelaufen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. „Kinder, Kinder“, rief sie, „wo kommt ihr her? Was ist denn mit euch? Und die schweren Koffer! Und das da ist Stefanie? Mein Gott, ich hab dich zuletzt gesehn, da warst du ein Wickelkind. Kommt herein, kommt nur.“
Sie stolperten mehr als sie gingen. Die Großmutter nahm sie in die Arme und wischte ihnen mit der Schürze Staub und Schweiß von den Gesichtern, dann lief sie in die Küche und brachte kalten Kaffee. „Das löscht den Durst am besten“, sagte sie. Die Kinder tranken gierig.
Plötzlich fragte die Größere: „Wo is sie denn?“
„Ich weiß nicht“, sagte die Großmutter und schaute beiseite. „Sie wird schon kommen. Aber sagt doch, warum ihr so plötzlich da seid. Hat er euch fortgeschickt? Gehts nimmer mit euch dreien?“
Die Größere sagte finster: „Ach was. Freilich ginge es. Aber er meint, jetzt kommt Krieg und da is es besser, wir sind nicht in der Großstadt. Und wir sollen so lang hier bleiben.“ Hastig und wie eingelernt fügte sie hinzu: „Das heißt, wenn ihr uns überhaupt brauchen könnt. Sonst …“ Sie zuckte die Achseln.
„Mein Gott, Klara“, rief die Großmutter, „wie du redest. Freilich könnt ihr bleiben.“
Klara murmelte: „Aber sie? Was wird sie sagen?“
Die Großmutter strich ihr mit der rauhen Hand über das Haar und sagte leise: „Arme Kinder.“ Klara bog den Kopf hastig zurück, und die Kleine schaute verwirrt um sich. Auf einmal rief sie laut: „Und einen schönen Gruß von Papa und wir haben auch Geld dabei. Eine Menge.“
Die Großmutter wischte sich mit der Hand über die Augen. Da ging draußen die Gartentür. Alle drei schauten zum Fenster. Es wurde ganz still im Zimmer.
„Is sie das?“ fragte die Kleine leise. Niemand gab Antwort. Es war eine ziemlich junge Frau in einem hellgrauen Seidenkleid mit einem Spitzenjabot, langen durchbrochenen Handschuhen an den bloßen runden Armen und einem weißen Hut mit einer schwarzen Straußenfeder. Sie klappte ihren Sonnenschirm zusammen und stand eine Weile in der prallen Sonne. Dann zog sie langsam die Handschuhe aus und tauchte ihre weißen Arme bis zu den Ellbogen in ein Faß mit Wasser, das zum Gartengießen aufgestellt war. Dabei bückte sie sich über das Wasser und betrachtete lange ihr Spiegelbild. Dann zog sie ihre Arme heraus, hielt sie vor sich hin in die Sonne und schaute nachdenklich zu, wie die Nässe auf ihrer warmen hellen Haut trocknete. Alles, was sie tat, geschah ganz langsam; sie hielt dabei die Augen halb geschlossen. Die Kinder schauten ihr unbeweglich zu. Sie rührten sich auch nicht, als sie endlich zur Tür hereinkam, wobei sie sich bücken mußte, damit ihr Federhut nicht am Türbalken anstieß.
Da sah sie die Kinder. Einen Augenblick stutzte sie. Dann warf sie Hut, Schirm und Handschuhe weg, kniete sich auf den Boden und umarmte sie stürmisch. Klara entzog sich ihr mit finsterem Gesicht. Stefanie stand ganz steif, ließ sich liebkosen und schaute ihr dabei mit weit offenen Augen ins Gesicht. Niemand konnte sehen, was sie dachte.
Die Großmutter machte sich an den Blumentöpfen zu schaffen. Ohne umzuschauen, sagte sie: „Er meint, es gibt Krieg. Und da, meint er, sind die Kinder hier besser aufgehoben als in der Großstadt.“ „Ja, ja“, sagte die Mutter abwesend. Plötzlich sprang sie hoch und rief: „Krieg sagt er? Krieg? Ist das wahr?“ Sie schaute unglücklich und ratlos von einem zum anderen. Klara zuckte die Achseln und murmelte: „Na ja, da is nix zu ändern.“ Es war eine Weile ganz still im Zimmer, bis die Mutter zögernd fragte: „Und … wie geht es ihm?“
„Gut“, sagte Klara so schroff, daß alle sie erschrocken ansahen. „Ja, und euch?“ fuhr die Mutter leise fort. „Wie ist es euch gegangen?“
„Auch gut“, sagte Klara kurz.
„Das is recht, das freut mich“, sagte die Mutter hastig und strich ihre dichten braunen Haare hinter das Ohr zurück. Ohne jemand anzusehen, fragte sie: „Und er, spricht er manchmal von mir?“
„Nein“, antwortete Klara trocken. „Er arbeitet immer.“
„Ja“, rief die Kleine, „und er sagt, er kann jetzt endlich in Ruhe arbeiten, seitdem Du fort bist.“
„So? Sagt er das?“ fragte die Mutter leise. Man konnte es kaum hören. Dann lachte sie kurz, warf den Kopf zurück und begann die Handschuhe wieder anzuziehen.
„Gehst du denn nochmal fort?“ fragte die Großmutter.
„Ich? Nein“, sagte die Mutter langsam und zog die Handschuhe wieder aus. Die Uhr tickte laut. Alle standen da und niemand sprach ein Wort. Endlich sagte die Großmutter: „Kommt, Kinder, ich bring euch in euer Zimmer.“
„Nein, nein“, rief die Mutter, „ich geh ja schon. Kommt.“ Sie wollte den Koffer nehmen, aber Klara sagte trocken: „Laß nur. Ich hab ihn bis hierher auch allein getragen. Wir sind es schon gewöhnt.“ Aber Stefanie ließ sich den Karton abnehmen und sich an der Hand über die steile Stiege führen. Sie schaute die Mutter unverwandt von der Seite an. Plötzlich sagte die Mutter zu Klara: „Deine Schulter ist ja wieder höher geworden. Gehst du denn nimmer in die Klinik?“
„Nein“, sagte Klara, „das nützt ja doch nichts.“ Sachlich fügte sie hinzu: „Rachitis.“
„Du lieber Gott“, rief die Mutter, „wer sagt dir denn so was?“
„Der Arzt“, antwortete Klara trocken.
„Um Himmelswillen, das ist doch nicht wahr. Du bist als Kind über die Treppe gefallen, daher kommt das.“
„Ach was“, murmelte Klara, „warum erzählst du mir so was. Du weißt doch, daß es nicht stimmt. Und überhaupt: bucklig werd ich so oder so.“ Die Mutter sagte nichts mehr. Sie öffnete die Tür zu einem kleinen Raum. „Das is jetzt euer Zimmer“, sagte sie. Klara stellte Koffer und Reisetasche auf den Boden und schaute sich eingehend um. „Ja“, sagte die Mutter verlegen, „es is halt einfach hier. Bei ihm wars schöner, ich weiß schon.“ Sie strich langsam ihre Haare hinter die Ohren zurück und schaute hilflos auf die Kinder. Da rief die Kleine laut: „Aber hier is es sauberer.“
Klara warf ihr einen schiefen Blick zu und begann den Koffer auszupacken. „Ich helf dir“, sagte die Mutter. Klara schob sie schweigend weg. Die Mutter blieb mitten im Zimmer stehen. Sie hielt Stefanie fest an der Hand. Plötzlich ließ sie die Kleine los und sagte hastig: „Ja, dann will ich noch rasch fortgehen. Geht nur hinunter. Die Großmutter gibt euch was zu essen.“ „Wohin geht sie?“ fragte die Kleine. Die Größere zuckte die Achseln und kramte weiter. Eine Weile später kam die Großmutter herauf.
„Wo is sie denn?“ fragte sie erstaunt.
„Fort“, sagte die Kleine. Die Großmutter seufzte. „Kommt Kaffee trinken. Ich hab frische Semmeln geholt. Ihr müßt doch Hunger haben. Aufräumen tun wir nachher.“
Als sie in der kleinen Stube saßen, fragte die Großmutter: „Wie gehts denn eurem Papa?“
„Gut“, sagte Klara und kaute. Die Großmutter schüttete noch einen Löffel Zucker in die Tassen und fragte rasch: „Redet er von der Mama?“
„Nein“, sagt Klara mit vollem Mund, „du hast es doch gehört. Warum soll er denn von ihr reden?“
Zögernd fuhr die Großmutter fort: „Und ihr? Wollt ihr nicht, daß sie wieder zu euch kommt?“ „Nein“, riefen die beiden zugleich. Stefanie fügte ganz leise hinzu: „Ich weiß nicht.“ Aber das hörte niemand. Die Großmutter drehte sich um und wischte mit der Schürze über ihre Augen.
Klara schaute sich in der Stube um. „Suchst du was?“ fragte die Großmutter schließlich. Aber sie bekam keine Antwort. Nach einiger Zeit fragte Klara: „Seid ihr arm?“
Die Großmutter schaute sie bestürzt an. „Arm? Wie kommst du da drauf?“
„Komisch“, murmelte Klara. „Hier und im ganzen Haus siehts so aus wie bei armen Leuten. Aber sie geht so fein angezogen, das Kleid und der Sonnenschirm und alles. Das hat sie doch sonst nicht gehabt?“
Die Großmutter wischte die Krümel vom Tisch und schaute niemand an. „Wollt ihr nicht spielen gehn?“ fragte sie.
„Spielen nicht“, sagte Klara. „Aber ansehn können wir uns das alles.“ Ohne sich umzuschauen gingen die Kinder fort.
Auf der anderen Straßenseite waren lauter Häuser, die genau so aussahen wie das der Großmutter. Hinter dieser Häuserreihe war die Stadt zu Ende. Hier war nur mehr ein großer Lagerplatz mit schwarzen Kohlenhaufen und hohen Bretterstapeln. Es roch erstickend nach Holz und heißem Staub.
„Da is nix“, sagte Klara. „Und heiß is es. Komm doch.“ Aber die Kleine rief begeistert: „Eine Eisenbahn, eine Eisenbahn!“
„Das is doch bloß ein totes Geleis“, sagte Klara verächtlich. „Da wächst schon Gras drauf. Da fährt nix mehr.“
„Ein totes Geleis“, wiederholte die Kleine nachdenklich. Dann sagte sie trotzig: „Aber vielleicht fährt doch mal was drauf.“ Klara zuckte die Achseln. „Ich mag bald nicht mehr“, sagte sie. Die Kleine rief aufsässig: „Dann geh doch heim.“ „Nein“, sagte Klara, „dich kann man nicht allein lassen. Du findest nimmer heim.“
Die Kleine stieg eifrig über Kohlenhaufen und Bretter. Klara folgte mühsam. Plötzlich blieb die Kleine stehen. Zwischen Bretterstößen spielten, wie in einem Haus, fünf Kinder, vier Buben, ein Mädchen, nicht viel älter als Stefanie. Sie knieten auf dem Boden und bauten im Sand. Stefanies Augen glänzten vor Entzücken. Es war ein schöner Spielplatz mit leeren Fässern, alten Kisten, einer rostigen Gießkanne, einem Haufen alter Schrauben und Nägel und einem zerschlissenen Regenschirm, den sie wie ein Sonnendach über den Sandhaufen gespannt hatten. Sie knieten alle mitten im Sand, den sie mit Wasser begossen hatten. Sie waren von oben bis unten voller Schmutz. Stefanie flüsterte: „Da sind Kinder!“ Klara setzte sich in den Schatten eines Holzstapels und flocht ihre steifen schwarzen Zöpfe, ohne die Augen von der kleinen Schwester zu lassen. Stefanie schob sich langsam an die Kinder heran. Schließlich schaute einer der Jungen auf und fragte: „Wer bist’n du?“
„Stefanie. Und du?“
„Peter Niels.“ Sie sahen einander an. Dann fragte Stefanie: „Was baut Ihr’n da?“
„Ach nix, nur so“, sagte Peter und stieß mit der Fußspitze eine Sandburg kaputt. Allmählich hörten auch die anderen auf zu spielen. Sie wischten den Staub von den Gesichtern und betrachteten die Fremde, und Stefanie schaute sie der Reihe nach an. Da war ein Mädchen mit langen blonden Zöpfen. Sie hieß Anna. Dann war da der Zeitungsjunge Max. Sie erkannte ihn sofort wieder. Ferner war da ein magerer Junge, größer als die anderen und trotz der Hitze sehr blaß. Er hieß Georg. Außer Peter Niels war noch ein Junge da, der ganz schwarzes Haar und große braune Augen hatte und Erich hieß.
„Was spielen wir jetzt?“ fragte Peter Niels.
„Soldaten“, sagte der Zeitungsjunge. „Soldaten und Krieg.“
Plötzlich fiel Stefanie ein, was sie wußte, und sie flüsterte: „Der Krieg kommt.“
Das Mädchen fragte neugierig: „Woher weißt’n das?“
Stefanie sagte trotzig: „Alle sagen das.“
Der Zeitungsjunge schrie: „Hurra, der Krieg.“ Sie tanzten um die leeren Fässer und sangen: „Hurra, der Krieg.“ Klara stand auf und rief zornig: „Dummköpfe, das is nix zum Singen.“ Aber niemand hörte auf sie. Plötzlich warf Stefanie ihre Arme in die Höhe und schrie: „Nein, nein. Nicht singen! Nicht singen!“ Sie brachen ihr Geschrei ab, standen still und starrten auf die Kleine. „Was is denn?“ fragte Peter Niels. Aber sie wiederholte nur fassungslos: „Nicht singen. Nicht singen.“
„Die is komisch“, sagte der Zeitungsjunge. Da nahm Klara ihre kleine Schwester bei der Hand und führte sie rasch fort. Von weitem hörten sie, wie die Kinder wieder zu singen begannen, aber es war jetzt ein anderes Lied. Von Zeit zu Zeit schaute Stefanie aufmerksam um. „Was schaust’n immer um?“ fragte Klara. Aber die Kleine gab keine Antwort.
„Warum hast’n so geschrien?“ fragte Klara.
„Ich weiß nicht“, flüsterte die Kleine. Nach einer Weile fragte sie: „Du, Klara, muß der Papa auch in’ Krieg?“
Die Große strich ihr rasch die feuchten wirren Haare aus dem Gesicht. „Nein“, sagte sie, „ich glaub nicht. Er hat’n Herzfehler.“
Als sie über die Straße gingen, kam ihnen die Mutter entgegen. „Gott sei Dank, da seid ihr ja. Wo wart ihr denn?“
Klara deutete mit dem Kopf stumm und unbestimmt nach rückwärts. „Kommt rasch heim“, sagte die Mutter, „wir gehn in die Stadt zu Tante Bertha.“
Klara murmelte: „Ach zu der.“ Die Mutter schaute sie rasch von der Seite an, dann sagte sie: „Aber hübscher anziehn müßt ihr euch.“
„Das da is doch unser Sonntagskleid“, sagte Klara. Die Mutter stutzte. „Aber wenigstens die Hände waschen“, sagte sie. Als sie gewaschen waren, brachte die Mutter ein Kästchen mit bunten Bändern.
„Schau mal“, sagte sie zu Klara, „willst du dir das ins Haar binden?“ „Das grüne Zeug da?“ fragte Klara. „Nein, das kannst du nicht von mir verlangen.“
Die Mutter sagte nichts und band die Schleife der Kleinen um den braunen Schopf. Klara lachte kurz auf. „Die sieht aus wie ein geputzter Wildesel. Laß uns lieber so wie wir sind.“ Aber die Kleine rief plötzlich trotzig: „Ich will aber die Schleife.“ Sie bekam sie umgebunden. Aber schon fünf Minuten später löste sie sich aus dem widerspenstigen Haar und blieb irgendwo auf der Straße liegen. Die Kleine schaute sich rasch um. Da fuhr gerade ein Lastauto drüber weg.
Als sie über den Marktplatz gingen, begegnete ihnen eine Frau. Sie hatte ein lila Seidenkleid an, das bei jedem Schritt raschelte. An den Ärmeln war es abgeschabt, das konnte man deutlich sehen. Der Rock war so lang, daß er auf der Erde schleifte und einen breiten grauen Saum von Staub hatte. Unter dem kleinen weißen Hütchen sah man ihre Haare, die ganz glatt und schwarz waren.
„Wer is’n das?“ fragte Stefanie so laut, daß die Frau den Kopf nach ihr drehte. „Ich bin Dora Lilienthal“, sagte sie und lächelte.
Die Mutter sagte: „Entschuldigen Sie bitte, die Kinder sind so vorlaut.“
„Aber ich bitte Sie, Frau Martin“, sagte Dora Lilienthal sanft, „ich liebe doch Kinder. Es sind doch Ihre, nicht wahr? Sind sie musikalisch?“
„Nein, das heißt, ich weiß es nicht, kann schon sein“, erwiderte die Mutter und wurde ziemlich rot.
„Das könnte man versuchen“, meinte Dora Lilienthal freundlich und fuhr ein wenig hastig fort: „Will nicht vielleicht eine von den beiden Klavierstunden nehmen?“
„Ach“, sagte die Mutter und knüpfte ihre Handschuhe auf und wieder zu. „Das lohnt nicht. So begabt werden sie nicht sein. Und überhaupt sind sie nur ganz vorübergehend hier. Vielleicht, wenn sie einmal für ganz hier sind.“
„Wir werden nie für ganz hier sein“, sagte Klara laut und begann die Kleine weiterzuziehen. Dora Lilienthal lächelte hilflos. Verwirrt sagte sie: „Dann geht es eben nicht. Schade. Ich liebe Kinder so.“ Sie ging rasch weiter. Die Mutter sagte seufzend: „Sie möchte halt mehr Schülerinnen haben. Das is es. Sie verdient ziemlich wenig, glaub ich.“ Nach einer Weile fügte sie nachdenklich hinzu: „Die wartet auch vergeblich.“
„Auf was?“ fragte Klara gleichgültig.
„Vor ein paar Jahren“, sagte die Mutter eifrig, „da war hier mal ein Konzert. Ein Sänger war da, ein berühmter. Aber da wurde plötzlich der Klavierspieler krank und das Konzert sollte abgesagt werden. Da hat Dora Lilienthal gesagt: ‚Ich spiel.‘ Und sie hat gespielt.“
„So?“ sagte Klara teilnahmslos.
„Ja“, fuhr die Mutter fort, „und zum Schluß kriegte der Sänger einen Blumenstrauß. Mitten im Winter war das. Der Strauß war von Bernheimers. Und da nimmt der Sänger die Blumen, Rosen waren es, und gibt sie Dora Lilienthal. Und er soll zu ihr gesagt haben, er will sie berühmt machen. Sie war auch sehr schön damals.“
„Und?“ fragte Klara.
Die Mutter strich langsam ihre Haare zurück. „Nichts weiter“, sagte sie. „Er ist nicht mehr gekommen.“
In diesem Augenblick fuhr eine offene Kutsche mit zwei Braunen vorüber. Ein Herr mit einem kleinen weißen Hut saß darin, und auf dem Bock saß der Kutscher.
„Herr Niels“, murmelte die Mutter und schaute dem Gefährt so bewundernd nach, daß Klara fragte: „Is der so was Besonderes?“
„Oh“, sagte die Mutter, „dem gehört die große Druckerei.“ Als Klara sie verständnislos ansah, sagte sie: „Er ist reich. Eine Million, sagt man, hat er. Und nur einen einzigen Sohn. Der erbt einmal alles. Aber der Niels ist ein Freidenker. Alle sagen das.“
Klara zuckte die Achseln. Stefanie hatte nichts von all dem gehört. Sie war solange rückwärts gegangen, um Dora Lilienthal nachzuschauen, bis sie stolperte und hinfiel. Ohne zu weinen stand sie auf. Sie blutete ein wenig an der Stirn und war voller Staub. Die Mutter starrte ratlos auf die kleine Wunde. Klara sagte ärgerlich: „Warum läufst du auch rückwärts.“ Aber sie wischte ihr sorgfältig, fast zärtlich, das Blut von der Stirn und klopfte den Staub aus dem Kleid. Die Mutter holte ein seidenes Taschentuch aus dem Beutel. „Nimm das zum Verbinden“, sagte sie zögernd.
„Ach was“, sagte Klara, „das is zu schade. Und überhaupt is es schon wieder vorbei. Wir halten uns bei sowas nicht auf.“
Die Mutter betrachtete das Taschentuch, dann steckte sie es wieder ein. „Es wird ein Gewitter geben“, sagte sie.
„Scheint so“, murmelte Klara.
Plötzlich flüsterte die Mutter aufgeregt: „Geht schön, Kinder. Klara, kannst du dich nicht ein bißchen gerade halten?“
„Warum?“ fragte Klara.
Die Mutter strich Stefanie rasch die Haare glatt und sagte: „Komm, laß dich schön führen.“
Im nächsten Augenblick kam ein blonder, ziemlich dicker Mann in einem auffallend hellen Anzug auf sie zu und gab der Mutter die Hand.
„Unruhige Zeiten, wie?“ sagte er, ohne auf die Kinder zu achten. Die Mutter schaute ihn angstvoll an und schob nervös ihr Hütchen zurecht.
„Eben ist ein Extrablatt gekommen“, fuhr er fort. „Da, hören Sie: die deutsche Regierung empfiehlt in Wien dringend und nachdrücklich die Annahme des englischen Konferenzvorschlags.“
Sie hörte verständnislos zu. Er klopfte auf die Zeitung und klappte sie zusammen. „Bin neugierig, wie das weitergeht. Man spricht überall davon, daß es jetzt losgeht. Übrigens: wen haben Sie denn heute bei sich?“
„Meine Kinder“, sagte sie hastig und ein wenig zu laut, „Gebt Herrn Doktor Fleckmann die Hand.“ Klara tat, als hätte sie nichts gehört. Stefanie gehorchte. Der junge Mann hob ihr Gesicht mit zwei Fingern hoch und sagte: „Ganz die Mutter. Wird einmal hübsch.“ Schon im Weitergehen sagte er halblaut: „Ich denke, wir sehen uns heute noch.“ Die Mutter sagte ganz leise ja. Dabei nahm sie Stefanie heftig bei der Hand. Klara fragte: „Wer war’n das schon wieder?“
Die Mutter antwortete rasch: „Ach, das is nur Doktor Fleckmann.“
„Das hab ich gehört“, sagte Klara. „Aber was will er denn von dir?“
Die Mutter schaute sie von der Seite an, dann sagte sie langsam: „Was soll er denn von mir wollen? Was du für Fragen stellst!“
Klara drehte sich um und schaute dem Doktor nach. „Dick is der“, sagte sie abfällig, „wie ein fettes Reh.“
Die Mutter schaute sie verblüfft an. Dann sagte sie ärgerlich: „Was du für Ausdrücke hast, pfui. Und überhaupt, das is doch gleichgültig. Die Hauptsache is, er is tüchtig. Er is Teilhaber bei der chemischen Fabrik.“ Plötzlich rief sie laut und gereizt: „Du könntest froh sein, wenn dich mal so einer heiraten täte.“ Dabei wurde sie über und über rot.
Klara lachte kurz. Dann sagte sie: „Ich werde jetzt neun Jahre alt. Aber das kann ich dir heut schon sagen: So einen möcht ich nicht.“ Sie machte eine verächtliche Handbewegung: „Und überhaupt, ich heirate doch nie. Ich werde bucklig.“
Die Mutter schob mit einer nervösen Bewegung ihr Hütchen zurecht. Stefanie schaute verwundert auf sie und Klara. Sie gingen eine Weile stumm nebeneinander, und alle blickten unbehaglich und verstockt vor sich hin.
Endlich sagte die Mutter: „Da is es. Daß ihr mir aber anständig seid.“ Über der Tür stand in einem verstaubten Transparent: Café und Conditorei von Willi und Bertha Kauniger. In der kleinen Conditorei stand ein Mädchen und schnitt Schokoladentorte in Stücke. Ohne aufzublicken, fragte sie: „Was wünscht die gnädige Frau?“
Als die Mutter fragte: „Ist Frau Kauniger im Geschäft?“, hob sie den Kopf, und als sie sah, wer es war, sagte sie kurz und unfreundlich: „Da drin is sie.“
Als Klara sich an der Tür umdrehte, sah sie, wie das Mädchen das Kuchenmesser ableckte und ihnen geringschätzig nachschaute.
Das Café war ein langer schmaler Raum, der in der hinteren Hälfte fast dunkel war. Ganz hinten brannte, obwohl es Nachmittag war, ein schwaches Gaslicht. Ein Kellner lehnte quer über einem Marmortischchen und las die Zeitung. Dabei schlug er ab und zu mit seiner Serviette nach den Fliegen. Es saßen mehrere Leute da, aber es war ganz still. Man konnte denken, sie seien alle eingeschlafen. Als die drei eintraten, klingelte die Türschelle. Der Kellner drehte sich langsam um. Als er sah, wer es war, deutete er mit dem Kopf nach hinten und sagte, ohne sich aufzurichten: „Da hinten is Ihre Schwester.“
Alle Leute schauten ihnen nach, als sie durch das Café gingen. Da, wo das Gaslicht brannte, war die Theke, und hinter der Theke stand neben der großen Nickelkaffeemaschine Tante Bertha. Sie legte mit ihren kurzen dicken Fingern Zuckerstücke auf kleine Tellerchen. Als sie ihre Schwester mit den Kindern sah, sagte sie atemlos: „Aber das sind sie doch wohl nicht …?“
„Ja“, sagte Frau Martin und zog Stefanie näher zu sich, „das sind meine Kinder.“