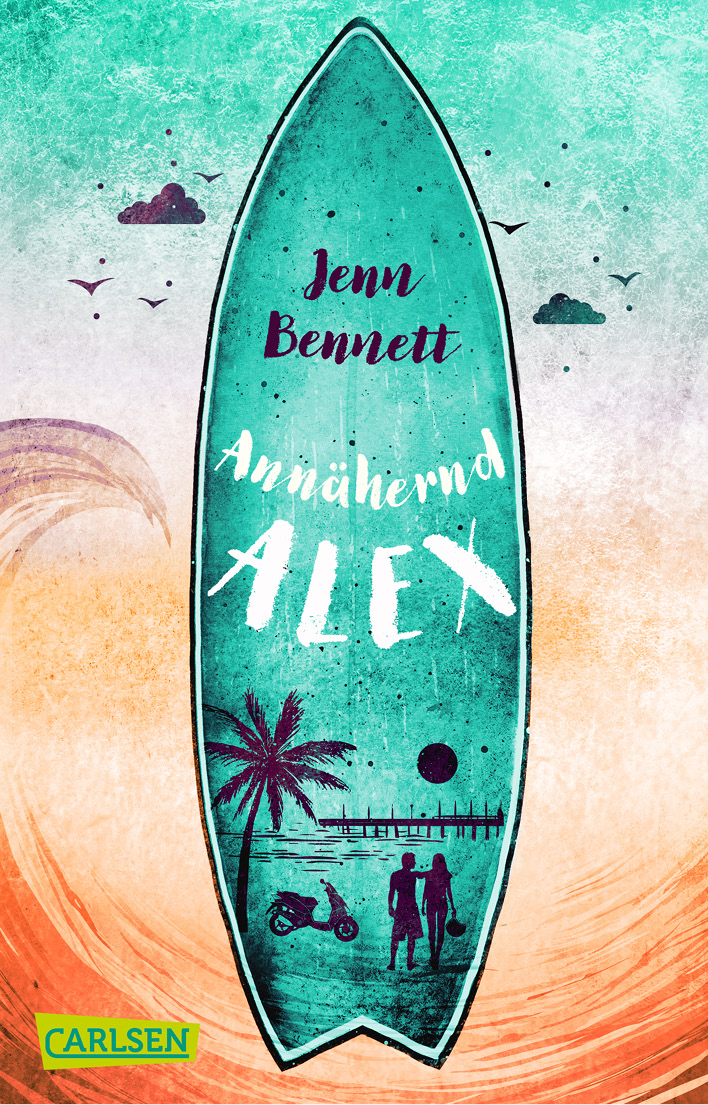»Ich fürchte, ich lasse niemanden an mich ran.
Nimm es nicht persönlich.«
ANNA KENDRICK, PITCH PERFECT (2012)
2
Obwohl ich Dads Bude schon vom Skypen kannte, war es merkwürdig, alles mit eigenen Augen zu sehen. Er wohnt in einer ruhigen schattigen Straße neben einem Wald aus Mammutbäumen und es ist eigentlich eher eine Gartenhütte als ein Haus. Im Erdgeschoss gibt es einen gemauerten Kamin, im Obergeschoss befinden sich zwei kleine Zimmer. Da es früher ein Ferienhaus war, komme ich sogar in den Genuss eines eigenen Bades.
Das Coolste an dem Haus ist der Wintergarten auf der Rückseite, dort gibt es nicht nur eine Hängematte, er ist auch um einen Mammutbaum herumgebaut, der durchs Dach ragt. Was mich allerdings wirklich bei jedem Hinschauen umhaut, ist das, was vor diesem Wintergarten auf einem kleinen Gartenweg steht: eine leuchtend türkisfarbene alte Vespa mit einer Leopardensitzbank.
Ein Motorroller.
Meiner.
Ich und ein Roller.
Huuuuh?
Der kleine Motor und die altmodischen Weißwandreifen schaffen höchstens sechzig Stundenkilometer, aber das Fahrgestell aus den Sechzigern ist komplett überholt.
»Da steht dein Fluchtfahrzeug«, hatte Dad stolz erklärt, als er mich hinters Haus führte und mir den Roller zum ersten Mal zeigte. »Du brauchst schließlich etwas, um diesen Sommer zur Arbeit zu kommen. Im Herbst kannst du dann damit zur Schule fahren. Du benötigst nicht mal einen extra Führerschein dafür.«
»Der ist abgefahren«, sagte ich. Und fantastisch. Aber verrückt. Ich hatte Angst, damit aufzufallen.
»Von den Dingern gibt es Hunderte in der Stadt«, beruhigte er mich. »Ich dachte, entweder Roller oder Bus, aber da du keine Surfbretter herumkutschierst, hielt ich den Roller für praktischer.«
»Er passt super zu einem Artful Dodger«, räumte ich ein.
»Du kannst tun, als wärst du Audrey Hepburn in Ein Herz und eine Krone.«
Tja, mein Vater weiß wirklich, wie er mich kriegt. Ich habe mir diesen Film bestimmt ein Dutzend Mal angesehen und er erinnert sich daran. »Und die altmodische Leopardensitzbank ist richtig genial.«
Genau wie der türkisfarbene Helm. Wegen der Sitzbank habe ich den Roller Baby getauft, sozusagen als Hommage an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Leoparden küsst man nicht – in der Komödie aus den Dreißigern spielen Cary Grant und Katharine Hepburn ein ungleiches Paar, das durch einen zahmen Leoparden namens Baby zusammenkommt. Sobald ich mich für den Namen entschieden hatte, war ich Feuer und Flamme. Nun gab es kein Zurück mehr. Der Roller gehörte mir. Dad zeigte mir, wie man damit fährt, und nach dem Abendessen kurvte ich tausend Mal die Straße hoch und runter und irgendwann brachte ich den Mut auf, in die Stadt zu fahren, und zwar auf Teufel und drogenumnebelte verkehrsblinde Surfer komm raus.
Am nächsten Tag muss Dad arbeiten, wofür er sich bei mir entschuldigt, aber allein zu sein macht mir überhaupt nichts aus. Ich packe meine Sachen aus und fahre mit meinem Roller herum, zwischendurch mache ich in der Wintergartenhängematte ein Nickerchen gegen den Jetlag. Ich schicke Alex ein paar Nachrichten, halte aber weiterhin daran fest, dass sich meine Sommerpläne komplizierter gestalten als angenommen. Vielleicht fällt es mir leichter, ihm zu sagen, wo ich bin, wenn ich mich hier eingewöhnt habe.
Nach einem Tag Ruhe und einem Spieleabend mit Dad, den wir mit Die Siedler von Catan zubringen (unserem Lieblingsbrettspiel), muss ich meine neue Unabhängigkeit unter Beweis stellen. Einen Ferienjob zu finden hat bei meinen Umzugsüberlegungen zu den Dingen gehört, vor denen mir graute, aber Dad hat seine Beziehungen spielenlassen. In D. C. hatte alles noch okay geklungen. Aber jetzt, da ich hier bin, bedaure ich ein bisschen, dass ich eingewilligt habe. Für einen Rückzieher ist es nun allerdings zu spät. »Ferienjobs sind rar hier«, erklärt mir mein Vater fröhlich, als ich herumjammere.
Dad weckt mich superfrüh, bevor er zur Arbeit geht, aber ich schlafe versehentlich wieder ein. Als ich das nächste Mal aufwache, bin ich spät dran, in rasender Eile ziehe ich meine Klamotten an und stürze aus der Tür. Der morgendliche Küstennebel erstaunt mich jeden Tag von neuem. Er hängt wie ein graues Spitzenlaken in den Mammutbäumen und sorgt bis zum späten Vormittag dafür, dass es kühl ist, danach brennt die Sonne ihn weg. Der Nebel mag einen gewissen beschaulichen Reiz haben, aber wenn man wie ich einen Roller durch Dads bewaldetes Viertel lenken muss, könnte man gut darauf verzichten, denn stellenweise hängt er tief und streckt sich wie Finger durch die Äste.
Mit einer Karte bewaffnet und einem Kloß von der Größe Russlands im Magen trete ich dem Nebel mutig entgegen und fahre mit Baby in die Stadt. Mein Vater hat mir den Weg schon mit dem Auto gezeigt, trotzdem wiederhole ich bei jedem Stoppschild stumm die Wegbeschreibung. Da es noch nicht mal neun ist, sind die meisten Straßen leer, das ändert sich allerdings, als ich die gefürchtete Gold Avenue erreiche. Mein Ziel befindet sich nur ein paar Blocks die gewundene verstopfte Straße hinunter, aber ich muss an der Strandpromenade vorbei (Riesenrad, laute Musik, Minigolf) und auf die Touristen aufpassen, die über die Straße zum Strand gehen, nachdem sie sich im Pancake House mit Frühstück vollgestopft haben – das übrigens o-ber-le-cker riecht –, und Hilfe, wo kommen eigentlich all diese Skater her?
Gerade als ich kurz davor bin, irgendeiner Form von stressinduzierter Hirnüberanstrengung zu erliegen, entdecke ich am Ende der Promenade die felsige Küste sowie das Schild: Höhlenpalast.
Mein Ferienjob.
Ich drücke die Handbremsen und lenke Baby langsam in Richtung Mitarbeiterparkplatz. Rechts ist die Hauptzufahrt, die die Klippe hinauf zum Besucherparkplatz führt, der heute jedoch leer ist. »Die Höhle«, wie die Leute hier in der Gegend sie laut Dad nennen, ist wegen der Einführungsveranstaltung und irgendwelcher Arbeiten an den Außenanlagen geschlossen. Da morgen offiziell das Sommergeschäft beginnt, werden heute die neuen Saisonmitarbeiter eingewiesen. Dazu gehöre auch ich.
Dad hat Buchhaltungsarbeiten für die Höhle übernommen und kennt deshalb den Geschäftsführer. So hat er den Job für mich klargemacht. Ansonsten wären sie von meinem dürftigen Lebenslauf, der exakt einen Sommer Babysitten und ein paar Monate Aktensortieren in New Jersey beinhaltet, wohl kaum beeindruckt gewesen.
Doch das ist alles Vergangenheit. Und obwohl ich gerade so nervös bin, dass ich mich über Babys stylishen Retro-Tacho erbrechen könnte, freue ich mich irgendwie auf die Arbeit hier. Ich mag Museen. Sehr.
Folgendes habe ich im Internet über die Höhle erfahren: Vivian und Jay Davenport aus San Francisco wurden reich, als sie während des Ersten Weltkriegs dieses Stück Land für ein Strandhaus erwarben und dreizehn Millionen Dollar in Goldmünzen in einer Höhle in den Klippen entdeckten. Davon baute sich das exzentrische Paar direkt über dem Eingang zur Höhle ein Hundert-Zimmer-Anwesen am Meer und füllte es mit exotischen Antiquitäten, Raritäten und seltsamen Dingen, die es von seinen Weltreisen mitbrachte. In den Zwanzigern und Dreißigern gaben die beiden extravagante alkoholgeschwängerte Partys und brachten reiche Leute aus San Francisco und Hollywood-Starlets zusammen. In den Fünfzigern endete alles in einer Tragödie, Vivian erschoss Jay und beging anschließend Selbstmord. Nachdem das Anwesen zwanzig Jahre leer gestanden hatte, entschieden die Kinder, dass sich das Haus besser nutzen ließ, indem man eine Touristenattraktion daraus machte.
Okay, das ganze Teil ist definitiv total überkandidelt und skurril und die Hälfte der sogenannten Sammlung besteht aus Replikas, aber angeblich birgt es auch einige Erinnerungsstücke an Hollywoods Glanzzeit. Und mal ehrlich, dort zu arbeiten kann einfach nur tausendmal besser sein, als Gerichtsakten zu archivieren.
Der von Hecken verdeckte Mitarbeiterparkplatz befindet sich hinter einem Seitenflügel des Anwesens. Ich schaffe es, Baby in eine Lücke neben einem anderen Roller zu manövrieren, ohne irgendetwas zu demolieren, anschließend wuchte ich den Roller auf den Hauptständer – tadaa! – und schiebe ein Kettenschloss durchs Hinterrad. Mein Helm passt mit Mühe und Not in das Fach unter der verschließbaren Sitzbank; ich bin startklar.
Da ich nicht wusste, welche Kleidung für die Einweisung als angemessen betrachtet wird, trage ich ein Fünfzigerjahre-Sommerkleid mit einer dünnen Strickjacke darüber. Meine Lana-Turner-Wellen scheinen die Fahrt überlebt zu haben und mein Make-up ist auch unversehrt. Als ich ein paar andere in Flipflops und Shorts in eine Seitentür gehen sehe, komme ich mir aufgedonnert vor. Aber nun ist es zu spät, ich folge ihnen ins Gebäude.
An der Tür sitzt hinter einem Empfangstresen eine gelangweilte Frau. Die Gruppe, der ich gefolgt bin, ist nirgendwo zu entdecken, aber an dem Tresen steht ein Mädchen.
»Name?«, fragt die gelangweilte Frau.
Das Mädchen ist zierlich und ungefähr in meinem Alter, sie hat dunkelbraune Haut und kurze schwarze Haare. Auch sie ist viel zu förmlich angezogen und ich fühle mich schon ein wenig besser. »Grace Achebe«, antwortet sie mit der leisesten und hellsten Stimme, die ich je gehört habe. Sie hat einen starken britischen Akzent und spricht so leise, dass die Frau hinter dem Tresen sie zweimal ihren Namen wiederholen lässt. Zweimal.
Schließlich wird sie auf der Liste abgehakt, erhält einen Schnellhefter mit Formularen und wird angewiesen, in den Pausenraum zu gehen. Ich lasse dieselbe Prozedur über mich ergehen. So wie es aussieht, füllen schon zwanzig oder noch mehr Leute Unterlagen aus. Da es keinen freien Tisch mehr gibt, setze ich mich zu Grace.
Sie flüstert: »Du hast hier auch noch nicht gearbeitet, oder?«
»Nein. Ich bin neu«, sage ich und füge hinzu: »In der Stadt.«
Sie wirft einen Blick auf meine Unterlagen. »Oh. Wir sind gleich alt. Brightsea oder Oakdale? Oder privat?«
Ich brauche eine Sekunde, bis ich kapiere, was sie meint. »Ich fange im Herbst auf der Brightsea High School an.«
»Da sind wir schon zwei«, sagt sie mit einem breiten Lächeln und deutet auf die Zeile für Angaben zur Ausbildung. Nachdem ein weiterer Neuer reingekommen ist, erzählt sie mir noch ein paar Sachen über das Museum. »Sie stellen jeden Sommer ungefähr fünfundzwanzig Leute ein. Es soll langweilig sein, aber unstressig. Jedenfalls besser, als rosa Zuckerwattekotze von der Promenade zu schrubben.«
Zweifellos. Ich habe das Anmeldeformular schon online ausgefüllt, aber sie haben uns noch ein Handbuch und ein paar andere seltsame Formblätter gegeben, die wir unterschreiben sollen. Geheimhaltungsverpflichtungen. Die Einwilligung zu stichprobenartigen Drogentests. Eine Versicherung, dass wir das Museums-WLAN nicht benutzen werden, um Pornos anzusehen. Eine Bestätigung, dass unsere Uniform Eigentum des Museums ist.
Grace ist genauso verwirrt wie ich.
»Vergleichbare Tätigkeit?«, murmelt sie und blickt auf einen Passus, in dem wir versprechen, ein Vierteljahr nach unserer Anstellung hier im Umkreis von hundert Kilometern keinen vergleichbaren Job anzunehmen. »Was betrachten die denn als vergleichbaren Job? Ist das überhaupt zulässig?«
»Vermutlich nicht«, flüstere ich zurück und muss an Nate & Partner denken, der meine Mutter ständig mit irgendwelchen juristischen Ratschlägen zutextet, als wäre sie nicht selbst Anwältin.
»Nun ja, das ist rechtlich betrachtet nicht meine Unterschrift«, sagt sie in ihrem hübschen britischen Akzent, wackelt mit den Augenbrauen und setzt ein unleserliches verschlungenes Gekrakel unter das Formular. »Und wenn sie mich nicht genug Stunden arbeiten lassen, gehe ich schnurstracks zur nächsten Höhlenvilla im Umkreis von hundert Kilometern.«
Ich muss laut auflachen, aber als mich alle anschauen, stelle ich das Gekicher lieber ein und wir füllen weiter unsere Formulare aus. Danach bekommen wir einen Spind zugeteilt und erhalten die hässlichsten Westen, die ich je gesehen habe. Die Farbe erinnert an verfaulte Kürbislaternen. Bei der Einweisung bleiben sie uns noch erspart, dafür müssen wir allerdings Hallo, ich heisse …-Aufkleber tragen. Wir werden den Gang im Verwaltungstrakt hinuntergescheucht und anschließend durch eine Stahltür (auf der uns ein Schild zum Lächeln ermahnt) in die Eingangshalle.
Sie ist riesig, wir verdrehen uns die Hälse, als wir uns umsehen, unsere Schritte hallen von den Felswänden wider. Der Eingang zur Höhle befindet sich im hinteren Teil der Halle, die Stalagmiten und Stalaktiten sind orangefarben angestrahlt, was an einen schlechten Gruselfilm erinnert. Man führt uns an einem runden Informationsschalter vorbei, einem Souvenirladen, der nach London, 1890, aussieht, und einem tiefer liegenden Loungebereich mit Sofas, die man für Diebesgut vom Set von Drei Mädchen und drei Jungen halten könnte. Sie haben die gleiche scheußliche Farbe wie unsere Westen. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass das zu einem Konzept gehört.
Ein Mann mittleren Alters begrüßt uns. Er trägt ebenfalls eine Kürbisweste, außerdem eine mit dem Art-déco-Logo des Höhlenpalastes bedruckte Krawatte. Ich frage mich, ob das für die männlichen Angestellten Pflicht ist oder ob er sie sich mit Mitarbeiterrabatt im Souvenirladen gekauft hat. »Ich bin Mr Cavadini, der Personalmanager. Sie werden zwar alle Teamleitern zugeteilt werden, diese sind jedoch mir unterstellt. Ich mache die Dienstpläne und ich unterschreibe Ihre Zeitkarten. Sie sollten mich also als die Person betrachten, die Sie im nächsten Vierteljahr am stärksten beeindrucken wollen.«
Das sagt er mit der Begeisterung eines Bestatters, außerdem bringt er es tatsächlich fertig, während seiner gesamten Ansprache die Stirn zu runzeln. Was natürlich auch damit zu tun haben kann, dass sein dunkelblonder Haaransatz verdammt tief sitzt – als wäre seine Stirn nur halb so hoch, wie sie sein sollte.
»Was für ein jämmerliches Arschloch«, sagt Grace mit ihrer glockenhellen Stimme neben mir auf Schulterhöhe.
Wow. Die süße kleine Grace ist ganz schön vulgär. Aber sie hat Recht. Als Mr Cavadini anfängt, uns einen Vortrag über die Geschichte der Höhle zu halten und dass sie jedes Jahr eine halbe Million Besucher anziehe, schaue ich mich in der Eingangshalle um und sehe mir gründlich die Arbeitsplätze an, an denen ich eingesetzt werden könnte – Infoschalter, Führungen, Fundbüro, Souvenirladen … Ich überlege, in welcher Position ich möglichst wenig mit verärgerten Besuchern zu tun hätte. In meiner Bewerbung hatte ich angekreuzt, dass ich am liebsten »hinter den Kulissen« und »alleine« arbeiten möchte.
Im ersten Stock stehen Cafétische auf einer offenen Galerie und ich hoffe inständig, dass ich nicht in der Gastronomie lande. Andererseits könnte ich im Café nicht nur ein in Originalgröße nachgebautes Piratenschiff anstarren, das von der Decke hängt, sondern auch das Skelett eines Seeungeheuers, das besagtes Schiff angreift. (Unter den »nicht echten« Teil der Davenport’schen Kuriositätensammlung einsortieren.)
Ich bemerke zwei Museumswächter in identischen schwarzen Uniformen, die die freischwebende Schiefertreppe um das Piratenschiff herunterkommen. Ich blinzle und traue meinen Augen nicht. Wie klein ist diese Stadt eigentlich? Einer der Wächter ist der dunkelhaarige Typ, der an meinem Ankunftstag seinen zugedröhnten Freund von der Straße gezogen hat. Ja, das ist ganz eindeutig er: der heiße Surfer mit den Frankensteinnarben auf dem Arm.
Mein Panikpendel schlägt aus.
»Und nun«, sagt Mr Cavadini, »teilen Sie sich in zwei Gruppen auf und schauen sich das Museum mit einem unserer Sicherheitsmitarbeiter an. Diese Seite folgt bitte unserem Senior Security Officer, Jerry Pangborn, der seit der Eröffnung vor vierzig Jahren für den Höhlenpalast arbeitet.«
Er deutet auf einen gebrechlichen alten Mann, dessen weiße Haare abstehen, als hätte er gerade in einem Labor ein Becherglas mit Chemikalien in die Luft gejagt. Er ist total freundlich und nett und könnte vermutlich nicht einmal einen zehnjährigen Rüpel davon abhalten, einen Schokoriegel aus dem Souvenirladen zu klauen. Eifrig führt er sein Team von Rekruten auf die linke Seite der Eingangshalle, zu einem großen Torbogen mit der Aufschrift »Vivians Flügel«.
Den Surferboy winkt Mr Cavadini zu unserer Gruppe. »Und das hier ist Porter Roth. Er arbeitet seit letztem Jahr oder so für uns. Einge von Ihnen haben vielleicht schon mal etwas von seiner Familie gehört«, bemerkt er mit knochentrockener, unbeeindruckter Stimme, die die Vermutung aufkommen lässt, dass er nicht die beste Meinung von der Familie hat. »Sein Großvater war die Surferlegende Bill ›Pennywise‹ Roth.«
Ein leises Ooh geht durch die Menge, aber Mr Cavadini bringt uns mit einer Hand zum Schweigen und weist uns mürrisch an, in zwei Stunden wieder bei ihm zu sein, damit wir eingeteilt werden können. Eine Seite meines Hirns schreit Zwei Stunden? Die andere versucht sich zu erinnern, ob ich schon einmal was von diesem Pennywise Roth gehört habe. Ist er wirklich berühmt oder bloß irgendeine Lokalgröße, die ihre Viertelstunde Ruhm erlebt hat? Das Schild an diesem Pancake House verkündet schließlich auch, die Mandel-Pancakes dort seien weltberühmt, aber wer’s glaubt, wird selig.
Mr Cavadini eilt in den Verwaltungstrakt zurück und lässt uns mit Porter allein, der in aller Ruhe um die Gruppe herumläuft und uns mustert. Er hat einen Stapel Papier zu einem Rohr zusammengerollt, das er beim Laufen gegen sein Bein schlägt. Beim ersten Mal ist es mir nicht aufgefallen, aber sein Gesicht hat so einen hellbraunen Anflug von Dreitagebart – die Art Unrasiertheit, die nach Draufgänger und sexy und aufsässig aussehen soll, die aber zu gut gestutzt ist, um Zufall zu sein. Und dann auch noch diese zerzausten, von der Sonne ausgebleichten braunen Locken, die für einen Surfer ja okay wären, aber bei einem Wachmann viel zu lässig wirken.
Als er näher kommt, wird der Ausweicherin in mir unbehaglich. Ich versuche ruhig zu bleiben und verstecke mich hinter Grace. Aber da sie locker einen halben Kopf kleiner ist als ich – und ich bin schon nur eins fünfundsechzig –, starre ich stattdessen über ihre kurzen Haare hinweg in Porters Gesicht.
Er bleibt vor uns stehen und hält die zusammengerollten Blätter kurz wie ein Teleskop vors Auge.
»Ah, sieh an«, sagt er in seinem coolen kalifornischen Tonfall und grinst. »Da habe ich ja offenbar Glück gehabt und die hübsche Gruppe erwischt. Hallo, Gracie.«
»Hey, Porter«, antwortet Grace mit scheuem Lächeln.
Aha, sie kennen sich also. Ich frage mich, ob Porter derjenige war, der ihr erzählt hat, dass der Job »langweilig, aber unstressig« sei. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mir darüber überhaupt Gedanken mache. Vermutlich habe ich vor allem Angst, dass er sich an mich im Auto erinnert. Ich bete, dass er meinen feigen Quieker nicht gehört hat.
»Wer ist bereit für die Privatführung?«, fragt er.
Keiner antwortet.
»Bloß nicht alle auf einmal.« Er zieht ein Blatt aus der Rolle – ich sehe das Wort »Übersichtskarte für Mitarbeiter« oben auf der Seite – und gibt ihn mir mit einem Blick auf meine Beine. Will er mich anmachen? Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich hätte jetzt jedenfalls gern Hosen an.
Als ich den Plan nehmen will, hält er ihn fest und ich muss zerren. Die Ecke reißt ab. Kindisch, oder? Ich werfe ihm einen giftigen Blick zu, aber er lächelt bloß und beugt sich zu mir. »Na aber«, sagt er. »Du willst doch nicht etwa losschreien wie gestern, oder?«