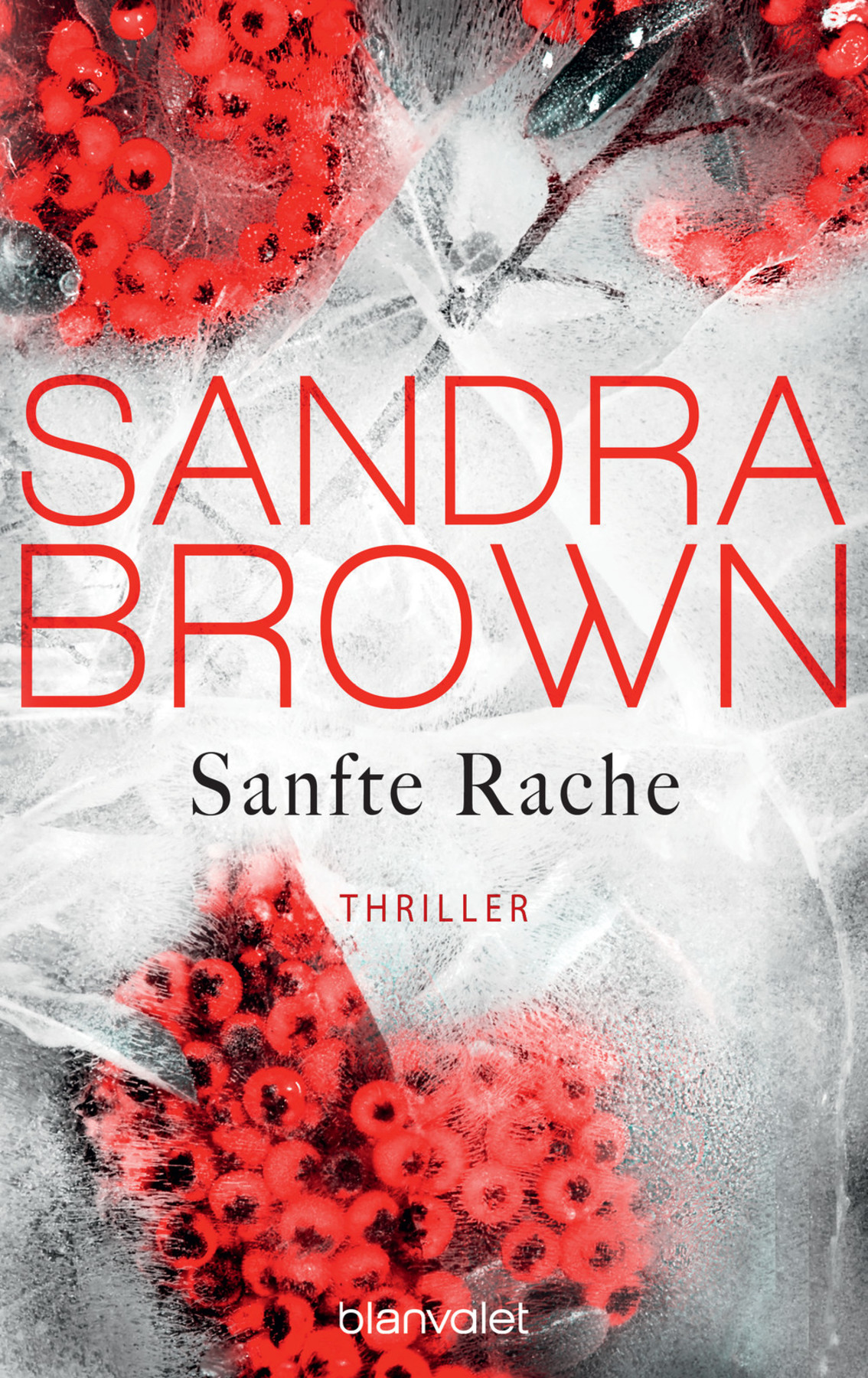
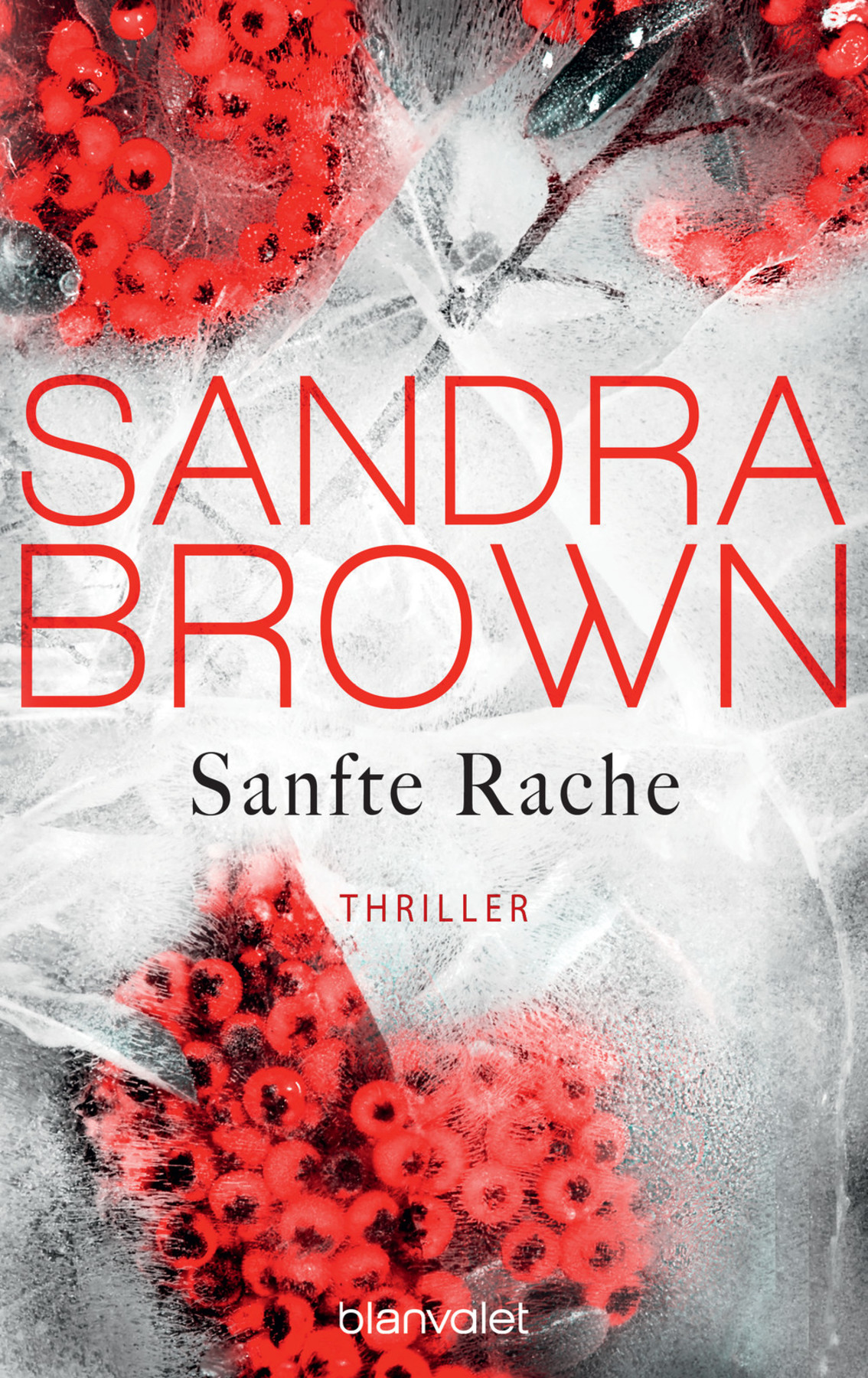
Buch
An einem eisigen Wintermorgen verschwindet die Kinderärztin Emory Charbonneau bei einer Joggingrunde auf einer einsamen Bergstraße spurlos. Als ihr Mann Jeff sie endlich als vermisst meldet, ist die Spur bereits kalt.
Während die Polizei Jeff selbst eines Verbrechens verdächtigt, erwacht Emory in Gefangenschaft eines geheimnisvollen Mannes. Nebel und neuerlicher Schneefall verhindern ihre Flucht. Doch die wahre Bedrohung für ihr Leben scheint nicht von ihrem Entführer auszugehen. Und obwohl sie weiterhin Angst vor ihm hat, sprühen zwischen den beiden bald auch die Funken der Leidenschaft …
Autorin
Sandra Brown arbeitete mit großem Erfolg als Schauspielerin und TV-Journalistin, bevor sie mit ihrem Roman »Trügerischer Spiegel« auf Anhieb einen großen Erfolg landete. Inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten internationalen Autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher die Spitzenplätze der New-York-Times-Bestsellerliste erreicht! Ihren großen Durchbruch als Thrillerautorin feierte Sandra Brown mit dem Roman »Die Zeugin«, der auch in Deutschland auf die Bestsellerlisten kletterte – ein Erfolg, den sie mit jedem neuen Roman noch einmal übertreffen konnte. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Texas und South Carolina.
Weitere Informationen finden Sie auf: www.sandra-brown.de
Von Sandra Brown bereits erschienen (Auswahl)
Envy – Neid ∙ Crush – Gier ∙ Rage – Zorn ∙ Weißglut ∙ Eisnacht ∙ Warnschuss ∙ Ewige Treue ∙ Süßer Tod ∙ Sündige Gier ∙ Blinder Stolz ∙ Böses Herz ∙ Eisige Glut
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sandra Brown
Sanfte Rache
Thriller
Deutsch von Christoph Göhler

Die Originalausgabe erschien 2014
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2014
by Sandra Brown Management, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Leena Flegler
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture /Anja Weber-Decker
LH ∙ Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-17154-4
V002
www.blanvalet.de
Prolog
Emory tat alles weh, sogar das Atmen.
Die feuchte Luft fühlte sich an, als wäre sie mit etwas Unsichtbarem, aber Scharfkantigem angereichert, mit Eiskristallen oder Glassplittern.
Außerdem war sie viel zu dünn angezogen. Wo ihre Haut bloßlag, stach die Kälte erbarmungslos zu, trieb ihr Tränen in die Augen und zwang sie, ständig zu blinzeln, weil andernfalls ihr Blickfeld und der Weg vor ihr verschwommen wären.
Allmählich bekam sie Seitenstechen. Es krallte sich in ihr fest, fraß sich unerbittlich tiefer. Von der Stressfraktur in ihrem rechten Fuß schossen stechende Schmerzen hoch in die Wade.
Doch den Schmerz anzunehmen, ihn quasi zu überlaufen und zu überwinden war eine Frage von schierer Willenskraft und Disziplin. Beides hatte sie, wie man ihr oft versichert hatte. Und zwar reichlich. Im Übermaß. Das hier war genau, worauf ihr aufreibendes Training sie ungeahnterweise vorbereitet hatte. Sie konnte es schaffen. Sie musste …
Weiter, Emory! Immer einen Fuß vor den anderen. Schritt für Schritt die Distanz verkürzen.
Wie weit war es noch?
Bitte, lieber Gott, nicht viel weiter …
Getrieben von eiserner Entschlossenheit und Versagensängsten zog sie das Tempo an.
Dann war aus den tiefen Schatten des nahen Waldes ein Rascheln zu hören, gefolgt von einem Luftstoß in ihrem Rücken. Ihr Herz krampfte sich in einer grausamen Vorahnung zusammen, doch noch ehe sie reagieren konnte, explodierte in ihrem Kopf auch schon ein ganzes Feuerwerk aus Schmerz.
1
»Tut es eher so weh?« Dr. Emory Charbonneau deutete auf die Strichzeichnung eines schmerzverzerrten Kindergesichts mit großen Kullertränen unter den Augen. »Oder eher so?« Diesmal wies sie auf eine andere Zeichnung, auf der ein bekümmertes Gesicht nicht ganz so schlimme Beschwerden illustrierte.
Die Dreijährige deutete auf das schlimmere Bild.
»Das tut mir leid, Liebes!« Emory führte das Otoskop in das rechte Ohr ein. Das Mädchen schrie vor Schmerz auf. Unter gemurmelten Beschwichtigungen und so sanft wie möglich untersuchte Emory erst den einen, dann den anderen Gehörgang. »Beide sind stark infiziert«, erklärte sie der abgekämpften Mutter.
»Sie weint schon, seit sie heute Morgen aufgestanden ist. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass sie Ohrenschmerzen hat. Beim ersten Mal konnte ich nicht zu Ihnen kommen und bin darum mit ihr in die Bereitschaftspraxis gefahren. Die Ärztin dort hat ihr etwas verschrieben, und damit ging es auch vorübergehend weg … Aber jetzt ist es wieder da.«
»Chronische Infektionen können zum Verlust des Gehörs führen. Man sollte sie nicht erst behandeln, wenn sie schon aufgetreten sind, sondern besser von vornherein vermeiden. Vielleicht sollten Sie mit ihr in eine pädiatrische Hals-Nasen-Ohren-Klinik gehen.«
»Das hab ich ja versucht! Aber wo immer ich angerufen habe, werden keine neuen Patienten mehr aufgenommen.«
»Ich könnte Sie an eine der besten vermitteln …« Das war keine leere Prahlerei. Emory war sich sicher, dass gleich mehrere ihrer Kollegen klaglos jeden Patienten aufnehmen würden, den sie überwies. »Am besten lassen wir der Infektion sechs Wochen Zeit, um auszuheilen. Danach vereinbare ich einen Termin für Ihre Tochter. Vorerst verschreibe ich ihr ein Antibiotikum und dazu ein Antihistamin, um den Flüssigkeitsstau hinter dem Trommelfell aufzulösen. Sie können ihr ein Kinder-Schmerzmittel geben, aber die Schmerzen sollten eigentlich vergehen, sobald die Therapie anschlägt. Zwingen Sie sie nicht zum Essen, aber achten Sie darauf, dass sie genügend trinkt. Falls es ihr in ein paar Tagen nicht besser geht oder wenn sie plötzlich hohes Fieber bekommen sollte, rufen Sie die Nummer auf dieser Karte an. Ich bin übers Wochenende nicht da, aber der Kollege vertritt mich. Ich glaube allerdings nicht, dass es zu einem Notfall kommt. Doch selbst wenn, sind Sie bei ihm in besten Händen, bis ich wieder da bin.«
»Danke, Dr. Charbonneau.«
Sie lächelte die Mutter mitfühlend an. »Ein krankes Kind ist wirklich kein Vergnügen. Versuchen Sie, auch selbst etwas Ruhe zu finden.«
»Hoffentlich haben wenigstens Sie am Wochenende etwas Schönes vor.«
»Ich mache einen Zwanzig-Meilen-Lauf.«
»Das klingt nach einer Tortur!«
Sie lächelte. »Genau darum geht es.«
Emory füllte das Rezept aus und trug den Befund in die Patientenakte ein. Als sie beides an den Empfangstresen brachte, erklärte ihr die junge Arzthelferin: »Das war Ihre letzte Patientin für heute.«
»Sehr gut. Ich bin praktisch schon weg.«
»Haben Sie im Krankenhaus Bescheid gesagt?«
Sie nickte. »Und beim Telefonservice. Ich bin ab sofort offiziell im Wochenende. Haben Dr. Butler und Dr. James gerade Patienten in Behandlung?«
»Ja. Und für beide sitzen noch mehrere im Wartezimmer.«
»Ich wollte mich eigentlich noch schnell von ihnen verabschieden, aber dann will ich lieber nicht stören.«
»Dr. Butler hat Ihnen eine Nachricht hinterlassen.«
Sie reichte ihr ein Blatt von einem Notizblock mit Monogramm. Hals- und Beinbruch – oder was wünscht man einer Marathonläuferin? Mit einem Lächeln faltete Emory die Notiz zusammen und steckte sie in die Tasche ihres Arztkittels.
»Und von Dr. James soll ich Ihnen ausrichten«, fuhr die Arzthelferin fort, »dass Sie sich vor den Bären in Acht nehmen sollen.«
Emory lachte. »Wissen unsere Patienten, dass sie bei zwei Clowns in Behandlung sind? Grüßen Sie die beiden von mir!«
»Mach ich. Guten Lauf!«
»Danke. Wir sehen uns am Montag.«
»Ach, das hätte ich fast vergessen – Ihr Mann lässt ausrichten, dass er schon auf dem Heimweg ist und rechtzeitig nach Hause kommt, um Sie zu verabschieden.«
»Emory?«
»Hier …«
Als Jeff ins Schlafzimmer trat, zog sie gerade den Reißverschluss ihrer Reisetasche zu, hob sie mit trotziger Entschlossenheit vom Bett und hängte sich den Riemen über die Schulter.
»Hast du meine Nachricht bekommen? Ich wollte nicht, dass du losfährst, ohne dass ich mich von dir verabschieden kann.«
»Ich wollte dem Feierabendverkehr zuvorkommen …«
»Gute Idee.« Er sah sie kurz an und stellte dann fest: »Du bist immer noch wütend.«
»Du nicht?«
»Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde.«
Der Streit vom Vorabend war beiden noch gut in Erinnerung. Die in Zorn und Verbitterung ausgestoßenen Worte schienen selbst jetzt noch von den Wänden des Schlafzimmers widerzuhallen – Stunden nachdem sie zu Bett gegangen waren, einander die Rücken zugekehrt und in der gegenseitigen Feindseligkeit dagelegen hatten, die gestern offen ausgebrochen war, nachdem sie zuvor monatelang vor sich hin geschwelt hatte.
»Bekomme ich wenigstens ein paar Punkte gutgeschrieben, weil ich heimgekommen bin, um Auf Wiedersehen zu sagen?«
»Kommt darauf an.«
»Worauf?«
»Ob du dir Hoffnungen machst, mich noch umstimmen zu können.« Als er mit einem Seufzer den Blick abwandte, fuhr sie fort: »Dachte ich mir.«
»Emory …«
»Du hättest bis Feierabend im Büro bleiben sollen. Weil ich fahren werde, Jeff. Und ganz ehrlich: Selbst wenn ich morgen nicht laufen wollte, würde ich mir eine Auszeit nehmen. Eine Nacht in getrennten Betten wird uns dabei helfen, unsere Gemüter ein bisschen abzukühlen. Falls der Lauf zu anstrengend werden sollte, übernachte ich eventuell auch morgen noch dort.«
»Eine Nacht oder zwei ändern nichts an meiner Meinung. Diese Zwanghaftigkeit, mit der du …«
»Genauso hat es gestern Abend auch angefangen. Ich werde diesen Streit jetzt nicht noch einmal aufwärmen.«
Ihr Trainingsprogramm für den bevorstehenden Marathon hatte den Zwist ausgelöst, aber insgeheim fürchtete sie, dass wesentlich gewichtigere Gründe dahintersteckten. Das Problem war nicht der Marathon … sondern ihre Ehe.
Und genau darum wollte sie wegfahren und nachdenken. »Ich hab dir die Adresse des Motels aufgeschrieben, in dem ich übernachte.« Im Vorbeigehen nickte sie auf den Zettel hinunter, den sie auf der Frühstückstheke abgelegt hatte.
»Ruf mich an, wenn du angekommen bist. Nur damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist.«
»Meinetwegen.« Sie setzte sich die Sonnenbrille auf und öffnete die Tür zum Garten. »Bis dann.«
»Emory?«
Mit einem Fuß auf der Schwelle drehte sie sich um. Er beugte sich zu ihr herunter und gab ihr einen zaghaften Kuss. »Pass auf dich auf.«
»Jeff? Hi. Ich bin jetzt da.«
Die zweistündige Autofahrt von Atlanta hierher war ermüdend gewesen, aber dass Emory so erschöpft war, schrieb sie eher dem Stress als der Fahrt selbst zu. Etwa eine Stunde nördlich der Stadt war sie von der Interstate 85 auf eine Stichstraße in Richtung Nordwesten abgebogen, und sofort hatte der Verkehr erheblich abgenommen. Sie hatte ihr Ziel noch vor Einbruch der Dunkelheit erreicht, was ihr die Orientierung in dem unbekannten Ort ein wenig erleichtert hatte. Doch obwohl sie inzwischen zugedeckt in ihrem Motelbett lag, saß ihr die Anspannung noch immer hartnäckig zwischen den Schulterblättern.
Um sie nicht noch zu verstärken, hatte sie mit dem Gedanken gespielt, Jeff gar nicht erst anzurufen. Der Streit vom Vorabend war bloß ein erstes Scharmützel gewesen. Sie ahnte, dass ihnen beiden eine noch viel größere Auseinandersetzung bevorstand, und die wollte sie lieber fair als kleingeistig führen.
Aber ganz abgesehen davon hätte sie sich schreckliche Sorgen um ihn gemacht, wenn es andersherum gewesen wäre: wenn er und nicht sie selbst weggefahren wäre und dann nicht wie versprochen angerufen hätte.
»Bist du schon im Bett?«, fragte er.
»Kurz vor dem Einschlafen. Ich will morgen früh los.«
»Wie ist das Hotel?«
»Einfach, aber sauber.«
»Ich finde es bedenklich, wenn ›sauber‹ als Vorzug hervorgehoben werden muss.« Er wartete kurz ab, als würde er auf ihr Lachen warten. Als keines kam, fragte er, wie die Fahrt gewesen sei.
»Ganz okay.«
»Und das Wetter?«
Blieb ihnen jetzt allen Ernstes nur mehr das Wetter als Thema? »Kalt. Aber damit hatte ich gerechnet. Wenn ich erst mal losgelaufen bin, wird mir schon warm werden.«
»Ich halte das alles immer noch für irrsinnig …«
»Ich hab mir die Strecke eingezeichnet, Jeff. Ich komme schon zurecht. Und ich freue mich aufs Laufen.«
Als sie aus dem Auto stieg, war ihr sofort klar, dass es deutlich kälter war, als sie gedacht hatte.
Natürlich lag der Aussichtspunkt viel höher als Drakeland – jener Ort, in dem sie übernachtet hatte. Die Sonne war zwar bereits aufgegangen, versteckte sich allerdings hinter den Wolken, die ringsherum die Berggipfel verhüllten.
Hier oben würde der Zwanzig-Meilen-Lauf eine echte Herausforderung werden.
Während sie ihre Dehnübungen absolvierte, ließ sie sich die äußeren Bedingungen durch den Kopf gehen. Trotz der Kälte war es ein perfekter Tag zum Laufen. Der Wind war wirklich zu vernachlässigen. In den Wäldern rundum schwankten nur die Baumwipfel in der leichten Brise.
Allerdings beschlug die Sonnenbrille von den Dampfwölkchen, die sie ausatmete. Sie zog den Rollkragen ihrer Laufjacke über Mund und Nase, ehe sie einen letzten Blick auf ihre Streckenkarte warf.
Der Parkplatz war für Touristen angelegt worden, die den nahen Aussichtspunkt erklimmen wollten. Gleichzeitig diente er als Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege, die von hier aus sternförmig in alle Richtungen verliefen und sich über gewundene Bergpfade und dann kreuz und quer über die Berghänge verzweigten. Die Namen der einzelnen Wanderrouten standen auf pfeilförmigen Wegweisern.
Sie wandte sich dem Weg zu, für den sie sich entschieden hatte, nachdem sie die Karte des Nationalparks ausgiebig studiert und sich zusätzlich im Internet schlaugemacht hatte. Sosehr sie Herausforderungen liebte, sie war schließlich nicht lebensmüde. Wenn sie nicht sicher gewesen wäre, dass sie es bis zum Wendepunkt des Laufs und wieder zurück schaffte, hätte sie sich gar nicht erst für den Start entschieden. So aber wirkte das ungastliche Terrain nicht einschüchternd, sondern im Gegenteil vielversprechend.
Sie schloss ihre Reisetasche im Kofferraum des Wagens ein und schnallte sich die Gürteltasche um. Dann zog sie ihr Stirnband zurecht, stellte den Timer auf ihrer Armbanduhr auf null, streifte Handschuhe über und lief los.
2
Nach und nach kam Emory wieder zu sich. Aus Angst, dass jeder einfallende Lichtstrahl ihre mörderischen Kopfschmerzen verschlimmern könnte, ließ sie die Augen geschlossen. Die Schmerzen hatten sie aus dem Tiefschlaf gerissen und fühlten sich an, als würde in ihrem Schädel jemand mit einer Nagelpistole um sich schießen. Sie hörte ein Geräusch, das normalerweise nicht in ihrem Schlafzimmer zu hören war, aber so neugierig, dass sie die Augen aufgeschlagen hätte, konnte sie gar nicht sein.
Neben den stechenden Schmerzen in ihrem Kopf spürte sie ein dumpfes Pochen in ihrem rechten Fuß. Den hatte sie am Morgen definitiv überstrapaziert.
Essensgeruch schlug ihr auf den Magen.
Warum in aller Welt roch es im Schlafzimmer nach Essen, wo doch die Küche am anderen Ende des Hauses lag? Was immer Jeff auch kochen mochte …
Aber Jeff kochte nicht.
Sie riss die Augen auf, sah nichts, was sie wiedererkannt hätte, und setzte sich abrupt auf.
Erst verschwamm die unbekannte Szenerie ihr vor den Augen, dann begann sie sich zu drehen. Ätzende Magensäure stieg ihr in den Mund. Ehe sie ihr über die Lippen laufen konnte, würgte sie sie mühsam hinunter. Ihr war so schwindlig, dass sie sich wieder auf das Kissen legen musste – das, wie sie jetzt erkannte, nicht ihr Kissen war.
Und der Mann, der neben ihrem Bett stand, war nicht Jeff.
»Wer sind Sie?«, keuchte sie.
Er machte einen Schritt auf sie zu.
»Bleiben Sie mir vom Leib!« Sie hob abwehrend die Hand, auch wenn ihr klar war, dass sie ihn so unmöglich würde zurückhalten können. Sie war hilflos wie ein neugeborenes Baby. Und er war riesig.
Trotzdem blieb er auf ihren Befehl hin stehen. »Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich werde Ihnen nichts tun.«
»Wer sind Sie? Wo bin ich?«
»In Sicherheit.«
Das würde sich erst zeigen müssen. Ihr Atem ging flach und hektisch, das Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie zwang sich, Ruhe zu bewahren, denn in Panik zu geraten würde ihr mit Sicherheit nicht weiterhelfen.
»Wie fühlen Sie sich?« Seine Stimme klang tief und irgendwie eingerostet, als hätte er sie länger nicht mehr gebraucht.
Sie starrte ihn wortlos an, versuchte, die unzusammenhängenden Eindrücke zu sortieren und eine Erklärung dafür zu finden, wo sie war und warum sie sich an diesem Ort befand.
»Wie geht’s dem Kopf?« Er nickte knapp zu ihr herüber.
Behutsam berührte sie die Stelle, die er gemeint haben musste, und stöhnte auf, als ihre Fingerspitzen eine dicke Beule hinter ihrem linken Ohr ertasteten – es war ein Gefühl, als hätte sie mit einem Vorschlaghammer gegen einen Gong geschlagen. Schmerzwellen brandeten durch ihren Kopf. Ihre Haare waren verklebt und blutig und die Fingerspitzen rot, als Emory auf sie hinabblickte. Da erst entdeckte sie auch das Blut auf dem Kopfkissenbezug.
»Was ist passiert?«
»Wissen Sie das nicht mehr?«
Sie versuchte verzweifelt, sich zu erinnern. »Ich weiß noch, dass ich laufen war … Bin ich gestürzt?«
»Ich dachte, das könnten Sie mir vielleicht sagen.«
Sie wollte den Kopf schütteln, doch schon bei dem Versuch explodierte in ihrem Kopf sonnenheißer Schmerz, und ihr wurde speiübel. »Wie bin ich hergekommen?«
»Ich hab Sie durch mein Fernglas beobachtet.«
Er hatte sie durch ein Fernglas beobachtet? Das hörte sich alles andere als beruhigend an. »Von wo aus?«
»Von einem anderen Bergkamm aus … Aber dann hab ich Sie aus dem Blick verloren und dachte, ich sollte lieber mal nachsehen. Als ich Sie fand, lagen Sie bewusstlos am Boden. Also hab ich Sie mitgenommen und hier heraufgetragen.«
»Und wo genau sind wir hier?«
Mit einer Geste lud er sie dazu ein, sich umzusehen.
Jede Kopfbewegung ging mit neuerlichen Höllenqualen einher. Trotzdem stemmte sie sich auf die Ellbogen. Nachdem sie dem Schwindelgefühl ein paar Sekunden Zeit gegeben hatte, wieder abzuflauen, studierte sie ihre Umgebung, hielt insgeheim aber hauptsächlich nach einem möglichen Fluchtweg Ausschau, falls sie später einen brauchen sollte.
Vier Fenster. Eine einzige Tür. Genau genommen handelte es sich um einen einzigen Raum.
Das Bett, auf dem sie lag, stand in der Ecke. An der Wand aus grob zugehauenen Fichtenstämmen lehnte ein zusammengefalteter Sichtschutz aus Holzlamellen, mit dem wahrscheinlich der Schlafbereich vom Rest des Raums abgetrennt wurde. Zum Mobiliar gehörten außerdem ein brauner Ledersessel und ein dazu passendes Sofa. Beide wiesen Falten, Risse und Kratzer auf, die von jahrzehntelangem Gebrauch zeugten. Dazwischen stand ein Couchtisch und darauf eine Lampe mit einem Schirm aus Jute. Unter dem Ensemble lag ein rechteckiger Teppich mit eingefasstem Saum.
Die Kochecke war zum Raum hin offen. Sie bestand aus einer Spüle, einem schmalen Herd, einem altmodischen Kühlschrank und einem Ahorntisch mit zwei olivgrün lackierten Küchenstühlen mit Sprossenlehne. Eine weitere Wand wurde fast komplett von einem riesigen offenen Kamin eingenommen. Es war das Knistern des Feuers gewesen, das sie beim Aufwachen nicht hatte zuordnen können.
Er hatte ihr Zeit gelassen, den Raum ausgiebig in Augenschein zu nehmen. »Nur eine Ihrer Wasserflaschen war leer«, sagte er dann. »Sie müssen doch durstig sein.«
Ihr Mund war wie ausgetrocknet, aber das war jetzt nicht das Wichtigste. »Ich war bewusstlos, als Sie mich fanden?«, erkundigte sie sich.
»Vollkommen ausgeknockt. Ich hab mehrmals versucht, Sie aufzuwecken.«
»Und wie lang war ich weg?«
»Ich hab Sie gegen halb acht heute Morgen gefunden.«
Sie sah auf ihre Armbanduhr und stellte fest, dass es bereits zwanzig nach sechs am Abend war. Sie strampelte sich die Decke von den Füßen, hob die Beine über die Bettkante und stand auf. Augenblicklich geriet sie ins Wanken.
»Whoa!«
Er packte sie an beiden Oberarmen. Dass er sie anfasste, behagte ihr nicht, aber hätte er es nicht getan, wäre sie vornüber auf den Boden gekracht. Behutsam schob er sie aufs Bett zurück. Ihr Kopf fühlte sich an, als würde er jeden Moment bersten. Ihr Magen rebellierte. Kurz hielt sie sich die Augen zu, weil alles in ihrem Blickfeld fast wie in einem Spiegelkabinett abwechselnd auf sie zuschwebte und wieder zurückwich.
»Möchten Sie sich wieder hinlegen, oder können Sie sitzen bleiben?«, fragte er.
»Ich sitze lieber.«
Behutsam ließ er ihre Arme los und machte einen Schritt zurück. Dann wandte er sich um zur Küche und nahm einen großen Krug Wasser aus dem Kühlschrank, schenkte ein Glas voll und hielt es ihr hin.
Misstrauisch sah sie darauf hinab. Sie konnte sich schließlich nicht sicher sein, ob er sie zuvor nicht unter Drogen gesetzt hatte. K.-o.-Tropfen waren geruchlos, geschmacksneutral – und effektiv. Nicht genug, dass sie das Opfer wehrlos machten: Sie löschten auch jede Erinnerung aus. Aber wenn dieser Mann wirklich Böses im Sinn gehabt hätte, weshalb hätte er sie dann unter Drogen setzen sollen, obwohl sie doch ohnehin bewusstlos gewesen war?
»Ich hab vorhin versucht, Ihnen ein bisschen Wasser einzuflößen«, sagte er. »Aber Sie haben nur gewürgt und es wieder ausgespuckt.«
Was auch erklärte, warum ihr Oberteil feucht war. Bis auf Jacke, Handschuhe und Stirnband war sie vollständig bekleidet. Die Laufschuhe hatte er ihr ausgezogen und sie akkurat nebeneinander vor das Bett gestellt. Sie sah erst die Schuhe an, dann wieder den Mann, der ihr das Wasserglas hinstreckte. »Ich hab mit Sicherheit eine Gehirnerschütterung.«
»Das hab ich mir auch gedacht, als ich Sie nicht aufwecken konnte.«
»Und ich blute am Kopf.«
»Nicht mehr. Die Wunde hat sich schon wieder geschlossen. Ich hab sie allerdings ein paarmal mit Peroxid abgetupft. Darum wirkt das Blut an Ihren Fingern frisch.«
»Womöglich muss sie genäht werden.«
»Sie hat ordentlich geblutet, aber sie ist nicht besonders tief.«
Hatte er diese Diagnose selbst gestellt? Warum? »Weshalb haben Sie keinen Notarzt gerufen?«
»Hier oben findet uns so bald keiner. Außerdem kann ich für die Qualität der hiesigen Rettungsdienste nicht bürgen. Ich hielt es für das Beste, Sie erst mal herzubringen und ausschlafen zu lassen.«
Da war sie anderer Meinung. Jeder, der einen Schlag auf den Kopf abbekommen hatte, sollte sich von einem Arzt untersuchen lassen. Doch für eine solche Diskussion fehlte ihr die Kraft. Erst musste sie sich orientieren und wieder einen halbwegs klaren Kopf bekommen.
Sie nahm das Wasserglas entgegen. »Danke.«
Obwohl sie schrecklichen Durst hatte, nippte sie bloß kurz daran. Sie befürchtete, dass sie sich würde übergeben müssen, wenn sie zu schnell tränke. Inzwischen hatte sie nicht mehr ganz so viel Angst, zumindest raste ihr Herz nicht mehr annähernd so schnell, und auch ihr Atem ging beinahe wieder normal. Sie würde alsbald ihren Blutdruck messen – wie gut, dass sie die Fitnessuhr noch trug –, aber noch fühlte sie sich dem nicht gewachsen. Sie musste das Wasserglas mit aller Kraft umklammern, um es ruhig in der Hand zu halten. Offenbar war ihm das aufgefallen.
»Schwindlig?«
»Und wie.«
»Kopfschmerzen?«
»Schlimmer, als Sie glauben.«
»Ich hatte selbst mal eine Gehirnerschütterung. Ich kam damals mit schlimmen Kopfschmerzen davon, aber die waren wirklich höllisch.«
»Allzu schwer wird sie nicht sein. Mein Blickfeld verschwimmt zwar noch ein wenig, aber ich weiß immerhin, welches Jahr wir haben und wie der Vizepräsident heißt.«
»Da wissen Sie mehr als ich.«
Womöglich hatte er bloß einen Witz machen wollen, aber weder in seinem Tonfall noch in seinem Gesichtsausdruck konnte sie so etwas wie Humor entdecken. Er machte nicht den Eindruck, als würde er oft und spontan lachen … wenn überhaupt jemals.
Sie nahm noch einen kleinen Schluck und stellte dann das Glas auf dem Tischchen ab. »Danke für Ihre Gastfreundschaft, Mr. …«
»Emory Charbonneau.«
Sie sah überrascht zu ihm auf.
Er deutete zum Fußende des Betts. Erst jetzt bemerkte sie, dass dort ihre Gürteltasche und der Rest ihrer Sachen lagen. Der Bügel ihrer Sonnenbrille war abgeknickt. Und er war blutverschmiert.
»Ihr Name steht in Ihrem Führerschein«, sagte er. »Der in Georgia ausgestellt wurde. Wobei sich Ihr Name eher nach Louisiana anhört.«
»Ursprünglich komme ich aus Baton Rouge.«
»Wie lange leben Sie schon in Atlanta?«
Offenbar hatte er auch ihre Adresse ausfindig gemacht. »So lange, dass ich mich hier heimisch fühle. Aber wo wir gerade davon reden …« Weil sie sich nicht zutraute, schon wieder aufzustehen, rutschte sie an der Bettkante entlang, bis sie ihre Gürteltasche zu fassen bekam. Darin lagen neben zwei Wasserflaschen – einer leeren und einer vollen – zwei Zwanzig-Dollar-Scheine, eine Kreditkarte, ihr Führerschein, die Karte mit der eingezeichneten Laufstrecke sowie – im Augenblick am allerwichtigsten – ihr Handy.
»Was wollten Sie dort oben überhaupt?«, fragte er. »Außer laufen …«
»Genau das wollte ich – laufen.« Nachdem sie zum dritten Mal erfolglos versucht hatte, ihr Handy einzuschalten, stieß sie einen leisen Fluch aus. »Ich glaube, mein Akku hat den Geist aufgegeben. Kann ich mir Ihr Ladegerät ausleihen?«
»Ich hab kein Handy.«
Wer hat denn bitte kein Handy? »Könnte ich dann vielleicht Ihr Festnetztelefon benutzen? Ich bezahl auch …«
»Es gibt hier kein Telefon. Tut mir leid.«
Ihr blieb der Mund offen stehen. »Kein Telefon?«
Er zuckte mit den Schultern. »Hab niemanden zum Anrufen. Und niemanden, der mich anruft.«
Die Panik, die sie zuvor mit reiner Willenskraft unterdrückt hatte, packte sie jetzt umso heftiger. Die Erkenntnis, dass sie der Gnade dieses Fremden ausgeliefert war, verlieh der bis dahin lediglich verwirrenden Situation etwas extrem Beängstigendes. Sofort geisterten Geschichten von verschollenen Frauen durch ihren schmerzenden Schädel. Oft erfuhren deren Familien nie, was ihnen zugestoßen war: ob ein religiöser Fanatiker sie zwangsverheiratet oder irgendein Perverser sie im Keller angekettet hatte, sie hungern ließ und auf unvorstellbare Weise folterte …
Erneut musste sie mühsam die aufsteigende Übelkeit hinunterschlucken. So ruhig wie überhaupt nur möglich fuhr sie fort: »Aber Sie haben doch bestimmt ein Auto.«
»Einen Pick-up.«
»Könnten Sie mich bitte zu meinem Auto fahren?«
»Könnte ich, aber es …«
»Ich kann’s mir schon denken. Der Tank ist leer.«
»Nein, Benzin hab ich genug.«
»Was dann?«
»Ich kann Sie nicht runterfahren.«
»Runter?«
»Vom Berg.«
»Und warum nicht?«
Er wollte schon nach ihrer Hand greifen, doch sofort riss sie sie zurück. Ein wenig verärgert runzelte er die Stirn, ging dann zur Tür und zog sie auf.
Emorys Angst schlug um in Verzweiflung. Behutsam und immer mit einer Hand an einem Möbelstück, um nicht umzufallen, arbeitete sie sich quer durch den Raum und stellte sich zu ihm an die Tür. Es war, als hätte jemand einen dicken grauen Vorhang über den Türsturz genagelt.
Der Nebel war so undurchdringlich, dass sie jenseits der Schwelle nur ein paar Handbreit weit sehen konnte.
»Hat sich heute am frühen Nachmittag breitgemacht«, erklärte er. »Sie können von Glück sagen, dass ich heute Morgen draußen war. Sonst hätten Sie dort draußen festgesessen, wenn Sie irgendwann aufgewacht wären.«
»Stattdessen sitze ich hier fest.«
»Sieht ganz so aus.«
»Aber das muss nicht so bleiben.« Als sie tief durchatmete, klang es wie ein Keuchen und fühlte sich genauso an. »Ich gebe Ihnen Geld, wenn Sie mich fahren.«
Er blickte über seine Schulter auf die Gürteltasche, die immer noch offen auf dem Bett lag. »Für vierzig Mäuse? Auf keinen Fall.«
»Sie können selbstverständlich mehr haben. Wenn Sie mich nach Hause bringen, bekommen Sie den Rest.«
Energisch schüttelte er den Kopf. »Nicht dass ich an Ihrer Zahlungsbereitschaft zweifeln würde. Trotzdem könnte mich kein Geld der Welt dazu bringen. Hier oben sind die Straßen schmal und kurvig und die Abhänge verdammt steil. Leitplanken gibt es so gut wie keine. Ich werde weder Ihr Leben noch mein eigenes riskieren und schon gar nicht meinen Pick-up.«
»Was ist mit Ihren Nachbarn?«
Er sah sie verständnislos an.
»Nachbarn. Hier wohnt doch sicher jemand in der Nähe, der ein Telefon hat. Sie könnten rübergehen …«
»Hier wohnt niemand in der Nähe.«
Als wollte sie mit einem Zaunpfahl diskutieren. Oder mit einem Telefonmast. »Ich muss meinem Mann Bescheid geben, dass ich wohlauf bin.«
»Morgen vielleicht …« Er sah zum Himmel, obwohl es dort absolut nichts zu sehen gab. »Je nachdem, wie schnell sich der Nebel wieder verzieht.« Er schob die Tür ins Schloss. »Sie zittern. Stellen Sie sich ans Feuer. Falls Sie zur Toilette müssen …« Er deutete auf eine schmale Tür am anderen Ende des Raums, gleich neben dem Bett. »Es kann da drin ziemlich kalt werden, aber ich hab für Sie den Heizstrahler eingeschaltet.« Er trat an den Herd, auf dem ein simmernder Topf stand. »Sind Sie hungrig?« Er hob den Deckel an und rührte den Inhalt des Topfes um.
Dass er ihre Zwangslage derart mit Gleichgültigkeit quittierte, verblüffte sie. Machte ihr Angst. Und es machte sie wütend.
»Ich kann doch nicht bis morgen früh hierbleiben!«
In ihrer Stimme schwang ein Hauch von Hysterie mit, doch er blieb völlig ungerührt, klopfte lediglich den tropfenden Löffel über dem Topfrand ab, legte ihn auf einen Unterteller und setzte den Deckel wieder auf den Topf. Erst dann drehte er sich zu ihr um und deutete zur Tür. »Sie haben es doch selbst gesehen. Sie haben keine Wahl.«
»Man hat immer eine Wahl.«
Sekundenlang wandte er das Gesicht ab. Als sich ihre Blicke wieder trafen, sagte er: »Nicht immer.«
Weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, blieb sie einfach stehen und sah zu, wie er den Tisch für eine Person deckte. Noch einmal fragte er, ob sie hungrig sei.
»Nein. Mir ist speiübel.«
»Ich hab mit dem Essen extra auf Sie gewartet, aber wenn Sie nichts möchten, stört es Sie hoffentlich nicht, wenn ich etwas esse?«
Sie nahm ihm zwar nicht ab, dass ihn ihre Antwort interessierte, trotzdem forderte sie ihn höflich auf anzufangen.
»Ich hätte da was gegen Ihre Kopfschmerzen. Und eine Cola, um Ihren Magen zu beruhigen. Vielleicht sollten Sie sich aber auch einfach wieder hinlegen.«
Im Liegen würde sie sich noch verletzlicher fühlen. »Ich setze mich lieber.« Auf wackligen Beinen taumelte sie zum Esstisch. Dann fiel ihr ein, dass an ihren Fingern noch das Blut von der Kopfwunde klebte. »Ich muss mir die Hände waschen.«
»Setzen Sie sich hin, sonst fallen Sie noch um!«
Dankbar ließ sie sich auf einen Stuhl sinken. Er brachte ihr eine Plastikflasche mit Desinfektionsmittel, von dem sie sich großzügig bediente. Dann griff sie nach der Küchenrolle auf dem Tisch und tupfte sich mit dem Papier die Hände trocken.
Ohne zu zögern, nahm er ihr das blutfleckige Papiertuch ab und warf es in den Müll, trat an die Spüle und wusch sich dort die Hände mit heißem Wasser und Flüssigseife. Dann öffnete er eine Coladose, brachte sie zusammen mit einem Fläschchen rezeptfreier Schmerztabletten an den Tisch und ging dann eine Packung Salzcracker und ein noch eingepacktes Stück Butter holen. Am Herd schöpfte er eine Portion Eintopf in eine Steingutschüssel.
Schließlich nahm er ihr gegenüber Platz, riss ein Papiertuch von der Rolle ab, legte es sich auf den Schoß und griff zum Löffel. »Ich finde es furchtbar, Ihnen etwas vorzuessen …«
»Bitte.«
Während er anfing, den Eintopf zu löffeln, bemerkte er, wie sie den Inhalt seiner Schüssel begutachtete. »Wahrscheinlich nicht Ihre übliche Kost …«
»Zu jedem anderen Zeitpunkt fände ich es verlockend. Rinderstew gehört zu meinen Leibspeisen.«
»Das ist Hirsch.«
Sie sah zu dem Hirschkopf empor, der über dem Kamin an der Wand hing.
Er konnte also doch lächeln. Und tat es auch. »Nicht dieser Hirsch. Der hing schon dort, als ich hier eingezogen bin.«
»Eingezogen? Sie wohnen also fest hier? Ich dachte …« Sie ließ den Blick durch den kargen Raum mit den wenigen Annehmlichkeiten wandern und hoffte, ihn nicht zu beleidigen: »Ich dachte, das hier wäre ein Wochenendhaus, eine Jagdhütte vielleicht. Nur eine vorübergehende Unterkunft.«
»Nein.«
»Und wie lange wohnen Sie schon hier?«
Mit aufgestützten Ellbogen beugte er sich über seine Schüssel und murmelte eher in den Eintopf als zu ihr: »Seit etwa sechs Monaten.«
»Seit sechs Monaten. Ohne jedes Telefon? Und was tun Sie in einem Notfall?«
»Keine Ahnung. Bis jetzt gab es keinen.«
Er riss die Packung mit den Crackern auf, nahm zwei heraus und bestrich sie mit Butter. Den einen aß er aus der Hand, den anderen ließ er in seinen Eintopf fallen und zerteilte ihn dort mit dem Löffel, bevor er den nächsten Bissen nahm.
Angespannt, aber nicht minder neugierig beobachtete sie ihn. Das Papiertuch hatte er auf seinem Schoß abgelegt wie eine Leinenserviette, aber er aß mit aufgestützten Ellbogen. Er hatte die Butter mitsamt Papierverpackung auf den Tisch gestellt und einen Cracker in seinen Eintopf gebröselt. Gleichzeitig tupfte er sich nach jedem Bissen den Mund ab.
Er lebte in einer altmodischen Blockhütte, aber wie ein Hinterwäldler sah er nicht aus. Nicht wirklich. Er war unrasiert, aber die Stoppeln waren höchstens ein, zwei Tage alt. Er trug ein schwarz-rot kariertes Flanellhemd, das in ausgeblichenen Bluejeans steckte, aber die Sachen waren sauber. Seine dunkelbraunen Haare reichten ihm hinten bis über den Kragen und waren damit länger als sonst bei Männern seines Alters. An den Schläfen waren sie von grauen Strähnen durchzogen. Bei einem anderen Mann hätte das distinguiert gewirkt. Ihn ließen sie älter aussehen, als er wahrscheinlich war. Sie schätzte ihn auf Ende dreißig. Trotzdem schien sein Gesicht vom Leben gezeichnet zu sein. Dafür sprachen die Faltengeflechte in den Augenwinkeln, die tiefen Kerben zu beiden Seiten der Mundwinkel und die argwöhnische Wachsamkeit in seinen strahlend blauen Augen. Die Farbe stand in auffälligem Kontrast zu der sonnengebräunten, windgegerbten Haut.
Sie war verwirrt. Er führte zwar ein rustikales Leben, hatte weder Telefon noch Fernsehen, aber er wusste sich zu benehmen und auszudrücken. Auf den Regalen, die an die Holzwände montiert worden waren, standen ordentlich aufgereiht Dutzende Bücher – zum Teil gebunden, zum Teil Taschenbücher.
In der Hütte herrschte eine penible Ordnung: kein einziges Foto, kein Krimskrams, keine Souvenirs – nichts, was irgendwie Aufschluss über seine Vergangenheit oder auch seine Gegenwart gegeben hätte.
Sie traute seiner lockeren Art nicht und erst recht nicht seiner Erklärung, warum er sie nicht in ein Krankenhaus gebracht hatte. Noch einfacher wäre es gewesen, einen Krankenwagen zu rufen. Wenn er das gewollt hätte.
Niemand las ohne Grund eine ohnmächtige, blutende Frau auf und schleifte sie in eine abgelegene Berghütte, wo es weit und breit keine Nachbarn gab, und ihr wollte kein Grund einfallen, der nichts mit irgendeiner Form von Kriminalität oder Perversion – oder mit beidem – zu tun hatte.
Er hatte sich ihr zwar bisher nicht ansatzweise auf unsittliche Art genähert, aber vielleicht gab es ja Psychopathen, die sich nicht an ihren Opfern vergehen wollten, solange sie bewusstlos waren. Vielleicht bevorzugte er sie wach und bei vollem Bewusstsein, damit sie auf seine Quälereien reagieren konnten.
»Sind wir hier überhaupt noch in North Carolina?«, fragte sie nach einer Weile.
»Ja.«
»Ich frage nur, weil manche dieser Wege hier im Park auch nach Tennessee führen.«
Ihr war wieder eingefallen, dass sie den Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, ihre Dehnübungen absolviert und ihre Gürteltasche umgeschnallt hatte. Sie konnte sich sogar noch daran erinnern, wie sie losgelaufen war, wie still der Wald zu beiden Seiten des Weges gewesen und wie die kalte Luft zusehends dünn geworden war, je höher sie sich vorgearbeitet hatte. Aber sie hatte keine Erinnerung mehr daran, gestürzt zu sein oder sich den Kopf so fest angeschlagen zu haben, dass sie eine Gehirnerschütterung davongetragen hatte. Und deshalb fragte sie sich auch, ob es tatsächlich so geschehen war.
Sie nahm sich einen Cracker und trank einen Schluck Cola in der Hoffnung, dass die Kombination ihren nervösen Magen beruhigte. »Wie hoch sind wir hier?«
»Knapp über fünfzehnhundert Meter«, erwiderte er. »Kein einfaches Gelände für einen Lauf.«
»Ich trainiere für einen Marathon.«
Er hielt mit dem Essen inne und sah sie interessiert an. »Ihren ersten?«
»Den fünften.«
»Hmm. Und Sie arbeiten an Ihrer Zeit?«
»Immer.«
»Sie testen also Ihr Limit.«
»So sehe ich das nicht. Es macht wirklich Spaß.«
»Ein Langstreckenlauf in dieser Höhe ist ziemlich anstrengend.«
»Ja, aber dafür fällt es einem hinterher umso leichter, auf normaler Höhe zu laufen.«
»Und Sie haben keine Angst, sich zu überanstrengen?«
»Ich passe auf. Vor allem auf meinen rechten Fuß. Letztes Jahr hatte ich eine Stressfraktur …«
»Kein Wunder, dass Sie ihn schonen.«
Sie sah ihn scharf an. »Woher wollen Sie das wissen?«
»Ist mir aufgefallen, als Sie vom Bett zur Tür gehumpelt sind.«
Möglich, dachte sie. Oder war ihm das schon aufgefallen, als er sie durch den Feldstecher beobachtet hatte? Aus wie großer Entfernung überhaupt? Von einer anderen Bergkuppe aus, wie er behauptete – oder doch aus der Nähe?
Fürs Erste behielt sie diese Frage noch für sich. Stattdessen versuchte sie weiter, ihm ein paar Informationen zu entlocken. »Letztes Jahr nach Boston hat der Fuß angefangen zu mucken. Der Orthopäde hat mir geraten, drei Monate zu pausieren. Es war schrecklich für mich, nicht mehr laufen zu dürfen, aber ich hab mich an die Anordnung gehalten. Erst als er mir grünes Licht gegeben hat, hab ich wieder angefangen zu trainieren.«
»Und wann ist der Marathon?«
»In neun Tagen.«
»In neun Tagen …«
»Ja, ich weiß.« Sie seufzte. »Diese Gehirnerschütterung kommt zu einem ausgesprochen unglücklichen Zeitpunkt.«
»Vielleicht werden Sie aussetzen müssen.«
»Das kann ich nicht. Ich muss mitlaufen.«
Er sah sie nur stumm an.
»Es ist ein Wohltätigkeitslauf – und ich hab ihn mitorganisiert. Die Leute zählen auf mich.«
Wieder führte er den Löffel zum Mund, kaute und schluckte, bevor er weitersprach: »In Ihrem Führerschein steht Dr. Emory Charbonneau. Sind Sie Ärztin?«
»Kinderärztin. Ich arbeite in einer Gemeinschaftspraxis mit zwei Gynäkologen und Geburtshelfern.«
»Sie übernehmen die Babys, sobald sie rausgekommen sind?«
»So war’s geplant, als wir die Praxis gegründet haben.«
»Haben Sie eigene Kinder?«
Sie zögerte und schüttelte dann den Kopf. »Irgendwann hoffentlich.«
»Was ist mit Mr. Charbonneau? Ist er auch Arzt?«
»Mr. Surrey.«
»Verzeihung?«
»Mein Mann heißt Jeff Surrey. Als wir geheiratet haben, war ich bereits Dr. Charbonneau. Ich hielt es aus beruflichen Gründen für das Beste, meinen Namen zu behalten.«
Er äußerte sich nicht dazu, runzelte aber die Brauen. »Und womit verdient er sein Geld?«
»Er ist Vermögensverwalter. Investments, Futures …«
»Was für die Reichen.«
»Ich nehme an, dass einige seiner Klienten durchaus vermögend sind.«
»Aber Sie wissen es nicht?«
»Er spricht nicht über die Angelegenheiten seiner Klienten. Auch nicht mit mir.«
»Richtig. Natürlich nicht.«
Sie biss erneut in den Cracker. »Und was ist mit Ihnen?«
»Was soll mit mir sein?«
»Was machen Sie so?«
Er sah sie an und antwortete ernst: »Leben.«