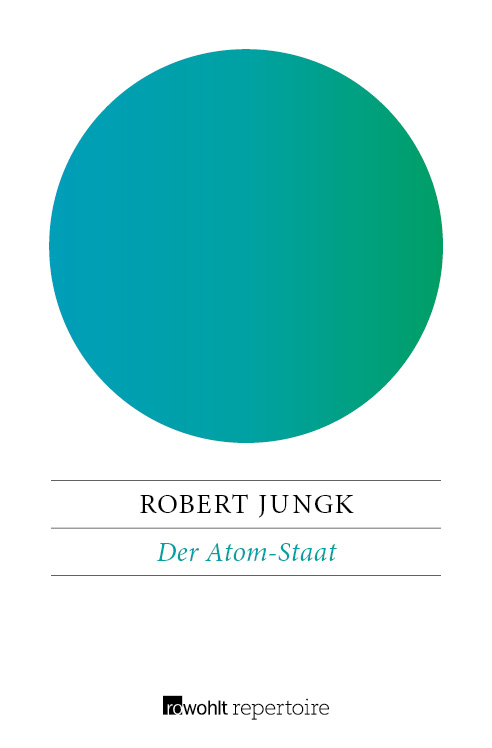
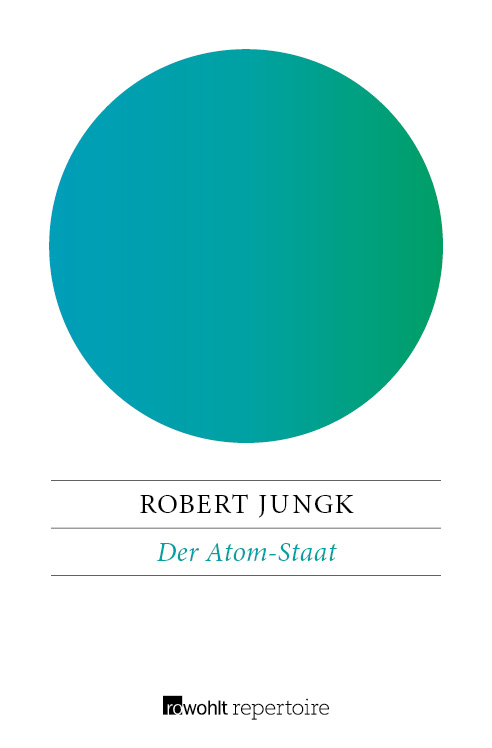
Robert Jungk, 1913 in Berlin geboren, arbeitete nach 1933 in Frankreich und im republikanischen Spanien an Dokumentarfilmen und schrieb von 1940 bis 1945 für die «Weltwoche» in Zürich. Das Thema, das er in «Die Zukunft hat schon begonnen» anschlug, wurde später in «Heller als tausend Sonnen» (1956) und «Strahlen aus der Asche» (1959) vertieft, international berühmten Büchern, die eindringlich vor den Gefahren der entfesselten Atomkraft warnen.
Sein 1973 veröffentlichtes Buch «Der Jahrtausendmensch» führte 1975 zur Gründung einer «Fondation pour l'invention sociale», die Ansätze zu einer humaneren Technologie und Gesellschaft koordinieren und fördern soll.
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
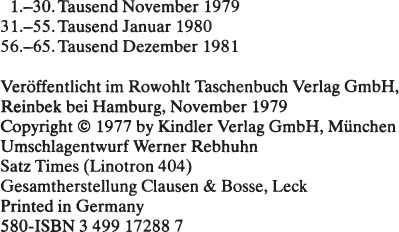
ISBN Printausgabe 978-3-499-17288-5
ISBN E-Book 978-3-688-10046-0
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-10046-0
Ich habe Philip Pahner nach Abfassung meines Manuskripts aufspüren können. Er arbeitet heute in einer Klinik für seelisch geschädigte Kinder an der Universität von Kalifornien in Los Angeles.
1979 mußte die NRC fünf Kernkraftwerke schließen lassen, weil es sich herausstellte, daß die Computer-Simulationen künftiger Belastungen fehlerhaft waren.
Häfele verlangte in einem im Frühjahr 1979 dem Schwedischen Fernsehen gegebenen Interview ausdrücklich Gehorsam und Disziplin der Bürger als Voraussetzung weiterer Entwicklung.
Am 18. Mai 1979 erhielten die Eltern von Karin Silkwood nach einem jahrelangen Rechtsstreit von einem Gericht in Oklahoma City 10,5 Millionen Dollar Schadenersatz und Schmerzengeld zugesprochen. Die Plutoniumfabrik in Cimarron wurde von der Gesundheitspolizei geschlossen: ein Sieg des Rechtsstaates gegen den beginnenden «Atomstaat», der die Untersuchungen von Amts wegen zu behindern versucht hatte.
Da ich nicht bereit war (und bin) die Namen meiner Informanten preiszugeben, verstieg sich die Geschäftsführung von Karlsruhe, die gebe es gar nicht. Erst nachdem auch andere dieser «nichtexistierenden» Forscher im Vertrauen gesprochen hatten – ein Vorgang, der der Direktion nicht verborgen blieb – hörten diese Verleumdungen auf.
Die Abtrennung des Plutoniums müßte allerdings dann noch in – notfalls primitiven – Wiederaufarbeitungsanlagen erfolgen.
Für Eugen Kogon
Mit der technischen Nutzbarmachung der Kernspaltung wurde der Sprung in eine ganz neue Dimension der Gewalt gewagt. Zuerst richtete sie sich nur gegen militärische Gegner. Heute gefährdet sie die eigenen Bürger. Denn «Atome für den Frieden» unterscheiden sich prinzipiell nicht von «Atomen für den Krieg». Die erklärte Absicht, sie nur zu konstruktiven Zwecken zu benutzen, ändert nichts an dem lebensfeindlichen Charakter der neuen Energie. Die Bemühungen, diese Risiken zu beherrschen, können die Gefährdungen nur zu einem Teil steuern. Selbst die Befürworter müssen zugeben, daß es niemals gelingen wird, sie ganz auszuschließen. Der je nach Einstellung als kleiner oder größer anzustehende Rest von Unsicherheit birgt unter Umständen solch immenses Unheil, daß jeder bis dahin vielleicht gewonnene Nutzen daneben verblassen muß.
Eine durch technisches Versagen, menschliche Unzulänglichkeit oder böswillige Einwirkung hervorgerufene Atomkatastrophe würde nicht nur unmittelbar größten Schaden stiften, sondern über Jahrzehnte, Jahrhunderte, unter Umständen sogar Jahrtausende weiterwirken. Dieser Griff in die Zukunft, die Angst vor den Folgeschäden der außer Kontrolle geratenen Kernkraft wird zur größten denkbaren Belastung der Menschheit: sei es als Giftspur, die unauslöschlich bleibt, sei es auch nur als Schatten einer Sorge, die niemals weichen wird.
Solch dunkle Möglichkeiten müssen auch den Befürwortern der Atomindustrie bekannt sein. Sie sind allerdings überzeugt, sich und ihre Mitbürger schützen zu können, indem sie Sicherheitsmaßnahmen einführen, wie sie es nie zuvor gab. Müßte dieser Schutz nur technischer Natur sein, dann wäre er vor allem ein Problem der Ingenieure und – wegen seiner besonders hohen Kosten – der Ökonomen. Aber diese Erfindung der Menschen muß ja zudem so streng wie keine andere vor den Menschen selbst bewahrt werden: vor ihren Irrtümern, ihren Schwächen, ihrem Ärger, ihrer List, ihrer Machtgier, ihrem Haß. Wollte man versuchen, die Kernkraftanlagen dagegen völlig immun zu machen, so wäre die unausweichliche Folge ein Leben voll von Verboten, Überprüfungen und Zwängen, die in der Größe der unbedingt zu vermeidenden Gefahren ihre Rechtfertigung suchen würden. Diese Konsequenzen darzustellen und über sie nachzudenken ist für die Gesellschaft wie für den einzelnen dringlich, da die Beschäftigung mit den sozialen und politischen Wirkungen der Kernkraft bisher hinter dem Studium der biologischen und ökologischen Effekte zurückstand. Diese Schrift will dazu den Anstoß geben. Sie ist in Angst und Zorn geschrieben. In Angst um den drohenden Verlust von Freiheit und Menschlichkeit. In Zorn gegen jene, die bereit sind, diese höchsten Güter für Gewinn und Konsum aufzugeben. Man wird mit Sicherheit den Einwand erheben, über diese Problematik müsse ohne Emotionen geschrieben und gesprochen werden. Das ist die heutige Version der biedermeierlichen Beschwichtigung: «Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.» Wer den Ungeheuerlichkeiten, die der Eintritt in die Plutoniumszukunft mit sich bringen muß, nur mit kühlem Verstand, ohne Mitgefühl, Furcht und Erregung begegnet, wirkt an ihrer Verharmlosung mit. Es gibt Situationen, in denen die Kraft der Gefühle mithelfen muß, einer Entwicklung zu steuern und das zu verhindern, was nüchterne, aber falsche Berechnung in Gang gesetzt hat.
Auf solch irriger Kalkulation beruhte die Vorstellung, daß die zerstörerische Wirkung der Atombombe – wenn überhaupt – nur in Auseinandersetzungen zwischen Staaten ins Spiel gebracht werden würde. Seit kurzem aber müssen wir auf Grund eingehender Untersuchungen annehmen, daß auch innergesellschaftliche Konflikte die gefürchtete «nukleare Schwelle» einmal überschreiten könnten: Atomsabotage und Atomterror können nicht mehr ausgeschlossen werden, sobald die Menge der bei der Kernkraftproduktion anfallenden Spaltstoffe immer größer wird. Und das wird schon sehr bald der Fall sein. Besonders erschreckend ist die Einsicht, daß Gangster, Putschisten oder Terroristen mit einer solchen Waffe, wenn sie einmal in ihre Hände geriete, vermutlich viel skrupelloser umgehen würden als Staatsmänner und Generalstäbler. Die radikale Atomabrüstung, die unmittelbar nach den Schreckensstunden von Hiroshima und Nagasaki verlangt wurde, müßte jetzt, da die Ausweitung der «friedlichen Kernkraft» das Risiko von Atom-Bürgerkriegen näherbringt, mit noch weitaus berechtigterer Sorge gefordert werden.
Nur wer sich Illusionen über die nukleare Zukunft hingibt, kann alle Gefahren des Mißbrauchs ausschließen. Die Vision von der perfekten inneren Sicherheit ist ein pures Wunschgebilde. Vielleicht wird es im Namen dieser unerreichbaren Vorstellung gelingen, die Atomindustrie-Staaten in Konzentrationslager zu verwandeln, aber Gewißheit gegen den Einsatz nuklearer Erpressung und Gewalt könnte auch dann niemand geben. Staaten dürfen ja in diesem Zusammenhang nicht nur Erpressungsversuche von außen, sondern müssen auch Putschversuche von innen ins Kalkül ziehen. In Garnisons-Gesellschaften ist die Chance innerer Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen stets zu befürchten. Irgendwann einmal wird irgendeine mit dem nuklearen «Objektschutz» betraute Wachmannschaft mit dem «letzten Mittel» drohen. Wer kann solch mächtige Kontrolleure noch wirksam kontrollieren? In harten Regimes mit harten Machern an den Hebeln der Macht werden die Sicherheitsrisiken nur anfangs geringer, mit der Zeit aber erfahrungsgemäß größer. Der «harte Weg» der Tyrannen hat noch stets ins Unglück geführt. Diesmal könnte es eine nicht mehr gutzumachende Katastrophe sein.
Amory B. Lovins ist ein sensibler, intellektueller junger Amerikaner, der wie ein Bücherwurm aussieht, aber einen Teil des Jahres irgendwo in der Nordostecke der USA als Waldläufer lebt. Kein wohlbestallter Professor und noch nicht einmal dreißig Jahre alt, erreichte er es, daß die hochangesehene Zeitschrift Foreign Affairs im Herbst 1976 seinen Aufsatz über den Irrweg der Kernenergie veröffentlichte. Die Fachwelt nahm ihn von Anfang an sehr ernst. Seither reist dieses seriöse «Wunderkind» kreuz und quer durch die Welt, um führende Konzernmanager, hohe Regierungsbeamte – wie zum Beispiel US-Präsident Carter und Kaliforniens Gouverneur Brown – und wissenschaftliche Experten davon zu überzeugen, daß sie den «harten Weg» der ständig steigenden Energieraten verlassen sollten. Er versucht ihnen zu demonstrieren, daß die von diesen Instituten gebieterisch verkündeten Bedarfszahlen für elektrische Nutzungsenergie keiner echten Notwendigkeit entsprechen, sondern die zahlgewordenen Projektionen ihrer eigenen Wünsche, Hoffnungen und Ängste sind.
Falsche Prognosen, gestellt auf Grund falscher Berechnungen und Zielsetzungen, haben nach Lovins’ Ansicht den «Atomrausch» der sechziger Jahre ausgelöst. Der wird, wie er meint, im Katzenjammer enden, weil die ehrgeizigen Energiepläne der Nuklearindustrie und ihrer Lobby aus wirtschaftlichen, technischen und politischen Gründen nicht in Erfüllung gehen können.
Aber Lovins sagt nicht nur «nein». Er zeichnet den allmählichen Übergang zu einem «sanften Weg», geht ein auf die wirklichen und so oft vernachlässigten menschlichen Bedürfnisse; plädiert für die bessere Ausnutzung konventioneller und die gleichzeitige Entwicklung unschädlicher, dezentralisierter «alternativer Energie». Durch die Abschaffung der Großzentralen könnte, wie er seinen Gesprächspartnern und Lesern vorrechnet, die Zahl der Arbeitsplätze bei gleichzeitigem Abbau der Rationalisierung vervielfacht werden. Kleine und mittlere Betriebe erhielten dann endlich wieder eine Chance gegenüber den Großkonzernen; es wäre möglich, das Lebensniveau der entwickelten und weniger entwickelten Länder einander anzunähern und den Bürgern in überschaubaren wirtschaftlichen und politischen Einrichtungen mehr Mitsprache zu sichern. All das könnte allerdings nur «gegen die Interessen einiger mächtiger Institutionen» geschehen.
Sieht man die industrielle und politische Entwicklung der letzten hundert Jahre im Licht des Gegensatzes zwischen einem «harten Weg», der von immer mehr Gesellschaftssystemen gewählt wurde, und einem «sanften Weg», der als rückständig in Verruf gerät, dann wird etwas sehr Gravierendes deutlich: Die Entscheidung für die Kernenergie war die logische Folge einer Technologiepolitik, die das Wachstum der Produktion rücksichtslos über alle anderen menschlichen Interessen stellte.
Am Kampf gegen die Kernkraft nehmen weltweit Menschen aller Schichten teil, die Stress, Naturzerstörung und Katastrophengefahren, wie sie von dem gesamten System einer eskalierenden technischen Gewalt ausgehen, nicht mehr hinnehmen wollen. Der «harte Weg» ist zugleich auf einem Höhepunkt und einer Bruchstelle angelangt.
Er hat – so erkennt man jetzt – zur Konzentration der Macht in den Händen weniger Personen geführt, zu einer wachsenden Kluft zwischen «Reichen», die ihres Reichtums nicht froh werden, und Armen, die verarmen, weil sie sich nicht einmal mehr selber helfen können. Es ist ein Weg, der immer tiefer in Entfremdung, Kälte, Isolation und Feindschaft hineinführt.
Jene, die diesen Kurs unbeirrt weiterverfolgen, wollen nicht hören, nicht sehen, nicht nachgeben. Ja, sie sind sogar noch stolz auf ihre Unnachgiebigkeit. Bei denen aber, die stürmisch danach drängen, sich Gehör zu verschaffen, und die oft mit Gewalt daran gehindert werden, gibt es immer mehr, die Härte mit Härte bekämpfen wollen. Nicht nur die Umwelt, auch das politische und gesellschaftliche Klima wird durch die Einführung der Kernenergie zunehmend vergiftet.
Daß die sogenannten «sozialistischen Länder» den sogenannten «kapitalistischen Ländern» auf dem «harten Weg» gefolgt sind, ist deshalb so besonders bedenklich, weil dort – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nicht einmal Stimmen des Zweifels an der eingeschlagenen Richtung, die zu einer Kurskorrektur führen könnten, laut werden dürfen. Die Konvergenz der Systeme, von der im Westen soviel gesprochen wurde, wird sich vielleicht auf eine ganz andere Weise verwirklichen, als man angenommen hatte. Nämlich in der allmählichen Anpassung der seit der Einführung der Kernenergie immer mehr zum «harten Weg» tendierenden westlichen Staaten an Zwangsmethoden, wie sie im Osten seit langem praktiziert werden. Schon jetzt hört man aus dem Mund von westlichen Atombefürwortern Worte der Bewunderung für die «Disziplin dort drüben».
In der «freien Welt» ist bereits ein deutlicher Rückgang der Toleranz, die Zunahme von direkter oder indirekter Zensur, die Verketzerung von «Dissidenten», aber auch eine spürbare Verschärfung und Erweiterung der Überwachung in Beruf und Privatleben festzustellen. Viele meinen, das seien hoffentlich nur «vorübergehende Maßnahmen». Das ist ein falscher Trost. Denn ein Land, das seine Atomindustrie ausbaut, wählt damit den «starken Staat» in Permanenz.
Man muß die Frage stellen, ob die Entscheidung der Machteliten in den Industriestaaten für die Kernenergie nicht sogar vorwiegend von der Erwartung mitbestimmt wird, daß sie damit erst die materiellen Grundlagen für die Berechtigung ihrer «harten Politik», ihres «harten Weges» und ihren «harten Regierungsstil» schaffen: wer da dann nicht «mitzieht», ist schlechthin «subversiv».
Staat und Wirtschaft sollen immer mehr einer großen Maschine gleichen, und es kann nicht gestattet werden, daß man ihr Funktionieren stört. Das verlangt der «Sachzwang». Einzelne oder gar Gruppen, die sich widersetzen könnten, werden «gesiebt», «zermalmt», «ausgerottet», «auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen», als «rückständig» angeprangert oder – das Wort stammt von einem Professor der Informationstechnik – «amputiert». Hinzu kommt, daß der Export von Kernenergie in Länder der Dritten Welt bereits bestehende autoritäre Staatsformen noch verstärkt, die Hoffnungen auf eine allmähliche Demokratisierung zunichte macht und die Landflucht fördert. Da Kernenergie sich wirtschaftlich nur dann lohnt, wenn man sie in großen Zentralen produziert und von einem Mittelpunkt aus verteilt, wird das Wachstum der bereits heute allzu stark aufgeblähten Industriemetropolen in den Entwicklungsländern begünstigt. Denn dort sind viele «Kunden» auf einem Platz zusammen. Die Belieferung der Dörfer würde aber die Installation ausgedehnter und kostspieliger Verteilernetze bedeuten. Deshalb kommt zum Beispiel bisher nur ein Bruchteil des in den indischen Reaktoren erzeugten Stroms der Landbevölkerung zugute, die ihn doch am meisten braucht.
Andererseits begünstigen die Pläne der Atomindustrie, den gefährlichen und gefährdeten Brennstoffkreislauf künftig auf wenige «Nuklearparks» mit hoher Leistung zu konzentrieren, das Heranwachsen eines Kernkraft-Imperialismus: mehr und mehr heute noch unabhängige Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika sollen dann in der kommenden zweiten oder dritten Phase des Atomausbaus an die «Energiekette» genommen werden.
Dafür wird den Herrschenden in den Atomstaaten der Dritten Welt eine schreckliche Möglichkeit zugespielt, die der amerikanische Politologe Albert Wohlstetter kürzlich bei einem öffentlichen «Hearing» in England erwähnte. Er sagte, «Regierungen könnten (nukleare) Implosionswaffen von Kilotonnengröße oder größerer Stärke als verzweifelte letzte Drohung sogar gegen die Bevölkerung gebrauchen». Der «harte Weg» würde also möglicherweise schließlich bis zu dieser äußersten Konsequenz führen.
So schlimm ist es noch nicht? In der Tat: Wäre die Entwicklung schon überall so weit gediehen, könnten diese Zeilen nicht mehr veröffentlicht werden. Aber die Anfänge sind bereits sichtbar: Die totalitäre Technokraten-«Zukunft hat schon begonnen». Noch gibt es hier und dort die Chance, ihre Durchsetzung zu verhindern. Doch die Zeit dafür ist knapp bemessen.
Eine Besonderheit der Atomentwicklung besteht darin, daß sie anfänglich zwar nur schwer, aber von einem gewissen Augenblick ab unmöglich rückgängig gemacht werden kann. Dieses Phänomen der «Irreversibilität» ist eine ganz neue historische Erscheinung. Ist ein Reaktor einmal «angefahren», dann werden damit Prozesse in Gang gesetzt, die man auf lange Zeiten hin nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Generationenlang andauernde radioaktive Zerfallsvorgänge mit ihren Strahlengefahren für alles Lebendige müssen von da an sorgfältigst und in Permanenz kontrolliert werden. Jahrzehnte-, jahrhunderte-, jahrtausendelang. Überschreitet die Zahl zu bewachender Installationen und Entsorgungslager einen bestimmten Punkt, so muß strenge «Überwachung» und «Kontrolle» über einen sehr langen Zeitraum hinweg das politische Klima prägen.
Darum ist die Entscheidung, vor der wir heute stehen, von so weitreichender Bedeutung wie keine andere zuvor. Sie kann nicht, wie das bisher mit allen früheren Taten der Geschichte immer noch möglich war, revidiert oder gar vergessen werden. Sie legt den weiteren Verlauf unseres Schicksals verhängnisvoll und unumkehrbar fest.
Wenn mehr und mehr Menschen den «harten Weg» in eine Zukunft, die späteren Generationen durch Entscheidungen der heute Lebenden aufgezwungen wird, gar nicht oder nur sehr zögernd gehen wollen, dann deshalb, weil sie Verantwortung empfinden. Die Gegner ahnen, daß kein materieller Vorteil, den der Ausbau der Kernenergie für kurze Zeit bringen könnte – und diese Hoffnung ist ohnehin mehr als zweifelhaft –, die langfristig belastenden Folgen für Umwelt, Gesellschaft und Zukunft je aufwiegen würde.
Dieser Widerstand ist als «Glaubenskrieg» verketzert worden, so als hätten die Atomgegner einfach unkritisch ein rückschrittliches Dogma akzeptiert. Für viele von ihnen trifft aber eher zu, daß mehr Nachdenken, mehr Phantasie und mehr Gewissenhaftigkeit sie dazu gebracht haben, den von Obrigkeit und Mehrheit gewählten Unheilskurs abzulehnen. Noch scheint der andere Weg möglich. Aber nicht mehr lange.
«Wenn einer länger in der ‹heißen Zone› herumtut, als ich ihm vorgeschrieben habe, schneid ich ihm einfach den Sauerstoff ab», erzählt Fleury. «Was soll er dann schon anders machen als aufhören, wenn ich den Stecker rauszieh, mit dem er an der Ventilation hängt. Den Schutzhelm runterreißen, um Luft schnappen zu können – das traut er sich nicht. Er weiß: Da drinnen in der Zelle ist alles verstrahlt. Also kommt er ganz schnell raus.»
Patrice Fleury, Ende Zwanzig, hellwach, intelligent und, wenn er nicht zu müde zum Nachdenken ist, auch selbstkritisch, findet es eigentlich scheußlich, daß er sich so oft wie ein sale flic, wie ein «schmutziger Bulle» benehmen muß. Aber als «Strahlenschützer» und Mitarbeiter der Abteilung SPR (Section de Protection contre les Radiations) im Wiederaufarbeitungszentrum La Hague hat er darauf zu achten, daß die Beschäftigten des «Centre» nicht zu hohe Dosen an gesundheitsgefährdender Radioaktivität abbekommen. Es ist nun einmal seine Pflicht, unaufhörlich zu wachen, zu warnen, zurechtzuweisen. Nicht nur eine undankbare, sondern eine eigentlich sogar unerfüllbare Aufgabe in diesem gefährlichsten Betrieb des nuklearen Brennstoff-Kreislaufs. Denn überall in diesem «kaputten Laden» («cette boite pourrie!») sickert die radioaktive Giftluft aus immer neuen Ritzen, um sofort in Berührung zu kommen mit Haaren (die bedeckt sein müßten), mit Haut (die von Stoff oder Kunststoff verhüllt sein sollte), mit Augen (die hinter dicken Brillen zu verstecken wären) oder mit Atemwegen (die ein Mundfilter zu schützen hätte).
Dabei steht eigentlich fest, daß der ganze Durchlauf in einer Wiederaufarbeitungsanlage so gut wie automatisch und fast ohne direktes menschliches Eingreifen erfolgen muß:
Entladung der Brennstäbe aus den Speziallastwagen,
Lagerung zum Abklingen der Radioaktivität in Wasserbecken,
Entfernung der Schutzhüllen von den Stäben mit Hilfe ferngesteuerter Greifer (in La Hague als «Dégainage», das heißt «Handschuhausziehen», bezeichnet),
Zerkleinerung des Inhalts durch große Scheren (cisaillage)
chemische Auflösung der hochaktiven «Bruchstücke» in kochender Salpetersäure,
chemische Scheidung des aufbereiteten Urans, des Plutoniums und anderer Elemente in verschiedenen technischen Schritten,
Herstellung des Plutoniumoxids,
Konzentration des Urans,
Nachbehandlung der verbleibenden Abfälle,
Vorbereitung für die Lagerung der flüssigen und festen Abfälle,
getrennte «Beerdigung» der Abfälle entsprechend ihrem Grad an Radioaktivität.
Ableitung der schwach radioaktiven flüssigen Abfälle ins Meer.
Aber dieses auf dem Papier glatte Schema hat sich in der Praxis zum Hindernisrennen mit zahllosen Fallen verwandelt. Viel früher als man angenommen hatte, zeigten sich schon die ersten Abnutzungserscheinungen: Werkstoffe, die auch den schärfsten Säuren und beträchtlichen Hitzegraden standgehalten hatten, gaben nach, verformten sich; Röhren platzten, Ventile leckten. Bis heute ist noch nicht einwandfrei geklärt, weshalb in La Hague – ebenso wie auch in allen anderen Atomanlagen – so ungewöhnlich viele Materialbrüche auftreten. Würde hier wirklich alles so funktionieren, wie die Planer es sich gedacht hatten, dann wäre die Arbeit der Strahlenpolizei ein Kinderspiel. Doch die Wirklichkeit der Kernkraftindustrie ist, wie der schwedische Physiker Hannes Alfvén zutreffend erkannt hat, eben nicht das «technologische Paradies», das ihre Befürworter der Öffentlichkeit vorgaukeln, sondern eher eine «technologische Hölle», in der fast nichts läuft, wie es laufen sollte. Denn weder Maschinen noch Menschen vermögen so perfekt zu arbeiten, wie es die Technokraten in ihren Plänen voraussetzen.
Daß der ermüdbare, ungenaue, vergeßliche, nachlässige, zum Träumen neigende Mensch – gemessen an den präzisen, unmenschlichen Anforderungen, die ihm die immer gefährlichere und lebensfeindlichere Technik auferlegt – «eine Fehlkonstruktion» ist, wird einem Beobachter selten so deutlich wie hier an der Nordspitze der nebligen normannischen Halbinsel Cotentin. Dort hat die französische Atombehörde CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) die bisher größte industrielle Wiederaufarbeitungsanlage der Welt für Kernbrennstoffe errichtet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, aus bereits einmal in einem Atomreaktor verwendeten (aber dort nur zu einem Bruchteil ihrer Energiemöglichkeiten genutzten) Brennstäben die in diesem Spaltvorgang entstandenen Mengen des kostbaren künstlichen Elements Plutonium (Pu 239) zu gewinnen.
Dieses Plutonium wird später für Bomben oder für die «Reaktoren der nächsten Generation», die «Schnellen Brüter», verwendet.
Nirgendwo auf der Welt haben solche Anlagen bisher technisch einwandfrei funktioniert. Immer wieder gab es Pannen. Immer wieder kam es zu vorübergehenden Stillegungen, die in manchen Fällen – wie in West Valley (USA) – zur endgültigen Schließung führten. Obwohl selbst Experten zugeben, daß diese Technik noch nicht «produktionsreif» ist, hat man in Windscale (England) und in La Hague Großanlagen in Betrieb genommen, die Reaktorbrennstoffe nicht nur in Kilomengen wie beim Laboratoriumsbetrieb, sondern gleich in Tonnen verarbeiten sollen. In Hunderten von Tonnen. Aus Deutschland, Italien, Holland, Schweden und Spanien rollen Tag und Nacht polizeilich bewachte Riesenlaster mit bleiernen Sicherheitstanks – die Franzosen nennen sie chateaux (Schlösser) – über die immer noch ländlich anmutenden Straßen der Halbinsel, um hier, an der westlichen Spitze des europäischen Festlandes, ihre verfluchte Last abzuladen, die jedes Land loswerden will.
Unbeirrt durch fast tägliche Havarien und Unfälle, unbekümmert um Streiks und die wachsende Unruhe der Bevölkerung, die man dem Ausland zu verheimlichen sucht, reisen die Vertreter der COGEMA (Compagnie Générale de Matières Nucléaires) in der Welt herum und holen immer neue Riesenverträge herein. Der zur Zeit letzte und fetteste kommt aus Japan, denn seit West Valley schließen mußte und die englische Anlage keine neuen Aufträge mehr annehmen kann, hat Frankreich das Monopol auf diesem mehr schlecht als recht funktionierenden Gebiet der Wiederaufarbeitung, ohne das die Atomindustrie in aller Welt ins Stocken geraten würde.
Lange Zeit ließ sich das Versagen von La Hague bemänteln. Politiker, Geschäftsleute, Landräte und von der Atomindustrie ihres Landes vorher sorgfältig ausgesuchte Journalisten wurden zu Besichtigungsreisen eingeladen. Man zeigte ihnen imposante Fabrikgebäude, die von einem mehr als hundert Meter hohen Schornstein überragt werden, führte sie aber nur durch die Hallen und Räume, wo im Augenblick gerade gearbeitet wurde. An jenen Teilen der Anlage, die wieder einmal wegen Reparaturen gesperrt werden mußten, lotste man sie schnell vorbei. Die Gäste wurden nicht nur mit schwerer normannischer Küche und reichlichen Mengen von Apfelschnaps bewirtet, sondern von Direktor Delange auch mit Sätzen wie: «Kein Protest der nicht gerade zahlreichen Bewohner des Kaps wurde je gehört» (Frankfurter Rundschau, 21. Juli 1977) abgespeist. Dabei hätte ihnen schon ein Blick in die Lokalzeitungen verraten können, wie unruhig die Bevölkerung geworden ist.
Bernard Laponche, Physiker, Mitarbeiter der französischen Atombehörde und führender Funktionär des vorwiegend sozialdemokratisch und christlich orientierten Gewerkschaftsbundes CFDT (Confédération Française de Travail), dem die große Mehrheit der organisierten Arbeitnehmer von La Hague angehört, hat mehrfach – unter anderem auch schon im Februar 1977 in einem Interview mit Reinhard Spilker vom Westdeutschen Rundfunk – öffentlich erklärt: «Alle Welt behauptet, daß La Hague gut funktioniert. Das ist eine Lüge!» Aber man wollte ihn nicht hören – selbst dann noch nicht, als er Anfang Oktober 1977 in mehreren französischen Städten auf Pressekonferenzen den «Bluff von La Hague» aufgedeckt hatte. Denn wenn die Wahrheit über La Hague allgemein bekannt würde, könnten die Betreiber der Kernkraftindustrie in den verschiedenen Ländern nicht länger bei Bewilligungsverfahren behaupten, die Wiederaufarbeitung und Ablagerung ihres Atommülls stelle kein ernstliches Problem dar: sie sei zunächst einmal durch Verträge mit Frankreich gesichert.
Laponche verdanke ich es, daß ich mich nicht von den Public Relations-Leuten der COGEMA irreführen lassen mußte, sondern mit denjenigen in Verbindung treten konnte, die im «Centre La Hague», das sie das «Goul’ Hague» nennen, täglich ihre Haut – und nicht nur die – zu Markte tragen. Ihnen kann nicht daran liegen, auswärtigen Besuchern ein Potemkinsches Atomdorf zu zeigen. Sie wollen, daß alle Welt erfährt, wie es dort wirklich aussieht: Schon im Sommer 1977 waren die Auffangbecken überfüllt und radioaktiv zu stark verseucht, weil die dort schon viel zu lange gelagerten und auf weitere Verarbeitung wartenden Brennstäbe schadhaft geworden waren. Denn der Produktionsprozeß stockt, und die geplante Tagesleistung von vier Tonnen ist noch nie erreicht worden. Nicht einmal die Aufarbeitung der aus französischen Reaktoren stammenden Materialien wurde bisher termingerecht erledigt. Von den aus dem Ausland angelieferten Mengen ganz zu schweigen, denn die 1976 eröffnete neue Anlage, die das zehnmal aktivere Material aus den Atombrennöfen der auswärtigen Kunden verarbeiten soll, liegt die meiste Zeit über still, weil selbst mehrjährige Erfahrung kein störungsfreies Funktionieren erreichen konnte.
Dank der kritischen Gewerkschafter von La Hague habe ich Einblick in eine Arbeitswelt bekommen, wie es sie beängstigender nie zuvor gegeben hat. Hier büßen die Menschen nicht nur ihre Gesundheit ein, sondern auch ihre Sprache und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Von sich selbst sprechen sie – den Begriff «Kanonenfutter» auf ihre Verhältnisse übertragend – als «Strahlenfutter». Sie alle befürchten, daß sie nach einigen Arbeitsjahren einmal als «Abfall» auf der Arbeitslosenhalde enden. Oder schlimmer noch: im Krankenhaus. Auch glauben sie nicht, daß sie mit einer Entschädigung rechnen können, wenn sich Jahre nach ihrer Entlassung die Spätfolgen zu hoher Strahlenbelastung einstellen. Zumindest sprechen die bisherigen Erfahrungen nicht dafür. Ähnlich wie die Amerikaner, die nichts für die unter den Spätfolgen ihres Atomangriffs leidenden Strahlenkranken von Hiroshima und Nagasaki tun wollten, zeigen auch die Herren von La Hague bisher keine Bereitschaft, heute schon für die zu erwartenden Frühinvaliden und Krebskranken unter ihren ehemaligen Arbeitern langfristig die Verantwortung zu übernehmen. Nach zehn oder zwanzig Jahren, wenn solche Leiden dann in ein akutes Stadium treten, wird niemand mer «dafür zuständig» sein wollen.
Wenn Daniel Cauchon sich nach Schichtende in den Werkbus fallen läßt, der ihn über das umzäunte Gelände des «Centre» zum Parkplatz fährt, wo sein kleiner Wagen auf ihn wartet, sackt er zusammen, schläft auf der Stelle ein und wacht meist erst wieder auf, wenn der Bus schon den bewachten Eingang passiert hat. Seit Jahren schuftet er in der Abteilung «Intervention Mécanique», der die Aufgabe zufällt, überall dort einzugreifen, wo die radiologische Schutztruppe einen Defekt festgestellt hat.
Den Planern und Konstrukteuren zufolge dürfte technisches Versagen nur ausnahmsweise vorkommen. In der Alltagspraxis vergeht jedoch kaum eine Stunde, ohne daß nicht eine kleinere oder größere Reparatur notwendig wäre. 1967, als die Hauptanlage UP 2 (Usine Plutonium 2) in Betrieb genommen wurde, fielen die üblichen Kinderkrankheiten an. Kaum hatte man diese überwunden, begann schon das Greisenalter. Die Erbauer und Ausrüster der Fabrik waren bestrebt gewesen, alles möglichst schnell – zu schnell – auf die karge grüne Wiese zu stellen. Daß ein solch unfallträchtiger Betrieb mit einem Höchstmaß an Sorgfalt und Genauigkeit erstellt werden muß, haben sie dabei nicht bedacht.
«Erst einmal stimmte nichts mit nichts überein, paßte kein Stück zum anderen», erzählen die Veteranen von La Hague. «Es war zum Verzweifeln. Damals hofften wir noch, daß es einmal besser würde, doch darauf warten wir heute noch. Nur glaubt niemand mehr dran. Noch schlimmer war es fast, als 1976 die neue Anlage für die Brennstäbe aus den Leichtwasser-Reaktoren der ‹amerikanischen Linie›, das ‹Atelier HAO› (Hautes Activités Oxydes), zu arbeiten begann. Schon nach ein paar Wochen mußte das Ding geschlossen werden, und seither läuft es nicht mehr.»
Tatsächlich, wenn in einer solchen Anlage ein Schaden auftritt, dann ist das ungleich schwerwiegender und zeitraubender zu beheben als bei bisher üblichen technischen Systemen. Denn hier hat man es ja mit hochgiftigen Strahlenquellen zu tun, die erst einmal unter unsäglich umständlichen Bedingungen zu isolieren sind. So muß nicht nur ohne Unterlaß ein Leck nach dem anderen gestopft, Verzogenes geradegebogen, Zerbrochenes ausgetauscht werden, sondern es gilt gleichzeitig, ganze Werkhallen für Stunden oder Tage abzuschirmen. Komplizierte Apparaturen sind oftmals, wenn die Arbeit umständlich ist, gar nicht an Ort und Stelle zu reparieren, sondern müssen unter größten Vorsichtsmaßregeln erst einmal entgiftet, dann Stück um Stück auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden, ehe man sie erneut montieren kann. Der atomare Sysiphus hat es ungleich schwerer als sein mythischer Vorfahre. Seine Lasten sind nicht nur schwer, sie sind zudem noch giftig. Die niemals endende Anstrengung, die ihm abverlangt wird, strapaziert sowohl seine körperlichen Kräfte wie seine seelische Widerstandsfähigkeit. Die Angst vor den unsichtbaren Strahlen, die ihn treffen könnten, macht ihm ebenso zu schaffen wie die Isolation im Schutzpanzer, den er bei solchen Arbeiten tragen muß.
«Shaddok» nennen die Arbeiter in La Hague ihre moderne Ritterrüstung. Sie ist aus weißem Kunststoff und soll ihre Träger vor den Folgen radioaktiver Einwirkung schützen. Anfangs hatten die Franzosen diesen Modellen der nuklearen Haute Couture die Namen «Hiroshima» und «Nagasaki» gegeben, aber das erweckte wohl doch zu dunkle Erinnerungen. So mußte statt dessen eine durch Comic strips und Fernsehsendungen bekannte Phantasiefigur für den Namen herhalten. Die «Shaddoks» sind vogelähnliche, Schabernack treibende Fabelwesen, deren lange Schnäbel an die spitzen Gasfilter der zum Schutz getragenen Gesichtsmaske erinnern. Deshalb kamen diese heiteren Märchenwesen nun in der humorlosen Horrorwelt der Atomlaboratorien zu neuen Ehren.
Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis der «Plutoniumritter» fertig angezogen ist. Sorgfältig legt er unter Aufsicht des Strahlenschützers nacheinander die weiße Unterkleidung, ein Trikot mit rotem Brustband, ein Vinylgewand, drei Paar Socken und Überschuhe, dreifache Handschuhe und das über die Nase bis zum Augenrand reichende Atemgerät an, ehe man ihm schließlich den «Shaddok» selbst überstülpt. Noch ein letztes Paar Handschuhe, der Anschluß an die Sauerstoffleitung, die er wie eine Nabelschnur hinter sich herzieht, und der Atomritter ist fertig für seinen Einsatz.
Bevor er nun durch eine Luftschleuse ins «heiße» Gebiet eindringt, wo die Inspektion oder Reparatur auszuführen ist, erhält er noch einmal genaue Instruktionen, wie lange er sich dort aufhalten darf. Je nach Intensität der Strahlung können es Stunden oder auch nur Minuten sein. Entscheidend hängt die Dauer seines Einsatzes davon ab, wie seine persönliche Strahlenbilanz im Augenblick aussieht. Hat er im Laufe der letzten Monate schon den größten Teil der zulässigen jährlichen Maximaldosis abbekommen (die übrigens laut Gesetz für Atomarbeiter zehnmal höher sein darf als für den Durchschnitt der Bevölkerung), dann wird man ihn nicht lange in der heißen Zone lassen. Gehört er gar zu den unentbehrlichen Fachleuten, setzt man ihn nur ganz kurz zur Überprüfung und Aufsicht oder bei besonders schwierigen Montagen ein, damit er über das ganze Jahr verteilt möglichst oft zur Verfügung stehen kann. Da gewisse Reparaturen sich aber nicht in ein paar Minuten erledigen lassen, sondern Stunden dauern, müssen oft drei, fünf, zehn Leute einander ablösen, um nur einen einzigen Schaden zu beheben. Jeder kann also nicht mehr als einen Bruchteil der Aufgabe erledigen. Für manche ist das nur schwer erträglich, für einige sogar unerträglich. Sie müssen sich daran gewöhnen, daß sie nie eine Arbeit zu Ende führen dürfen, sondern immer nur ein Stückchen davon erledigen. Weder den Anfang noch das Schlußresultat ihrer Anstrengungen kennen sie, jede Arbeitsbefriedigung bleibt ihnen versagt.
Als 1969 in dem französischen Kernkraftwerk Saint-Laurent-des-Eaux durch einen Bedienungsfehler ein Behälter beschädigt wurde, brauchte man vierzehn Stunden, um ihn instand zu setzen. Nicht weniger als 105 Menschen lösten sich bei dieser Arbeit ab. Und trotzdem bekam jeder von ihnen eine beträchtliche Dosis ab. In den USA, wo man in den Gründerjahren der Atomindustrie noch sehr vorsichtig mit dem «Strahlenfutter» umging, wurden bei einer Reparatur am Kraftwerk Indian Point II (das New York City versorgt und im Juli 1977 durch Blitzschlag ausfiel) einmal sogar 1800 Arbeiter eingesetzt, um eine einzige defekte Leitung an den Dampferzeugern zu ersetzen. In La Hague hat man nun – wie auch in anderen Atombetrieben – eine höchst bedenkliche «Lösung» gefunden, um eine radioaktive Überbelastung von hochqualifiziertem (und hochversichertem) Personal zu vermeiden. In den Ortschaften rund um das «Centre» wie Jobourg und Beaumont sind zahlreiche kleine Unternehmen aus dem Boden geschossen, deren einzige Tätigkeit darin besteht, Arbeitskräfte zu beschaffen, die dann für Stunden oder Tage an «die Fabrik» vermittelt werden. Für die Strahlenbilanz dieser sogenannten interimaires ist nicht das Werk, sondern der private «Sklavenhändler» verantwortlich. Ob solche Zeitarbeiter vielleicht vorher schon in anderen Kernkraftwerken beschäftigt und dort Strahlen ausgesetzt waren, wird nicht gefragt. Man setzt einfach voraus, daß sie unbelastet seien. Und so gibt man ihnen meist auch gleich die «schmutzigste», das heißt gesundheitsgefährdendste Arbeit. Stets werden sie als erste in die verseuchten Zonen geschickt, um dort die notwendigen Vorarbeiten für die Fachleute zu leisten. Sie müssen zum Beispiel ein Leck abschirmen und davor Eingangsschleusen erstellen, oder sie haben die verseuchte Wäsche und die radioaktiven Abfälle in Plastiksäcken zu verstauen. Dabei soll möglichst der Atem angehalten werden, damit kein aktives Stäubchen aufgewirbelt wird.
Sie sind die Söldner, die Lumpenproletarier der Atomindustrie, denen man alles zumuten darf. Innerhalb weniger Tage bekommen sie so viel Strahlung ab wie ein regulärer Arbeitnehmer im ganzen Jahr. Nicht selten sogar noch viel mehr, denn die Gelegenheitsfirmen, die sie angeheuert haben, «vergessen» oft einfach die von den Gesundheitsbehörden vorgeschriebene Einsendung von Kontrollfilmen, an denen die jeweilige Tagesdosis abgelesen werden kann. Auf solche Weise wird die tatsächliche Strahlenbelastung vertuscht.
Nur zu oft müssen die interimaires schon am Nachmittag ihres ersten Arbeitstages die ärztliche Ambulanz aufsuchen, weil sie mit radioaktiver Substanz in Berührung gekommen sind oder sich verletzt haben. Denn im Gegensatz zu den Arbeitern und Angestellten des «Centre» werden diese Hilfskräfte kaum oder gar nicht für ihre Tätigkeit geschult. In den Ferien lassen sich oft Studenten anheuern, die zwar eine schnelle Auffassungsgabe haben, aber manuell ungeschickt sind; meist jedoch fängt man Arbeitslose ein, denen vorher nur gesagt wurde, daß sie gut bezahlt würden. Wie gefährlich und verantwortungsvoll aber ihre Tätigkeit in La Hague sein würde, hat man ihnen verschwiegen.
Um diese Praktiken weiß im «Centre» fast jedermann. Und doch drücken die Verantwortlichen beide Augen zu, hören weg, wenn die Gewerkschaften die Einführung eines «Strahlenpasses» und die Gleichstellung der interimaires verlangen. Denn wie könnte dieser Betrieb, der seit 1967 mit jedem Jahr einen höheren Grad von Verseuchung aufweist, überhaupt noch aufrechterhalten werden, wenn es nicht Menschen gäbe, die uninformiert, unvorsichtig oder verzweifelt genug sind, unter Umgehung der Sicherheitsvorschriften, ihre Schilddrüse, ihre Lungen, ihre Keimzellen zu gefährden. Anfangs bekommen sie in der Tat kaum etwas von den Folgen ihres Leichtsinns zu spüren – die treten erfahrungsgemäß erst viel später auf. Zukunftsblind kassieren sie einen Stundenlohn, der sie Lebensjahre kosten wird.
Nicht nur die interimaires, auch die regulären Arbeiter werden, je länger sie in der Plutoniumfabrik von La Hague arbeiten, zunehmend unbekümmerter und sorgloser. Vielleicht ist das ständige Leben mit der Strahlengefahr wirklich nur so zu ertragen. Man drückt sich darum, die Schutzkleidung anzulegen, wenn «nur ein kleiner Handgriff» in einer verseuchten cellule