

Robert Jungk, 1913 in Berlin geboren, arbeitete nach 1933 in Frankreich und im republikanischen Spanien an Dokumentarfilmen und schrieb von 1940 bis 1945 für die «Weltwoche» in Zürich. «Die Zukunft hat schon begonnen» (1952) war das Ergebnis eines mehrjährigen Aufenthalts in den USA. Das Thema, das hier angeschlagen worden war, wurde später in «Heller als tausend Sonnen» (1956) und «Strahlen aus der Asche» (1959) vertieft, international berühmten Büchern, die eindringlich vor den Gefahren der entfesselten Atomkraft warnen. Sein zuerst 1973 veröffentlichtes Buch «Der Jahrtausendmensch» führte 1975 zur Gründung einer «Fondation pour l’invention sociale», die Ansätze zu einer humaneren Technologie und Gesellschaft koordinieren und fördern soll.
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
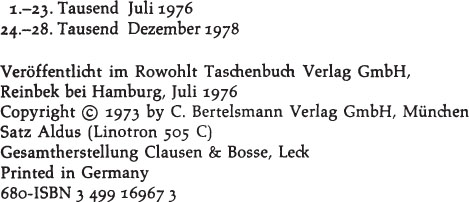
ISBN Printausgabe 978-3-499-16967-0
ISBN E-Book 978-3-688-10050-7
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-10050-7
Den Freunden
in vielen Ländern der Welt
Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im stillen besitzen.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
in Dichtung und Wahrheit
Ich benötige keinen Grabstein, aber
wenn ihr einen für mich benötigt,
wünschte ich, es stünde darauf:
Er hat Vorschläge gemacht. Wir
haben sie angenommen.
Durch eine solche Inschrift wären
wir alle geehrt.
BERTOLT BRECHT
Nüchterne, farblose Worte, mit denen Menschen dieser Zeit das benennen, was früher sehr viel pathetischer Weltuntergang genannt wurde.
Vor einem Jahrtausend wurde schon einmal das Ende der christlichen Welt erwartet. Viele verkauften ihr letztes Eigentum und bereiteten sich auf das Jüngste Gericht vor, das sich durch eine steigende Flut von Gewalttaten anzukündigen schien.
Neuere Historiker, die sich über die Geschichte der Wende vom ersten zum zweiten Jahrtausend gebeugt haben, sind zu der Ansicht gekommen, daß schon in dieser dunklen Zeit Anfänge jener Erhellung zu finden sind, die sich in den folgenden Jahrhunderten nach und nach ausbreitete. Das klare Gedankengebäude des Thomas von Aquin, die Strukturen der gewaltigen, weißleuchtend gen Himmel strebenden Kathedralen, die Lehre des heiligen Franz von Assisi, die Geistigkeit der Humanisten, ja sogar der kritische Rationalismus der Aufklärung – all das wurde schon damals, im zehnten Jahrhundert, von einer kleinen Zahl inspirierter Mönche hinter den Mauern ihrer Klöster vorbereitet.
Der französische Geschichtsforscher George Duby beschreibt die Wendung, die sich, erst wenigen bemerkbar, anbahnte: «Die Menschheit liegt noch zu Füßen eines schrecklichen, magischen, rächenden Gottes, der sie beherrscht und erdrückt. Aber sie ist dabei, sich das Bild eines menschlichen Gottes zu schaffen, der ihr ähnlicher ist, und sie wird es bald wagen, ihm ins Gesicht zu schauen. Sie beginnt einen langen Weg der Befreiung …»
Nur wenige dachten damals an eine irdische Wandlung. Ihre einzige Hoffnung galt dem Reich Christi. Hienieden war das Leben beherrscht von täglicher Not und nie endender Furcht. Das karolingische Reich war zerfallen, Räuberbanden durchstreiften Europa, plünderten, marterten, brandschatzten. Im barbarischen Klima dieses Säkulums gediehen die kulturellen Anfänge der beiden vorhergehenden Jahrhunderte nicht weiter und gingen zugrunde. Nur wenige Menschen konnten lesen oder schreiben.
So blieb der Prozeß geistiger Erneuerung, der hinter den Mauern einiger Klöster begonnen hatte, den Zeitgenossen verborgen. Erst die Nachwelt erfuhr davon aus Berichten von Chronisten wie Raoul Glaber. Das war ein unsteter, scharfzüngiger Mönch, höchst unbeliebt bei hohen wie mittleren Kirchenherren. Seine vielen Feinde sagten ihm nach, er sei «geschwätzig, leichtgläubig und ungeschickt». Er aber empfand, so wird überliefert, diese Tadelsbezeigungen als Lob und wertete sie als indirekten Beweis dafür, daß seine kritischen Beobachtungen getroffen hatten. Er widmete sich schließlich ganz dem Notieren des Erlebten und schrieb im Kloster Cluny, das ihm Unterschlupf gewährte, seine fünfbändige Geschichte der Jahre 900 bis 1044 nieder.
Ähnlich wird ein Chronist an der Wende zum dritten Jahrtausend versuchen müssen, nicht nur die Erscheinungen des Verfalls und der Zerstörung, der Brutalität und der Unvernunft, der Unterdrückung und Verschwendung zu registrieren und zu kritisieren, sondern auch zu fragen haben: Gibt es heute wiederum Vorzeichen eines Wandels? Wo sind Ansätze einer Veränderung? Werden wir noch einmal davonkommen?
Der Schreiber dieser Zeilen bemüht sich seit Jahren darum, Signale, Tendenzen und Versuche ausfindig zu machen, die im Widerspruch zum Bestehenden auf eine andere und bessere Zukunft hindeuten.
Anfangs war das nur eine Nebenbeschäftigung, die ich durchaus unsystematisch betrieb: eine Zeitungsnachricht, ein Brief, eine mündliche Mitteilung erzählten von Möglichkeiten und Hoffnungen. Ich sammelte solche «guten Nachrichten» und gab während meiner Korrespondententätigkeit bei den Vereinten Nationen in New York als private Publikation einige Nummern eines «Good News Bulletin» heraus. Denn als Zeitungsmann fand ich es unerträglich, daß Presse und Funk in ihrer Suche nach Neuigkeiten zwar über Kriminalität und Katastrophen, Krisen und Krieg ausführlich berichteten, darob aber hoffnungsvollere, wenn auch weniger aufdringliche Entwicklungen vernachlässigten.
Das starke Echo dieses naiven Versuchs in der amerikanischen Öffentlichkeit – Leitartikel in den führenden Zeitungen und Nachrichtenmagazinen, Interviews in Radio und Fernsehen, Hunderte von Briefen aus allen Teilen des Landes – zeigte mir, wie groß die Sehnsucht war, einmal etwas anderes als die täglichen Klagen zu hören. Meine Freude über diesen scheinbaren Erfolg war kurz. Ich merkte sehr schnell, wie sehr dieses oberflächliche Interesse an «guten Nachrichten» der Nachfrage nach Beruhigungspillen ähnelte. Meine damaligen Leser und Korrespondenten schienen weder interessiert zu sein, eindringlich über Alternativen und ihre Durchsetzung nachzudenken, noch die Zeitübel tiefergreifend zu diagnostizieren. Sie mißverstanden meine Hinweise auf einige wenige Lichtblicke in einem überwiegend dunklen Bild als Bestätigung dafür, daß doch «alles gar nicht so schlimm» sei.
Wie sehr meine Bemühungen um eine etwas ausgewogenere Betrachtungsweise zur Verschleierung mißbraucht werden konnte, wurde mir besonders deutlich, als sich gerade diejenigen intensiv zu interessieren begannen, die am schlechten Stand der Dinge nicht unwesentlich beteiligt waren: ein großer Chemiekonzern und eine Fluggesellschaft boten mir an, eine tägliche «Good-News»-Radiosendung zu finanzieren. Am Ende würde dann ein Sprecher die Güte ihrer Leistungen loben.
Nein, so ging es nicht. Ich mußte mich weiterhin fast ausschließlich kritisch mit denen beschäftigen, die eine Verbesserung der Lage verhinderten, und denen, die es erduldeten: den Drahtziehern und den Zappelnden, den Rücksichtslosen und ihren ahnungslosen Opfern. Und doch ließ mich eine Frage nicht los: Trug ich damit wirklich zur «Aufklärung» und Aktivierung der Leser bei? Verstärkte ich nicht vielmehr ihre Gefühle der Resignation? Wenn sie über den Egoismus, die Kurzsichtigkeit, den wachsenden Einfluß der Herrschenden informiert wurden, wenn sie Einblick erhielten in das Vordringen von Zwängen, die unaufhaltsam schienen, in Machtstrukturen, die den Bürger immer abhängiger werden ließen, würden sie dann nicht – durch solche Informationen gelähmt und in ihrer Passivität bestätigt – alles so weiterlaufen lassen, wie es lief? Und wurde ich nicht auf diese Weise erst recht zum Helfer derer, die sich sowohl der Verhüller wie der Entschleierer zu bedienen verstehen?
Um diesem starken Zug zur Entmutigung entgegenzuwirken, suchte ich immer wieder Reportagethemen, in denen ich Menschen beschreiben konnte, die gegen den Strom zu schwimmen versuchten. Wie zum Beispiel den Vietnamesen, der während der ersten Indochinakonferenz in Genf auf einer Wiese vor dem Völkerbundpalast die Herren Unterhändler durch einen wochenlangen Hungerstreik auf die Leiden seines Volkes aufmerksam machte. Oder Danilo Dolci, den italienischen Reformer, der in einem der furchtbarsten Elendsviertel Palermos gegen die sizilianische Mafia und die mit ihr verbundenen römischen Politiker protestierte. Oder den jungen Elektroingenieur Ishiro Kawamoto aus Hiroshima, der seine Karriere aufgegeben hatte, um den Atomkranken zu helfen, die von keiner offiziellen Stelle betreut wurden.
Trugen solche bewunderungswürdigen Einzelgänger wirklich dazu bei, den verhängnisvollen Kurs der Ereignisse zu ändern? Ihr Opfer wurde zur Anekdote. Nur für Augenblicke brachte es geschehenes Unrecht ins Bewußtsein der Öffentlichkeit. Geändert wurde dadurch so gut wie nichts. Ging es aber nicht darum, Unheil rechtzeitig zu verhindern? War das nicht dringender, als es nachträglich zu beschreiben und zu beklagen?
Ich erinnere mich genau der Stunde, da ich endlich einsah, daß ich als Reporter eigentlich ein «Kriegsgewinnler» war, ein Nutznießer des Unheils dieser Zeit.
Im Frühjahr 1960 drehte ich in Japan eine Fernsehreportage, die auf meinem im Jahr zuvor erschienenen Buch «Strahlen aus der Asche» basierte. Wir standen in einem jener zugigen Notquartiere am Rande von Hiroshima. Hier hatten die Überlebenden des ersten Atombombardements der Geschichte sich verkriechen müssen. Vor uns ein strahlenkrankes Ehepaar. Sie bereits so schwach, daß sie sich nicht mehr aufrichten und kaum noch sprechen kann. Er – weißhaarig, runzlig, frühzeitig gealtert – hat bis jetzt geduldig alle meine Fragen beantwortet. Nun bittet er mich, ob er nicht auch etwas fragen könne? Mit schwacher Stimme, durchaus nicht anklagend, eher im Tonfall der Entschuldigung, sagt er: «Haben denn die ehrenwerten Gelehrten des Westens nicht vorhergesehen, daß ihre neuen Waffen noch Jahrzehnte nach dem Einsatz Menschen umbringen würden?»
Die Frage dieses Japaners, der fünfzehn Jahre nach dem 6. August 1945 an den Folgen der Atombombe sterben mußte, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Sie war nicht nur an die Wissenschaftler gerichtet, sie geht uns alle an. Aber mich traf sie ganz besonders. Lief ich nicht seit Jahren hinter den Ereignissen her, um dann, wenn es schon zu spät war, zu kritisieren und zu protestieren? War ich nicht vom Schrecklichen, das ich beschrieb, beruflich so abhängig geworden wie manche Ärzte von der Krankheit und daher an seiner Weiterexistenz interessiert? Mußte ich nicht auch bei mir den Mangel an Voraussicht, an Vision bekämpfen und verhindern helfen, daß sich Katastrophen wie Hiroshima wiederholten?
Die Arbeit an einer Fernsehserie mit dem Titel «Europa Richtung 2000» zeigte mir, daß diese Zukunftsblindheit weitaus verbreiteter war, als ich vermutet hatte. «Ich kann mich nur mit dem nächsten, bestenfalls noch mit dem übernächsten Budget beschäftigen», bekannte ein führender englischer Staatsmann, den ich interviewte. «Was weiter als fünf Jahre vor uns liegt, ist ziemlich uninteressant», versicherte mir ein hoher Gewerkschaftsfunktionär und betonte selbstbewußt, er sei eben «Realist», kein Träumer. Parlamentarier, die ich traf, dachten nur bis zur nächsten Wahl, Wirtschaftler nur bis zur nächsten Bilanz, Siedlungsplaner bis zum nächsten Auftrag.
Die Einsicht, daß die wissenschaftlich-technische Entwicklung Kräfte in Bewegung gesetzt hatte, die weit in kommende Jahrzehnte hineinwirken würden, hatte sich damals noch kaum durchgesetzt.
So begann ich, mich für die Erforschung der Zukunft zu interessieren, nahm Kontakt mit den ersten Forschungsgruppen und Institutionen in Frankreich, in den USA und in Japan auf und wurde zu Beginn der sechziger Jahre selbst einer jener damals wenigen, die systematisch begannen, sich um die Erkundung des Kommenden zu bemühen.
Jetzt wurde meine Suche nach Anzeichen hoffnungsvoller Zukunftsentwicklungen intensiver. Ohne bestimmten Auftrag fuhr ich beunruhigt in der ganzen Welt umher, besuchte diesseits und jenseits des in jenen Jahren noch recht dichten «Eisernen Vorhangs» Forschungsstätten der verschiedensten Wissenschaftszweige. Ich nahm an Kolloquien und Seminaren von Kalifornien bis Moskau, von Finnland bis Hawaii teil und wurde so zu einem von den Experten nicht selten mißtrauisch angesehenen «conference hopper», der als Außenseiter von einer Tagung zur anderen «hüpft», um die neuesten «papers» der Forscher zu sammeln oder um bei den erregenden Pausengesprächen, nächtlichen Spekulationen dabeizusein, die den inoffiziellen, aber meist interessantesten Teil der Kongresse ausmachen. Denn hier werden tastend und noch ohne Furcht vor Kollegenkritik jene Gedanken entwickelt, die vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht auch nie aus dem Stadium der Vermutung in das der fundierten Erkenntnis treten.
Bei diesen Kontakten mit der wissenschaftlichen und technischen Avantgarde fiel mir immer stärker auf, wie wenig Fühlung die Pioniere der verschiedenen Disziplinen untereinander hatten. Jeder wühlte immer tiefer und tiefer in seinem Schacht, wußte jedoch nur wenig über das, was nebenan oder gar zwei, drei Stollen entfernt geschah. Einen Chemiker, der sich mit Soziologie beschäftigte, einen Organisationsforscher, der sich fragte, wo die Kernphysik stehe, oder einen Politologen, der sich dafür interessierte, an welchen neuen technischen Entwicklungen – die doch möglicherweise politische Bedeutung bekommen würden – man zur Zeit in den Laboratorien arbeite, fand ich nicht. Sie hatten, wie sie sagten, genug und mehr als genug damit zu tun, sich über die Arbeiten im eigenen Spezialgebiet auf dem laufenden zu halten. Wenn ich in jenen Unterhaltungen mit den Fachleuten etwas von den Vorgängen in «anderen Welten» berichtete und dabei versuchte, sie spekulativ auf mögliche Zusammenhänge mit ihren eigenen Arbeiten hinzuweisen, dann kam ich mir oft vor wie ein nur ungern geduldeter Globetrotter, der den arbeitsamen Honoratioren einer Provinzstadt etwas von den Ereignissen in der weiten Welt vorflunkert. Gewiß, die Sender funken Tag und Nacht, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher werden in Riesenauflagen gedruckt und verbreitet. Aber die Fülle des im Grunde schon Bekannten erdrückt und überschattet oft das wirklich Neue, das ganz andere, die Vorzeichen einer Wende, die nicht nur kalendarischer Art ist, sondern vielleicht radikale Veränderungen der Sicht, der Auffassung, der Werte, der Lebensziele und der Lebensführung mit sich bringen könnte.
Bewußt und ausdrücklich sage ich «vielleicht», weil es durchaus nicht sicher ist, ob sich diese oft erst schwachen Keime entwickeln können. Sie haben nur dann eine Chance, wenn die Neuerer und Experimentatoren die große Öffentlichkeit nicht mehr ausschließen, sondern sich mit ihr verbünden, sie teilnehmen und auch zu eigenen Fragen und Versuchen kommen lassen. Solche Teilnahme wird allerdings nur dann möglich sein, wenn die bisherige «Einbahnstraße» zwischen Experten und Laien, Führenden und Geführten, Lehrenden und Lernenden, zwischen Qualifizierten und Nichtqualifizierten nach beiden Richtungen hin geöffnet wird, wenn in der großen Masse der Befehlsempfänger, der Konsumenten, der lebenslang zur Passivität Verurteilten mehr und mehr Menschen die Möglichkeit erhalten mitzubestimmen, mitzuentwerfen, mitzugestalten.
Das andere bestimmende Ereignis auf meiner Suche nach Zeichen der Hoffnung war das Erleben eines beginnenden Eigenwillens und Eigenkönnens jener «Leute», die «von oben» nur noch als namenlose statistische Kohorten, als «Zielgruppen», «Verbraucherschichten», «Wählermassen» gesehen werden. Doch auch hier fehlt es an Querverbindungen: Bürgerinitiativen, Selbstverwaltungsexperimente, neue Betriebsformen, Schulmodelle, Wohngemeinschaften – es gibt sie zu Hunderten, aber sie wissen voneinander wenig oder gar nichts. Es gibt mitunter innerhalb einer Stadt, eines Landes Kontakte zwischen den Trägern einzelner gesellschaftlicher Versuche, es fehlt jedoch an internationaler Kommunikation, an Vergleichsmöglichkeiten und wechselseitigem Lernen aus Erfolg oder Mißerfolg, es fehlt an allgemein bekannten, ermunternden oder warnenden Beispielen.
Wer das Spektrum der weltweiten Bemühungen, Neues zu erkennen, zu entwickeln und zu leben, zu überblicken versucht, dem formen sich zu dieser Jahrtausendwende hoffnungsvollere Zukunftsvorstellungen als den Empfängern täglicher Unglücksnachrichten. Er wird letzten Endes auch optimistischer urteilen als etwa die Computerdiagnostiker des «Club of Rome», die den Faktor «Mensch» und die Größe «Phantasie» ausklammerten, weil sie beide nicht als erfaßbare, klar definierbare Daten in ihre Berechnungen einsetzen konnten.
Der Mensch hat in allen Zukunftsperspektiven einen schwer kalkulierbaren Stellenwert. Daraus erwächst aber nicht nur Unsicherheit, sondern auch Erwartung. An den «Grenzen des Wachstums» – von manchen Kommentatoren mit den Weltuntergangsprophezeiungen um das Jahr 1000 nach Christus verglichen – bekennen die geistigen Väter der Zukunftsstudie des «Club of Rome»: «Letztlich möchten wir nicht verzichten, darauf hinzuweisen, daß der Mensch sich selbst, seine Ziele und Wertvorstellungen ebenso erforschen muß wie die Welt, die er zu verändern sucht.»
Das geschieht bereits an Tausenden von Stellen des Planeten. Wir treten aus einer Epoche des vorrangigen Studiums der Natur und des Strebens nach ihrer Beherrschung in eine Zeit intensiver und immer intensiver werdender Bemühung um die Erkenntnis und Weiterentwicklung des Menschen ein. Rein äußerlich ist diese Entwicklung an der sprunghaft wachsenden Zahl der Studenten in den Humanwissenschaften bei gleichzeitigem Rückgang in den naturwissenschaftlichen Fächern zu erkennen. Auch steigt Jahr um Jahr das Interesse an Büchern mit psychologischen, pädagogischen, anthropologischen oder soziologischen Themen. Diese Tatsache muß den Zukunftsforscher interessieren, engagieren.
Es gibt zwei Hauptmethoden der Vorausschau. Das «exploratory forecasting» (forschende Vorausschau) verlängert bereits wahrnehmbare Trends in die Zukunft hinein. Das «normative forecasting» (normative Vorausschau) setzt zum Teil aufgrund der auf diese Weise gewonnenen Einsichten wünschenswerte Ziele fest und fragt sich, wie die Lücke zwischen dem Erstrebten und Verfügbaren überwunden werden könnte.
Bekanntes Beispiel eines – nachträglich stark und vermutlich zu Recht kritisierten – normativen Vorgehens war das amerikanische «Projekt Apollo», das schon zu einer Zeit entworfen und verkündet wurde, als die technischen Geräte für den Mondflug erst teilweise erfunden waren. Durch die klare Herausstellung eines zu erreichenden Zieles wurden jedoch zahlreiche verstreute Ansätze zusammengefaßt und darüber hinaus konstruktive Kräfte mobilisiert, denen in überraschend kurzer Zeit die notwendigen, technologischen Durchbrüche gelangen.
Ähnlich normativ werden wir vermutlich bei der Weiterentwicklung des Menschen vorgehen müssen, denn die Zeit drängt. Eine Umorientierung des Wachstums von «außen» nach «innen», vom Griff nach der Erde und dem Heimmel zur «Selbstbesinnung» des Menschen auf sich und seine Gesellschaft ist zwar bereits im Gange; zu einem vordringlichen, allgemein anerkannten Ziel ist es noch nicht geworden.
Denkbar wäre ein weltweites «Projekt Jedermann». Es sollte die verborgenen, verschütteten, verkrüppelten Fähigkeiten zahlloser Persönlichkeiten entwickeln, die durch falsche Erziehung oder soziale Zurücksetzung um ihre Selbstverwirklichung betrogen wurden.
Dafür reichen jedoch wissenschaftliche Analysen allein nicht aus; darüber hinaus sind zahlreiche Entwürfe für neuartige Formen des persönlichen Zusammenlebens notwendig. Soziale Laboratorien werden nicht abgeschirmte Tempelbezirke priesterhafter Experten sein dürfen. Sie müßten offene Stätten spontaner Einfälle wie auch fundierter, geduldiger Prüfung sein, die ständig Vorschlägen, Kritik und Diskussion ausgesetzt sind. In solchen Institutionen sollte Gelegenheit für Experimente geboten werden, aus denen neuartige Siedlungsformen, Schulen, Arbeitsplätze, Orte des Spiels und Stätten der Besinnung hervorgehen könnten.
Utopie? Anfangs vielleicht. Aber was einst Traum bleiben durfte, muß heute Entwurf und Wirklichkeit werden. Nicht mehr nur der Wunsch, sondern die Not verlangt nach neuen menschlichen Lebensformen.
«So geht es nicht weiter!» Diese Worte können als Entschuldigung für den Rückzug dienen, sie können aber auch Herausforderung sein. Der amerikanisch-französische Biologe René Dubos sagte in einem Gespräch über die Bedrohung der Menschheit an der Jahrtausendwende:
«Krisen führen immer zu einer Bereicherung. Zivilisationen dürfen niemals zu Ketten werden. Deshalb mündet mein Pessimismus gegenüber der nächsten Zukunft in einen Optimismus von großer Tiefe. Die Kraft der Umstände zwingt die Menschen, andere Lösungen zu erfinden.»
Um über weitverstreute, vereinzelte und oft verborgene Anfänge solch weltweiter Bestrebungen zu berichten und sie in das allgemeinere Bewußtsein zu heben, ist dieses Buch geschrieben worden. Sein Fazit: Der Mensch ist nicht am Ende. Herausgefordert durch tödliche Gefahren, beginnt er sich erst jetzt voll zu entfalten.
Vom Dunkel in strahlende Helle. Fast ohne Übergang. Eben noch im Schritt durch «typisch englischen Nebel» gefahren, gegen den die Autoscheinwerfer fast machtlos waren, und nun blendet die plötzliche Sonne den Fahrer so sehr, daß er bremsen muß und am Straßenrand stehenbleibt. Wir klettern aus dem Bus auf die schäbige Vorstadtstraße von Manchester und springen ausgelassen herum wie Kinder. Dort hinten in der gelbgrauen «Erbsensuppe» liegt die Computerfabrik Ferranti, in der wir heute vormittag für das Fernsehen gedreht haben. Und hier, nicht einmal eine Meile entfernt, leuchtet der Himmel klar und frühsommerlich.
So erlebte ich in der mittelenglischen Industriemetropole die Passage von einer verschmutzten in eine «rauchfreie Region». Es war, als überschreite man die Grenze zwischen zwei Welten, zwei Zeiten. Damals, Anfang der sechziger Jahre, gab es den «Clean Air Act» (Gesetz für saubere Luft) erst seit kurzer Zeit. Der Beschluß, mit dem sich Großbritannien als erste Großmacht gegen unerfreuliche Nebenerscheinungen des Wachstums zu verteidigen suchte, war 1956 im Parlament gefaßt worden. Als politische Pragmatiker wußten die Engländer, daß es nicht möglich sein würde, die beschlossenen scharfen Kontrollen für Betriebe und Privatpersonen auf einen Schlag durchzusetzen. So begann man nach und nach, bald hier, bald dort, eine «smokeless zone» einzuführen: Modell und Verheißung für andere, noch in Qualm und Gestank getauchte Gebiete. Fünfzehn Jahre nach dieser gesetzgeberischen Pionierleistung überflog ein Kamerateam der «British Broadcasting Corporation» (BBC) die ganze Insel und stellte fest: «An einem klaren Tag wird der Reisende überrascht, weil es die charakteristischen Rauchfahnen über den meisten Industriegebieten nicht mehr gibt.»
Ähnlich deutliche, wenn auch noch lange nicht volle Erfolge gelangen bei der Reinigung englischer Gewässer. Als Umweltforscher im Auftrag der Behörden 1957 den Verschmutzungsgrad der Themse prüften, fanden sie auf einer Strecke von vierzig Kilometern zwischen Richmond und Gravesend keinen einzigen lebenden Fisch mehr. Fünfzehn Jahre später tummelten sich wieder über fünfzig verschiedene Arten in den Wellen des Flusses. Die Ufer werden nun nach und nach von Fabrikanlagen befreit und in Parklandschaften mit Spazierwegen umgewandelt. In den einst grünen Tälern von Wales, die durch die Industrialisierung in sterile Halden und Schuttplätze verwandelt worden waren, setzte eine erfolgreiche Wiedergutmachungspolitik ein. Sie führte bereits zur Schaffung großer neuer Erholungsgebiete. Der Nordwesten Englands, von dem aus im neunzehnten Jahrhundert die Maschinen, die man damals euphemistisch «eiserne Engel» nannte, ihren Siegeszug über die Welt antraten, wird systematisch aufgeforstet. Im Jahr 2000 sollen viele Regionen der Insel wieder so grün sein wie zu Zeiten Shakespeares. Man wird künftig nur solche Industrie in den wiederhergestellten Landschaften dulden, die nicht gegen Normen des Gesundheits- und Naturschutzes verstößt.
Wunschvorstellungen von der künftigen Umwelt beginnen sich drastisch zu verändern. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurden die Rauchfahnen der Schornsteine noch als Banner des Wohlstands gesehen, galten Industrieanlagen, Motoren, Maschinen als Symbole des Fortschritts. Nun, an der Wende des Jahrtausends, beginnt sich die Vision der erhofften und gewollten Zukunft grundlegend zu ändern: die Technik wird in den Hintergrund gedrängt. Ihr wird eine dienende, unauffällige, unaufdringliche, möglichst unschädliche Rolle angewiesen; sie wird geradezu versteckt.
Wo heute noch Hochspannungsleitungen den Himmel zerschneiden, soll der Blick wieder ungehindert bis an den Rand des Horizonts schweifen können. Keine Schwaden werden die Luft, keine Abfälle die Gewässer verpesten. Lärm und bedrückend monotone Fabrikgebäude werden verschwunden sein; die Häßlichkeit tritt ihren Rückzug an. Der Rhythmus der Maschinen entläßt die Menschen aus seinem Griff. Sie können sich wieder in ihrem eigenen Tempo bewegen, nach eigenem Zeitgefühl arbeiten. Sie haben sich von den sichtbaren und unsichtbaren Ketten befreit, die ihnen das Zeitalter der mechanisierten Leistung auferlegte.
Diese Schilderung klingt zwar heute noch utopisch. Aber sie ist nicht nur eine mögliche, sondern eine recht realistische Vision der Welt von morgen. Pläne, Projekte, Experimente, hier und da auch schon Verwirklichungen weisen in diese neue Richtung. Vieles, was gestern noch als unökonomisch und daher undurchführbar abgelehnt wurde, erwies sich als durchaus machbar. Anfang der sechziger Jahre hieß es z.B., die Verlegung von Überlandkabeln unter die Erde sei zu kostspielig und könne nur in Ausnahmefällen stattfinden. Anfang der siebziger Jahre wurden im Zeichen des erwachten «Umweltbewußtseins» bereits Hunderte Kilometer von Stromleitungen eingegraben. Einerseits hatten Verbesserungen auf den Gebieten des Tiefbaus und der Elektrotechnik die Kosten gesenkt, andererseits mußten und konnten staatliche und private Werke mit einemmal doch die notwendigen, gestern noch als «untragbar» bezeichneten Mehrlasten übernehmen.
Eine entscheidende Rolle in diesem Wandlungsvorgang spielte die zunächst unbeachtete, später verspottete Zivilisationskritik der Intellektuellen. Sie weckte das Unbehagen an den Apparaturen, die sich das Lebendige zu unterwerfen und oft unwiderruflich zu zerstören begannen, schon zu einer Zeit, da der Nimbus der Technik noch sehr groß war und sie als eine Art moderne «Religion» angesehen wurde, gegen die nur rückständige «Ketzer» etwas einwenden konnten. Seither zeigte es sich aber, daß die angeblich wirklichkeitsfremden Intellektuellen die Realität besser beurteilt hatten als die «Praktiker», weil ihr Begriffsrahmen weiter gespannt war. Die sogenannten «Realisten» hingegen, die weder Nebeneffekte noch längerfristige Folgen der Industrialisierung hatten sehen wollen, waren bei ihrer «streng seriösen» Beurteilung der Lage weniger ernsthaft gewesen als der geniale Filmkomiker Charlie Chaplin, der in seinem Meisterwerk «Modern Times» beim Kampf mit dem Fließband die beschämende Lächerlichkeit einer inhumanen Produktionsweise sehr früh bloßgestellt hatte.
Doch erst die menschheitsgefährdende Grenzüberschreitung der technischen Entwicklungsmöglichkeiten in den Atombombenexplosionen von Hiroshima, Bikini, Eniwetok und Nowaja Semlja verwandelte Unbehagen in weltweite Furcht, erschütterte das Dogma vom unbefleckten und unausweichlichen technischen Fortschritt, dem man sich zu fügen und anzupassen habe.
Anthony Wedgwood Benn, ein führender Mann der englischen Arbeiterpartei, formulierte zu Anfang der siebziger Jahre, als er noch das Ministerium für Technik leitete, diese veränderte Haltung besonders knapp und einleuchtend: «Die zentrale Frage von heute ist sehr einfach. Es geht darum, ob die Menschen eine Kontrolle über die Maschinen behalten, die sie gebaut haben, oder ob sie sich von ihnen überrollen lassen. Das Risiko ist sehr real, daß wir der menschengemachten Umwelt so vollständig preisgegeben werden wie einst die Höhlenmenschen der Natur. Damals waren sie von Kräften umgeben, die sie nicht verstanden, und lebten in ständiger Furcht, es könnte wieder so kommen.»
Ist es überhaupt richtig, von «der Technik» zu sprechen? Nach Ansicht des englischen Ingenieurs und Erfinders Professor Meredith Thring (Marylebone College, London) haben wir bisher noch gar nicht versucht, eine «kreative Technik» zu konstruieren, sondern uns mit einer «cheap technology», einer «schäbigen Technik», zufriedengegeben, die ausschließlich der Zielsetzung unterworfen ist, billig, profitabel, sparsam und schnell zu produzieren. Seiner Ansicht nach könnten Forscher und Ingenieure schon längst menschen- und umweltfreundlichere Apparaturen konstruieren, wenn man sie nur ließe und die Rücksichtnahme auf Mensch und Umwelt in ihren Entwürfen eine mindestens ebenso große Rolle spielen dürfte wie wirtschaftliche Bedingungen.
Über der Welt der Maschinen steht heute noch, alle anderen Motive überragend, das Motto der Auftraggeber: «Mehr Leistung! Mehr Gewinn!» Diese Leitsätze erweisen sich aus größerer Entfernung als trügerisch, denn diese an Effizienz und Profit ausgerichtete Technik bringt zwar raschen Gewinn, aber infolge ihrer schädlichen Nebenwirkungen übergroße «soziale Kosten» und langfristigen Verlust.
Wie die Baukunst, so kann auch die jeweils herrschende Technik als Ausdruck eines bestimmten, die Zeit widerspiegelnden Stils angesehen werden, der von den wirtschaftlichen, sozialen, geistigen und seelischen Bedingungen einer Epoche beeinflußt wird und sie ihrerseits beeinflußt. Nach Ansicht des belgischen Kulturphilosophen Henri van Lier (Universität Brüssel) wird der brutalen «dynamischen Technik» des neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts, die sich die Welt und den Menschen zu unterwerfen versuchte, eine in Ansätzen schon vorhandene «dialektische Technik» folgen. Sie soll mit der Natur und mit ihren Arbeitspartnern in ein Zwiegespräch eintreten und – so hofft er –, aus ihrer zivilisatorischen Abseitsstellung befreit, in den Kreis der menschlichen Kulturleistungen einbezogen werden: eine Schwester der Künste.
Daß es schon jetzt zahlreiche Bemühungen gibt, eine andere Technik zu schaffen, mit der man leben kann, statt unter ihrer Herrschaft oder im Widerstand gegen sie zu leiden, habe ich auf meiner Suche immer wieder festgestellt.
Ich möchte diese Bemühungen in vier große Tendenzen gliedern:
• Die erste Richtung – sie ist bisher am weitesten gediehen – will die Technik starken Kontrollen unterwerfen;
• die zweite will die Technik so weit wie möglich zurückdrängen, verkleinern und auf ein Mindestmaß beschränken;
• die dritte – sie ist die phantasievollste – geht dahin, Wesen und Funktionsweise der Technik grundsätzlich zu verwandeln, sie lebensähnlicher zu machen und durch eine Art «gelenkte Evolution» zu zivilisieren;
• die vierte Tendenz: Umsteuerung der Technik auf andere, menschen- und umweltfreundlichere Ziele hin.
Wie bei jeder Einteilung gibt es auch hier Überschneidungen, Zwischenformen, gegenseitige Ergänzungen. Die Technikkontrolleure, die Technikasketen, die Technikverwandler und die Techniksteurer werden mit- und nebeneinander den Versuch machen, zwischen den Menschen und seinen Instrumenten ein neues, friedlicheres Verhältnis zu stiften, damit er die Krisen des Jahrtausends überleben kann.
Eine Milliardenindustrie zur Kontrolle der Umweltschäden begann sich Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre in vielen Staaten zu entwickeln. Automatische Meß- und Warninstrumente zur Aufspürung schädlicher Stoffe in Luft, Wasser, Boden und Nahrung, chemische und pharmazeutische Produkte zur Giftbekämpfung, Luftfilter, Klärwerke und Abfallverarbeitungsanlagen wurden auf einem Markt, der teilweise bereits unter stagnierenden oder fallenden Rüstungsgewinnen zu leiden hatte, zu einem unerwartet großen Geschäft.
Ein «Schmutzrausch» setzte ein, der an den Goldrausch von Alaska erinnert. Er machte bereits einige besonders geschickte Leute innerhalb kürzester Zeit zu Millionären. Da war zum Beispiel der Amerikaner Robert L. Chambers, der mit ausgeborgtem Geld die Firma «Environtech» in Menlo Park, Kalifornien, gründete, über die das «Wall Street Jornal» schreibt: «Vor weniger als drei Jahren begonnen, war Environtech zuerst nur eine Idee, die unter dem Kennwort 8–2-0 bekannt war, schwoll aber inzwischen zu einer Firma an, deren Einnahmen jährlich über hundertfünfzig Millionen Dollar betragen sollen. Die Verdienste in den ersten sechs Monaten des laufenden Steuerjahres waren um 37,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Daher sagen die Makler voraus, daß die Firma mit Leichtigkeit ihre vorjährigen Reingewinne von drei Millionen Dollar überschreiten wird.»
Laut einer Schätzung der neuen Umweltbehörde der Vereinten Nationen wird bis 1985 etwa ein Fünftel aller industriellen Erzeugung der Milderung oder Beseitigung unerwünschter Nebenwirkungen der Technik dienen. Welche Ausgaben notwendig sind, geht aus dem Projekt für eine künstliche «Müllinsel» in der Nordsee hervor, die von der «Westminster Dredging Group» geplant wird. Sie soll rund fünfzig Millionen Pfund kosten und etwa ein Fünftel aller Abfälle Hollands (vor allem gefährliche Chemikalien und jährlich allein 200000 Altautos) rund achtzig Kilometer von allen Wohngebieten entfernt verarbeiten oder auf die angeblich gefahrlose Versenkung im Ozean vorbereiten. Noch gigantischer sind – wie üblich – die amerikanischen Statistiken: Im Jahr 1971 gaben die Vereinigten Staaten schon 3,5 Milliarden Dollar aus, um 112 Millionen Tonnen Papier und Kunststoff, 16 Millionen Tonnen Glas und 14 Millionen Tonnen Metall auf die verschiedenste Art und Weise beseitigen zu lassen.
Hier entstehen gewaltige neue finanzielle Lasten, die zwar aufgrund des Verursacherprinzips zuerst von der Industrie getragen werden müssen, schließlich aber doch in Form höherer Preise und Steuern auf die Öffentlichkeit abgewälzt werden. Da Großfirmen der Auto-, Luftfahrt-, Kunststoff- und chemischen Industrie, deren Produktion und Produkte an der Verschmutzung hauptschuldig sind, sich sofort durch Aufkauf kleiner oder durch Gründung eigener Firmen für Umweltkontrollerzeugnisse an dem Boom beteiligten, verdienen sie nun zusätzlich auch noch an der Beseitigung der von ihnen verursachten Schäden.
Bedenklich ist, daß diese neue Industrie zur Rettung der Umwelt selbst zu einer Umweltbelastung wird: Sie verbraucht nicht nur Rohstoffe, sondern verursacht häufig selbst Umweltschäden. Das freundliche Bild von der Säuberung des Himmels über den städtischen und industriellen Zentren Englands, das ich zu Beginn beschrieb, hat auch seine Kehrseite. Denn die dort erzielten Erfolge wurden zu einem erheblichen Teil durch vorhergehende Entschwefelung der Hausbrandkohle erzielt, ein Prozeß, der nunmehr die Luft in der Umgebung der Entschwefelungsanlagen intensiv verseucht.
Es fragt sich aufgrund solcher Tatsachen, ob die nachträgliche Beseitigung technischer Schäden nicht schnellstens durch ein präventives Vorgehen abgelöst werden sollte. Es müßte dafür gesorgt werden, daß die zerstörerischen, nachträglich meist nicht mehr gutzumachenden Begleiterscheinungen industrieller Vorgänge von vornherein ausgeschaltet werden.
Aus solchen Überlegungen heraus wurde erstmals in den USA, dann aber auch in zahlreichen anderen hochindustrialisierten Ländern ein Konzept geboren, das in den siebziger und achtziger Jahren so intensiv diskutiert werden dürfte wie heute Mitbestimmung, Bürgerinitiativen und antiautoritäre Erziehung. Es trägt den Namen «technology assessment» (technische Gesamtbewertung) und kann in mancher Hinsicht mit den Kontrollen und Prüfungen verglichen werden, die jeder Einführung eines neuen Arzneimittels vorausgehen müssen. Die Beurteilung der Droge «Technik» ist aber um vieles schwieriger. Denn es geht dabei nicht nur darum, mögliche Gesundheitsschäden abzuschätzen, sondern darüber hinaus Kettenreaktionen gesellschaftlicher Einflüsse zu überdenken, die, wie Auto und Fernsehen zeigen, von technischen Neuerungen ausgehen können.
Als «Vater» des T.A. – so die sehr schnell international in Gebrauch gelangte Abkürzung für «technology assessment» – wird der langjährige amerikanische Kongreßabgeordnete Emilio Q. Daddario, ein Sohn italienischer Einwanderer, angesehen. Die Karriere dieses Mannes ist von beispielhafter Bedeutung, denn er gehört zu einem kleinen Kreis juristisch oder nationalökonomisch ausgebildeter Politiker und Staatsmänner, die durch den wachsenden Einfluß von Naturwissenschaft und Technik gezwungen wurden, sich mit diesen, ihnen ursprünglich meist ganz fremden Fächern zu beschäftigen.
Seiner Sprachkenntnisse wegen war Daddario im Zweiten Weltkrieg – damals noch ein junger Anwaltskandidat, der seine Laufbahn vorbereitete – bei einer Abteilung des Nachrichtendienstes eingesetzt worden, die sich mit der deutschen Rüstungsforschung zu beschäftigen hatte. So erhielt er nicht nur einen tiefen Eindruck von der Bedeutung, die angewandte Forschung und technische Entwicklung in strategischen und politischen Entscheidungen zu gewinnen begannen, sondern sah auch, daß er gerade auf diesen Gebieten über viel zu geringe Kenntnisse verfügte, um seinen Pflichten als aktiver, gut informierter Staatsbürger nachkommen zu können. Nach seiner Wahl in den Kongreß im Jahre 1959 ließ den neuen Volksvertreter die Sorge um diese «Bildungslücke» nicht mehr los. Damals standen die USA unter dem Eindruck des «Sputnik-Schocks», ausgelöst durch die Tatsache, daß die Russen 1957 vor den Amerikanern einen Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht hatten. Ein Krisenprogramm («crash program») zur stärkeren Unterstützung der Universitäten, Institute und Laboratorien sollte den Vereinigten Staaten möglichst schnell wieder ihre führende Stellung zurückerobern, und die Volksvertreter hatten plötzlich über die Vergebung achtstelliger Dollarsummen für Forschungszwecke zu beraten, deren richtigen oder falschen Einsatz sie eigentlich gar nicht beurteilen konnten.
«Ich war im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen schon damals beunruhigt über unsere Bereitwilligkeit, den Weltraumzielen einen so deutlichen Vorrang zu geben», sagte mir Daddario, als ich ihn während einer seiner Europareisen interviewte. «Aber damals konnte ich das Für und Wider nur schwer abwägen. Deshalb war ich froh, daß wir 1963 eine Untergruppe des parlamentarischen Weltraumkomitees gründeten, das sich mit Wissenschaft, Forschung und Entwicklung in einem weiteren Rahmen zu befassen hatte.»
Der im Kongreß noch als Neuling geltende Italo-Amerikaner wurde aufgrund seiner guten Beziehungen zur wissenschaftlichen Welt bald zu einem der bekanntesten und beliebtesten Mitglieder der amerikanischen Volksvertretung. Eine seiner interessantesten Initiativen war die Verstärkung des wissenschaftlichen Beratungsdienstes für Parlamentarier und der Ausbau ihrer Dokumentationsmöglichkeiten auf den Gebieten Forschung und Technik. Endlich konnten die Abgeordneten der von zahlreichen wissenschaftlichen Sachverständigen beratenen Regierung ihre eigene, wissenschaftlich fundierte Meinung entgegenstellen.
Das ist also die Vorgeschichte des «technology assessment», dessen Entstehungsstunde Graham Chedd, ein in Washington arbeitender englischer Wissenschaftsjournalist, beschreibt: «All das begann, so sagt man, an einem Tisch im Restaurant des amerikanischen Repräsentantenhauses irgendwann zu Beginn des Jahres 1965. Vier Männer – einer davon Daddario – frühstückten dort jeden Morgen. Sie diskutierten bei dieser Gelegenheit über eine Bemerkung, die Jerome Wiesner, Professor des MIT (Massachusetts Institute of Technology) und früherer Wissenschaftsberater des Präsidenten, einige Tage zuvor gemacht hatte … Wiesner hatte gesagt, Amerika brauche ein Vorwarnsystem, um die Menschen vor den Folgen ihrer Erfindungen zu schützen.»
Allerdings mußte noch der Einfluß eines anderen Mannes hinzukommen, ehe aus dieser Anregung, die bei Daddario auf fruchtbaren Boden gefallen war, der Gesetzesvorschlag für eine wichtige parlamentarische Neuerung entstehen konnte. In «Reader’s Digest» hatte Charles Lindbergh, der berühmte Luftpionier, dem 1927 als erstem die Überquerung des Atlantiks im Flugzeug gelungen war, einen Artikel unter dem Titel «Is Civilisation Progress?» (Bedeutet Zivilisation Fortschritt?) geschrieben, der sich als einer der ersten im technikbegeisterten Amerika mit den Schattenseiten der industriellen Entwicklung beschäftigte. Daddario versuchte sofort, mit «Lindy» Verbindung aufzunehmen, was nicht ohne Schwierigkeiten abging, denn der einstige Liebling der Nation hatte durch seine zeitweiligen Sympathien für Hitler viel von seiner Popularität eingebüßt und sich verbittert aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Doch schließlich empfing er den Kongreßmann, und dieses Gespräch überzeugte Daddario vollends, daß dringend etwas geschehen müsse, um für die Abgeordneten eine eigene Stelle zur Beurteilung technischer Neuerungen und ihrer gesetzlichen Kontrolle zu schaffen. So wurde 1967 dem Parlament der erste Gesetzesvorschlag zur Einrichtung eines «Office of Technology Assessment» unterbreitet. Aber es dauerte noch fast ganze sechs Jahre, ehe die «bill», die diese neue demokratische Institution ermöglichen sollte, gegen den anhaltenden Widerstand der verschiedensten Interessengruppen angenommen werden konnte.
In den Diskussionen um die Einführung des T.A. – die Anfangsbuchstaben wurden von seinen Gegnern als «technology arrestment» (Hemmen der Technik) gedeutet – spielte der Kampf um die staatliche Unterstützung für das Projekt eines zivilen Überschallflugzeugs (Super Sonic Transport, abgekürzt SST) eine wichtige Rolle. Verständlicherweise, denn die Frage, ob man die Einführung dieser neuen Flugzeugtype – die in zweieinhalb Stunden von Amerika nach Europa und in fünf Stunden von New York nach Bombay fliegen würde – unterstützen oder verhindern sollte, war geradezu ein Musterbeispiel für die Probleme, mit denen sich das vorgeschlagene «Büro für technische Gesamtbewertung» zu befassen haben würde. Zum erstenmal seit Beginn der industriellen Revolution – und das ist das historisch Beispielhafte an diesem Vorgangstürzte man sich nicht mehr blind in ein technisches Abenteuer, sondern war bereit, die möglichen Nachteile vorher abzuwägen.
Daß Flugzeuge bei dieser Geschwindigkeit starke Schockwellen hervorrufen, die sich als sogenannter «Luftknall» entladen, war längst bekannt. Diese Erfahrung hatte man sofort bei den schon in Dienst gestellten Überschallmaschinen des Militärs gemacht. Annähernd so laut wie Bomben und mit starkem Explosionsdruck säten diese von den Air-Force-Piloten schlicht und heiter «Himmelsfürze» genannten Detonationen auf ihrem breiten Flugweg Unheil. Fenster gingen in Scherben, Häuser stürzten ein, Menschen wurden mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, trächtige Tiere erschraken so sehr, daß sie ihre Leibesfrucht verloren.
Solange so etwas nur in dünnbesiedelten Gebieten geschah, über denen die Militärpiloten ihre Übungsflüge durchführten, fielen diese Ereignisse einer weiteren Öffentlichkeit kaum auf. Aber die geplanten «Super Sonic Transports» sollten ja die Metropolen der USA an- und überfliegen. Zusätzliche Belastungen würden beim Starten und Landen in Flughafennähe eintreten, da eine einzige SST soviel Lärm macht wie fünfzig Jets. Wie würden sich diese empfindlichen Störungen auf die Zivilbevölkerung auswirken?
Die Befürworter des Projekts, vor allem Abgeordnete derjenigen Staaten, in denen die Flugzeugindustrie eine Rolle spielte, sowie Lobbyisten und Regierungssprecher meinten, es werde so schlimm schon nicht kommen; die Menschen würden sich eben gewöhnen. Schon im Mai 1960 hatten sie diese Behauptung bei den parlamentarischen «hearings» aufgestellt und dadurch die Volksvertreter so weit beruhigt, daß im August 1961 die erste Jahresrate in Höhe von elf Millionen Dollar für ein zweijähriges Forschungsprogramm bewilligt wurde, um die «letzten Schönheitsfehler» des SST