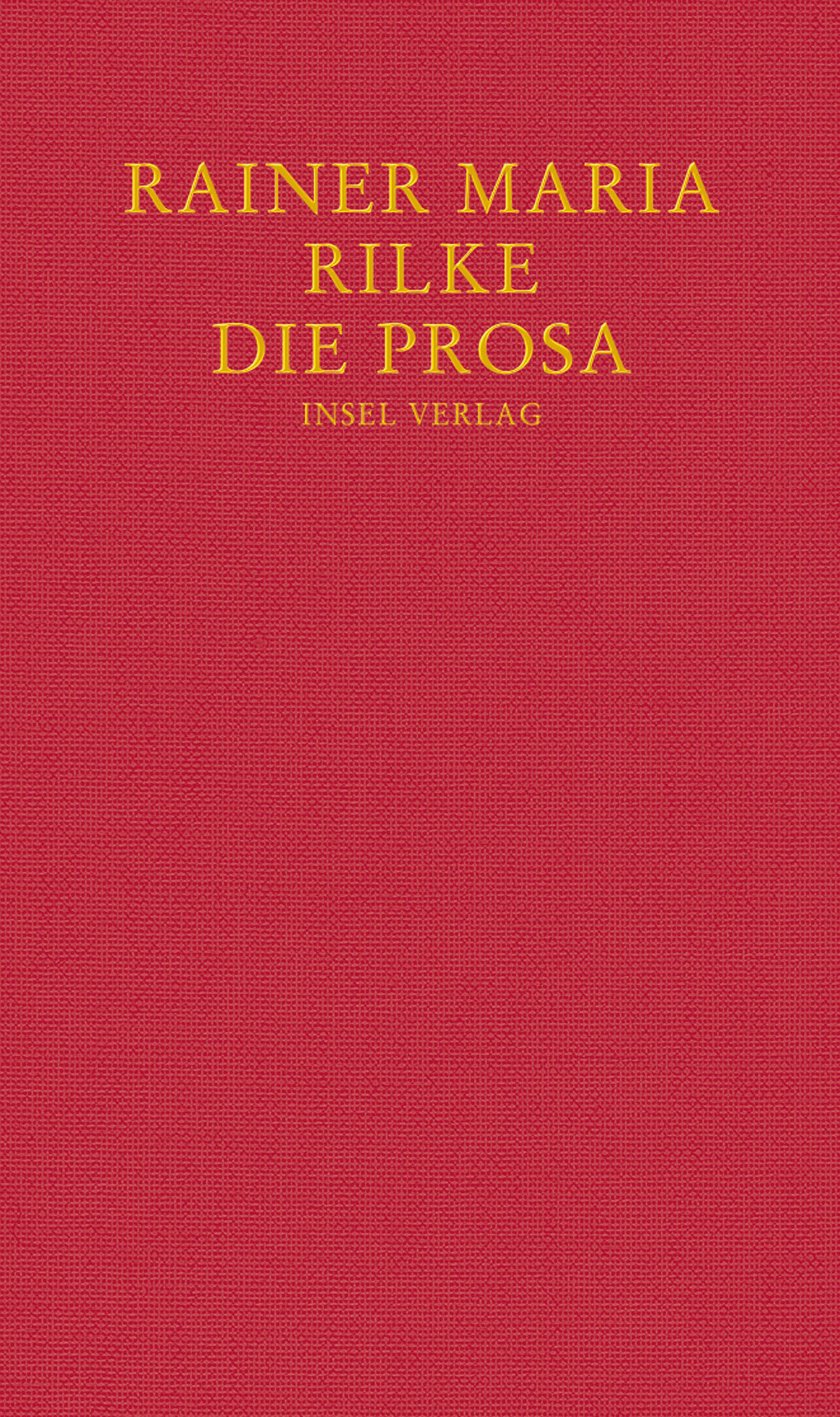
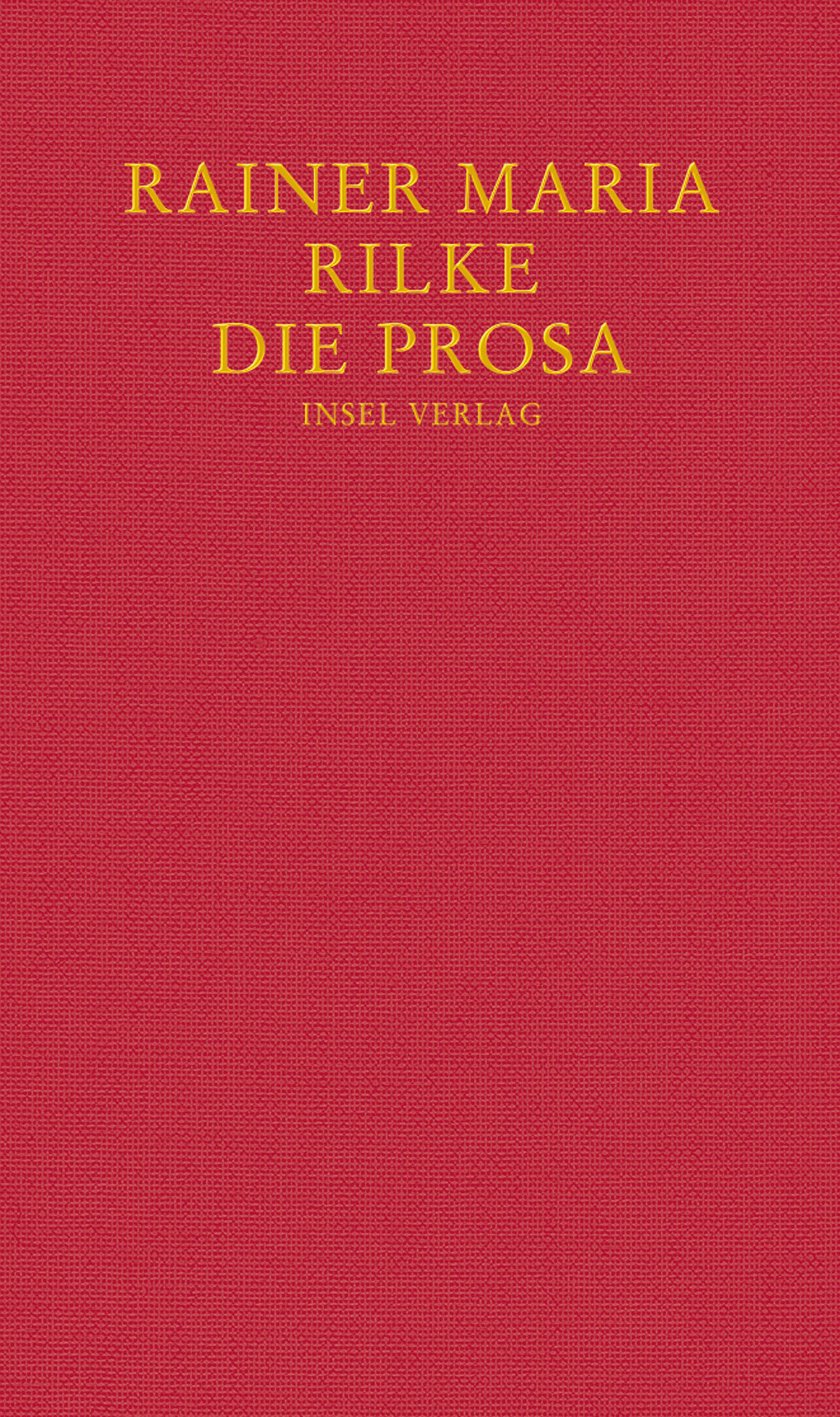
»Manche Autoren schreiben sich aus dem Leben hinaus, Rilke jedoch gehört zu denjenigen, die sich in das Leben hineinschreiben. Von diesem Drang zeugt das selbst ohne die unzähligen Briefe mehr als 2500 Seiten umfassende Prosawerk, zu dem neben dem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge Bücher zur Kunst, Essays, Erzählungen, Novellen, Prosagedichte gehören. Die ungemeine Lebendigkeit von Rilkes Prosa entspringt dem unwillkürlichen Drang, die oft übersehenen Dimensionen unserer Existenz zu Gehör zu bringen und sich in diesem Akt des Sprechens auch das eigene Leben zu erkämpfen.« (Ulrich C. Baer)
RAINER MARIA RILKE
DIE PROSA
Herausgegeben von
Ulrich C. Baer
Insel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016
© Insel Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-458-75053-6
www.suhrkamp.de
In der Ecke eines Zimmers stand ein Schwert. Die helle, stählerne Fläche seiner Klinge erglänzte, vom Strahle der Sonne berührt, in rötlichem Scheine. Stolz hielt das Schwert Umschau im Zimmer; es sah, daß alles sich an seinem Glasten weidete. Alles? – Nicht doch! Dort auf dem Tische lag, müßig an ein Tintenfaß gelehnt, eine Feder, der es nicht im mindesten einfiel sich vor der glitzernden Majestät jener Waffe zu beugen. – Das ergrimmte das Schwert und es begann also zu sprechen:
»Wer bist du wohl, nichtswürdig Ding, daß du nicht gleich den andern vor meinem Glanze dich beugst und ihn bewunderst? Sieh nur um dich! Alle Geräte stehen ehrfurchtsvoll in tiefes Dunkel gehüllt. Mich allein, mich hat die helle beglückende Sonne zu ihrem Liebling erkoren; sie belebt mich mit ihrem wonnigen Flammenkusse, und ich lohne ihrs, indem ich ihr Licht tausendfach widerstrahle. Mächtigen Fürsten nur ziemt es, in leuchtendem Gewande daherzuschreiten. Die Sonne kennt meine Macht, darum legt sie mir den königlichen Purpur ihrer Strahlen um die Schultern.«
Lächelnd erwiderte drauf die besonnene Feder:
»Sieh doch, wie eitel und stolz du bist und wie du dich brüstest mit dem erborgten Glanze! Sind wir doch beide – besinne dich – ganz nahe Verwandte. Beide hat uns die sorgende Erde geboren, beide sind wir im Urzustand vielleicht im selben Gebirge neben einander gestanden – Jahrtausende lang; bis der Menschen geschäftiger Fleiß die Ader des nützlichen Erzes, deren Bestandteile wir waren, entdeckte. Beide nahm man uns weg; beide sollten wir, ungefüge Kinder der rauhen Natur noch, ober der Hitze der dampfenden Esse, unter des Hammers mächtigen Schlägen zu nützlichen Gliedern des irdischen Treibens umgeschaffen werden. Und so auch geschah es. Du wurdest ein Schwert – bekamst eine große und feste Spitze; ich, eine Feder, wurde mit einer dünnen, zierlichen bedacht. Sollen wir wirklich schaffen und wirken, müssen wir uns erst die glänzende Spitze benetzen. Du – mit dem Blute, ich – nur mit – Tinte!«
»Diese Rede, in gelehrtem Stile gehalten,« fiel nun das Schwert ein, »macht mich lachen fürwahr. Ist es doch grade, als wollte die Maus, das kleine nichtige Tierchen, ihre nahe Verwandtschaft mit dem Elefanten beweisen. Die spräche dann so wie du! Denn auch sie hat gleich dem Elefanten vier Beine und hat sich sogar eines Rüssels zu rühmen. So könnte man glauben, sie seien zum wenigsten Vettern! Du hast, liebe Feder, sehr schlau und berechnend jetzt das nur genannt, worin ich dir gleiche. Ich aber will dir erzählen, was uns unterscheidet. Ich, das glänzende, stolze Schwert, werde um die Hüfte geschnallt von einem kühnen, edlen Ritter; dich aber, dich steckt ein altes Schreiberlein hinter sein langes Eselsohr. Mich erfaßt mein Herr mit kräftiger Hand und trägt mich in die Reihen der Feinde; ich führe ihn hindurch. Dich, beste Feder, führt dein Magister mit zitternder Hand über vergilbtes Pergament. Ich wüte furchtbar unter den Feinden, springe mutig, tollkühn bald her, bald hin; du kratzest in ewiger Monotonie über dein Pergament hin und wagst dich nicht ein Stückchen aus jenen Bahnen, die dir die führende Hand vorsichtig weist. Und endlich, endlich – geht meine Kraft zu Ende, werde ich alt und schwach, dann ehrt man mich, wie es Helden geziemt, stellt mich im Ahnensaale zur Schau und bewundert mich. Was aber geschieht mit dir? Ist dein Herr mit dir unzufrieden, wirst du alt und beginnst du mit dicken Strichen über das Papier hinzukreuchen, packt er dich, entreißt dich dem Stiele, der dir Stütze war, und wirft dich weg, wenn er nicht Gnade übt und dich mit ein paar deiner Schwestern um wenige Kreuzer einem Trödler verkauft.«
»Du magst ja in mancher Beziehung«, versetzte die Feder sehr ernst, »so unrecht nicht haben. Daß man mich oft gering schätzt, ist ja wahr, ebenso wie, daß man mich, nachdem ich unbrauchbar geworden bin, sehr übel behandelt. Doch deswegen ist die Macht, die mir zu Gebote steht, solange ich arbeiten kann, keine geringe. Es kommt ja nur auf eine Wette an!«
»Du wolltest mir eine Wette anbieten?« lachte das übermütige Schwert.
»Wofern du wagst, dieselbe anzunehmen.«
»Und ob ich sie annehme«, versetzte das Schwert, das sich noch immer nicht vom Lachen erholen konnte.
»Was gilt die Wette?«
Die Feder aber setzte sich zurecht, nahm eine strenge Amtsmiene an und begann:
»Wir wollen wetten, daß ich imstande bin, dich zu hindern, deiner Arbeit, dem Kampfe, nachzugehen, wenn ich will!«
»Ho, ho, das klingt ja kühn.«
»Bist du's zufrieden?«
»Ich gehe darauf ein.«
»Nun wohl,« sagte die Feder, »laß uns sehen.«
Es waren wenige Minuten seit dem Abschlusse dieser Wette vergangen, als ein junger Mann in reichem Waffenkleide eintrat, das Schwert faßte und sich dasselbe anlegte. Hierauf betrachtete er wohlgefällig die blanke Klinge. Von draußen erschallte heller Trompetenruf, Trommelwirbel – es ging zur Schlacht. Eben wollte der junge Mann das Zimmer verlassen, als ein anderer, der eine hohe Stelle bekleiden mußte, wie man aus seinem reichen Schmucke ersah, eintrat. Der junge verneigte sich tief vor ihm. Der Würdenträger war indessen an den Tisch getreten, hatte die Feder erfaßt und eilends etwas hingeschrieben. »Der Friedensvertrag ist schon unterzeichnet«, sagte er lächelnd. Der Jüngere stellte sein Schwert wieder in die Ecke, und beide verließen das Zimmer.
Auf dem Tische aber lag die Feder. Der Sonnenstrahl spielte mit ihr, und ihr feuchtes Erz glitzerte hell.
»Ziehst du nicht zum Kampfe, mein liebes Schwert?« fragte sie lächelnd.
Das Schwert aber stand still in der finsteren Ecke. Ich glaube, es prahlte nie wieder.
Die Lokomotive schmetterte einen schier endlosen Pfiff in die blaue Luft des schwülen, lichtflimmernden Augustmittags. – Pierre saß mit seiner Mutter in einem Abteil zweiter Klasse. Die Mutter eine kleine, bewegliche Frau in schlichtem, schwarzem Tuchkleide, mit einem blassen, guten Gesicht und erloschenen trüben Augen, – Offizierswitwe. Ihr Sohn ein kaum elfjähriger Knirps in der Uniform der Militär-Erziehungsanstalten.
»Da sind wir«, sagte Pierre laut und freudig und hob sein schlichtes graues Kofferchen aus dem Garnnetz. In großen, steifen, ärarischen Lettern stand darauf zu lesen: Pierre Dumont. I. Jahrgang No 20. Die Mutter sah schweigend vor sich hin. Jetzt kamen ihr die großen, eigensinnigen Buchstaben vor Augen, als der Kleine das Gepäcksstück auf den Sitz gegenüber stellte. Sie hatte sie schon hundertmal wohl auf der mehrstündigen Reise gelesen. Und sie seufzte. – Sie war nicht gerade empfindsam und hatte an der Seite des verstorbenen Kapitäns das Wesen des Soldatenlebens kennen gelernt und sich daran gewöhnt. Aber das tat ihrem Mutterstolze doch weh, daß ihr Pierre, dessen kleine Person eine gar bedeutende Persönlichkeit in ihrem Herzen darstellte, so zur Nummer herabgedrückt worden war. – No 20. Wie das klang!
Pierre stand indessen am Fenster und schaute in die Gegend hinaus. Sie waren hart vor der Station. Der Zug fuhr langsamer und polterte über die Wechsel. Draußen glitten grüne Grasdämme, weite Flächen und winzige Häuschen vorüber, an deren Türen riesige Sonnenblumen mit ihren gelben Heiligenscheinen als Wächter standen. Die Türen aber waren so klein, daß Pierre dachte, er müßte sich wohl gar auch bücken, um eintreten zu können. – Da verloren sich schon die Häuschen. – Schwarze, rauchige Magazine kamen mit vielfach geteilten, blinden Scheiben, die Bahn wurde immer breiter, ein Geleise wuchs neben dem andern hervor, und endlich fuhren sie mit lautem Brausen und Zischen in die Bahnhofhalle des kleinen Städtchens ein. –
»Wir wollen heute noch recht, recht lustig sein, Mama«, flüsterte der Kleine und umfaßte die erschrockene Frau mit stürmischem Ungestüm. – Dann hob er den Koffer heraus und war seinem Mütterchen beim Aussteigen behilflich. Mit stolzer Miene reichte er ihr dann den Arm, den Frau Dumont, obwohl sie nicht groß war, nur insoweit annehmen konnte, daß sie ihrem Kavalier die linke Hand unter die Achsel schob. – Ein Diener hatte sich des Koffers bemächtigt. – So wanderten sie denn durch den glutheißen Mittag die staubige Straße dem Gasthofe zu. –
»Was wollen wir speisen, Mutter?«
»Was du willst, Liebling!«
Und jetzt erörterte Pierre alle seine Lieblingsspeisen, mit denen man ihn zuhause während der zweimonatlichen Ferien gefüttert hatte. Ob das und jenes hier auch zu haben wäre. Und man sprach von der Suppe bis zum Apfelkuchen mit der Crêmehaube alles mit lukullischer Genauigkeit durch. – Der kleine Soldat war voll des Scherzes; diese Lieblingsgerichte schienen die Wirbelsäule seines Lebens zu bilden, an deren Grundstock sich erst alle anderen Ereignisse anfügten. Denn immer wieder begann er: Weißt du, als wir das und das zum letztenmale aßen, da war dies und jenes geschehen. Freilich kam ihm dabei auch in den Sinn, daß er ja heute für vier Monate zum letzten Mal solcher Genüsse sich erfreuen würde, – und dann ward er ein wenig still und seufzte ganz leise. – Aber der sonnige, fröhliche Sommertag verfehlte seine Wirkung auf das Kindergemüt nicht, und er schwatzte bald wieder in übermütiger Weise fort und durchdachte die schönen Tage des schwindenden Urlaubs. Jetzt war es zwei Uhr mittags. Um sieben Uhr mußte er in der Kaserne sein – also noch fünf Stunden. – Fünfmal also mußte der große Zeiger noch rund ums Zifferblatt laufen – – das ist ja noch sehr, sehr lange. –
Das Essen war vorüber. Pierre hatte tüchtig zugesprochen. Nur als die Mutter ihm den roten Wein einschenkte, mit nassen Augen ein wenig das Glas hob und ihn bedeutungsvoll anschaute, da blieb ihm der Bissen in der Kehle stecken. – Sein Blick wanderte durchs Zimmer. Auf dem Zifferblatt blieb er haften: es war drei Uhr. Viermal muß der Zeiger … dachte er. Das gab ihm Mut. Er hob seinen Kelch und stieß etwas heftig an. »Auf recht frohes Wiedersehen, Mütterchen!« Seine Stimme klang hart und verändert. Und rasch küßte er, als fürchtete er wieder weich zu werden, die kleine Frau auf die bleiche Stirne.
Nach dem Essen gingen sie selbander am Flußufer auf und nieder. Wenig Leute begegneten ihnen. Sie konnten ganz ungestört miteinander sprechen. Aber das Gespräch stockte oft. Pierre trug den Kopf hoch, hielt beide Hände in den Hosentaschen und schaute mit großen, blauen Augen geistesabwesend hinüber über den glastenden Fluß auf die violetten Hänge des jenseitigen Ufers. Frau Dumont aber bemerkte, wie in der Allee, welche sie durchschritten, die Blätter schon gelb und matt wurden. Hie und da lagen sogar schon welche auf dem Wege; als eines unter ihrem Fuße knirschte, erschrak sie.
»Es wird Herbst«, sagte sie leise.
»Ja«, murmelte Pierre zwischen den Zähnen.
»Aber wir haben einen schönen Sommer gehabt –« fuhr Frau Dumont fast verlegen fort.
Ihr Sohn antwortete nicht.
»Mutter,« er wandte ihr das Gesicht nicht zu, während er so sprach, »Mutter, der lieben Julie sagst du meine Grüße – nichtwahr.« – Er verstummte und ward rot.
Die Mutter lächelte: »Du kannst dich darauf verlassen, mein Pierre.« Julie war ein Cousinchen, für das der kleine Kavalier schwärmte. Er hatte ihr oft Fensterpromenaden gemacht, hatte mit ihr Ball gespielt, ihr Blumen geschenkt und trug – das wußte nicht einmal Frau Dumont – Cousinchens Bild in der linken Brusttasche des Waffenrockes.
»Julie kommt ja gewiß auch außer Haus«, meinte die Mutter, froh, den Kleinen auf dieses Thema gebracht zu haben. »Sie kommt zu den Englischen Fräuleins oder Sacrecœur …..« Die Witwe kannte ihren Pierre. Der Umstand, daß die Angebetete ein ähnliches Los ertragen sollte, tröstete ihn, und er machte sich im Stillen Vorwürfe über seine Kleinmütigkeit. Mit kindischer Phantasie übersprang er die bevorstehenden Schulmonate:
»Aber wenn ich zu Weihnachten nach Hause komme, wird Julie doch auch da sein !?«
»Gewiß. –«
»Und du wirst sie einladen, bestes Mamachen, am Weihnachtsabend, ja?«
»Sie hat mir schon im vorhinein zugesagt und mir versprechen müssen, daß sie sich recht lange bei ihrer Mutter ausbittet.«
»Herrlich!« jubelte der Knabe, und seine Augen glänzten.
»Dir werd ich einen schönen Christbaum vorrichten, und wenn du sehr brav bist …..«
»Am Ende …. die neue Uniform!«
»Wer weiß, wer weiß –« lächelte die kleine Frau.
»Herzensmütterchen!« rief der junge Held und scheute sich nicht, mitten auf dem Promenadenweg Frau Dumont stürmisch zu küssen, – »du bist so gut! ….«
»Sei nur fein brav, Pierre!« sagte die Mutter ernst.
»Und wie! Lernen will ich ….«
»Mathematik, weißt du, das geht dir schwer!«
»Es wird Alles ganz trefflich werden, du wirst sehen.«
»Und daß du dich nicht verkühlst, jetzt kommt die kältere Jahreszeit, – zieh dich nur immer warm an. – Nachts steck dir die Decke wohl ein, damit du dich nicht abdeckst!«
»Ohne Sorge, ohne Sorge!« Und Pierre begann wieder von den Begebnissen des Urlaubs zu reden. Da gabs so viel des Drolligen und Spaßhaften, daß beide, Mutter und Sohn, herzhaft lachten … Plötzlich fuhr er zusammen. Vom Kirchturm wogten volle Glockentöne.
»Sie läuten sechs«, sagte er und versuchte zu lächeln.
»Komm zum Zuckerbäcker.«
»Ja, dort gibt es die guten Crêmerollen. Zum letzten Mal aß ich sie, als wir den Ausflug machten mit Julie …«
Pierre saß auf dem dünnbeinigen Rohrstühlchen im Gewölbe des Bäckers und kaute mit runden Backen. – Er hatte eigentlich schon genug, und nach manchem Bissen mußte er tief Atem holen; – aber es war ja zum letzten Mal – und er aß fort.
»Es freut mich, daß es dir schmeckt, Kind«, sagte Frau Dumont, die an einer Tasse Kaffee nippte.
Pierre aber aß fort. –
Einmal schlugs vom Turm. »Halb sieben«, murmelte der Urlauber und seufzte. Der Magen war ihm furchtbar schwer. – Nun, sie würden ja jetzt noch gehen …
Und sie gingen. – Der Augustabend war lau, und ein wohltuendes Lüftchen strich in den Bäumen der Allee.
»Ist dir nicht kühl, Mutter?« fragte der Kleine gedankenlos.
»Mach dir keine Sorgen, Liebling.«
»Was wird denn Belly machen?« Belly war ein kleiner Rattler.
»Ich hab ihn der Magd anbefohlen, sie gibt ihm sein gewöhnliches Fressen und führt ihn spazieren …«
»Sag dem Belly, ich laß ihn grüßen, – er soll schön brav sein …« Er versuchte zu scherzen, aber er brach jäh ab. –
»Hast du Alles beisammen, Pierre?« Fern tauchte schon die eintönige graue Front der Kaserne auf. »Dein Certificat?«
»Alles, Mutter!«
»Mußt du dich noch melden heute?«
»Ja, gleich.«
»Und morgen hast du wieder Schule?«
»Ja!«
»Und du schreibst mir?«
»Du auch, Mamachen – bitte! – Gleich wie du ankommst.«
»Natürlich, liebes Kind.«
»Ich glaube, der Brief dauert doch immer zwei Tage.«
Die Mutter konnte nicht reden; es schnürte ihr die Kehle.
Jetzt waren sie dicht am Portal!
»Dank dir, Mama, für den schönen Tag.« Dem armen Kleinen war elend zu Mute; offenbar hatte er zu viel gegessen. Er hatte heftige Magenschmerzen, und die Füße zitterten ihm. –
»Du bist blaß –« sagte Frau Dumont.
»Nicht doch.« Das war eine arge Lüge, er wußte es.
Wie es ihm zu Kopf stieg! Er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
»Mir ist wirklich ……« Da schlug es sieben!
Sie lagen sich beide in den Armen und weinten.
»Mein Kind!« schluchzte die arme Frau.
»Mama, ich bin ja in hundertzwanzig Tagen …«
»Sei brav, bleib gesund …..« und mit zitternder Hand machte sie dem Kleinen das Kreuzeszeichen ….
Pierre aber riß sich los: »– Ich muß laufen, Mutter, sonst bekomm ich Strafe«, stammelte er, »…. und schreib mir, Mutter, und Julie, weißt du, und Belly –« Noch ein Kuß, und fort war er.
»Mit Gott!« – Er vernahm es nicht mehr. –
Am Tore schaute er sich noch einmal um. Er sah die kleine schwarze Gestalt dort zwischen den verdämmernden Bäumen – und schluckte hastig die Tränen hinunter ….
Aber es war ihm doch sehr schlecht.
Er taumelte in den breiten Flur hinein …. er war so müde ….
»Dumont!« rief eine brutale Stimme.
Der Unteroffizier von der Torwache stand vor ihm.
»Dumont! Zum Teufel, wissen Sie nicht, daß Sie sich zu melden haben? …«
Gasttafel im ersten Hotel von N. – An die Marmorwände des hohen, hell erleuchteten Saales brandet Raunen der Menschen und Rasseln der Messer. Geschäftig, gleich lautlosen Schatten, huschen die schwarzbefrackten Diener mit den silbernen Platten hierhin und dorthin. Aus den blanken, hochbeinigen Eiskübeln blinzeln die Sektflaschen nach den flachen Weinschalen hin. Alles glänzt und flimmert in den Strahlen der elektrischen Lampen. Die Augen und die Schmucksteine der Damen, die Glatzen der Herren und endlich die Worte, die hin und wider hüpfen wie Feuerfunken. Wenn sie zünden, schlägt einmal nah, einmal fern die grelle Lohe eines kurzen Lachens aus einer Frauenkehle. Dann schlürfen die Damen eifrig die duftende Brühe aus den feinen, durchschimmernden Tassen, während die jüngeren Herren den Kneifer über die Nase spreizen und mit kritischem Blick die bunte Tafelrunde mustern.
Sie saßen alle schon seit Tagen so beisammen. Nur am Ende des Tisches hatte ein neuer, fremder Gast Platz genommen. Die Herren ließen ihr Auge flüchtig über diese Erscheinung weggleiten, denn der bleiche, ernste Mann, der dort unten saß, trug nicht modische Kleidung. Ein hoher, schneeweißer Kragen schmiegte sich bis an sein Kinn hinauf, und die breite, schwarze Binde, die man im ersten Dritteil unseres Jahrhunderts trug, umschloß den Hals. Der schwarze Rock ließ kein Stückchen der Hemdbrust sehen und lag feierlich auf den breiten Schultern. Was aber die Herren noch unangenehmer berührte, war das große, graue Auge des Ankömmlings, das hoheitsvoll und mächtig durch die ganze Gesellschaft, durch die Wandung des Raumes zu dringen schien, und das leuchtete, als ob ein fernes, schimmerndes Ziel sich beständig drin spiegelte. Dieses Auge veranlaßte die neugierigen, heimlichen Blicke der Frauen. Man munkelte sich über den Tisch hinüber Vermutungen zu, man stieß sich ganz leise mit den Füßen an, man fragte, forschte, zuckte die Achseln und wurde trotz alledem nicht klüger.
Im Mittelpunkt der Unterhaltung stand die polnische Baronin Vilovsky, eine geistreiche, jüngere Wittib. Auch sie schien schon Interesse für den schweigsamen Fremdling gefaßt zu haben. Ihre schwarzen, großen Augen hingen mit auffallender Ausdauer an seinen durchgeistigten Zügen. Ihre schmale Hand trommelte nervös auf dem weißen Damast des Tischtuches, daß der prächtige Brillant auf dem kleinen Finger Blitz um Blitz schoß. Sie griff in begieriger, kindischer Hast bald dies, bald jenes Thema auf und brach dasselbe in einer Weile jäh und trotzig ab; denn der Fremde wollte sich durchaus nicht beteiligen. – Sie hielt ihn für einen Künstler. In bewundernswert feiner Art wußte sie um alle Künste nach und nach den Faden des Gespräches zu schlingen. Umsonst. Der schwarze Herr schaute groß und ernst ins Weite. – Baronin Vilovsky aber gab sich nicht verloren.
»Sie haben doch von dem großen Brandunglück im Dorfe B. gehört?« wandte sie sich zu einem Herrn an ihrer Seite. Und als man bejahte: »Ich denke, wir bilden ein Komitee, das irgend eine Wohltätigkeitsveranstaltung, verbunden mit Sammlung, ins Leben rufen soll?« Sie sah fragend umher. Lauter Beifall lohnte ihr. Über die Züge des Unbekannten huschte ein höhnisches Lächeln. Die Freiin fühlte dieses Lächeln, ohne daß sie es sah: Zorn wühlte in ihr.
»Sind Alle einverstanden?« rief sie jetzt im Ton einer Herrscherin, die keinen Widerspruch erwartet. Ein Stimmenchaos: »Ja!« »Einverstanden!« »Natürlich!«
Mein Gegenüber, ein Kölner Bankherr, legte schon wie beteuernd seine Hand auf die Brusttasche, in welcher sich die Banknoten stauten.
»Dürfen wir auch auf Sie rechnen, mein Herr?« So die Baronin dem Fremden. Ihre Stimme zitterte. Jener erhob sich ein wenig und sagte laut, ohne den Blick zu wenden, mit brutalem Ton: »Nein!« Die Baronin zuckte zusammen. Dann zwang sie sich zu lächeln. Aller Augen waren auf den Fremden gerichtet. Der wandte sein Auge der Freifrau zu und fuhr fort:
»Sie tun ein Werk der Liebe; ich geh in die Welt, um die Liebe zu töten. Wo ich sie finde, da morde ich sie. Und ich finde sie oft genug in Hütten und Schlössern, in Kirchen und in der freien Natur. Aber ich folge ihr unerbittlich. Und wie der starke Lenzwind die Rose bricht, die sich zu früh hervorgewagt, so vernichte ich sie mit meinem großen, zürnenden Willen: denn zu früh ward uns das Gesetz der Liebe.« Seine Stimme verhallte dumpf, wie der Glockenton beim Ave. Die Baronin wollte entgegnen, aber der Mann fuhr fort: »Sie verstehen mich noch nicht. Hören Sie: Die Menschen waren unreif, als der Nazarener zu ihnen kam und ihnen die Liebe brachte. Er, in seinem lächerlich kindischen Edelmut, glaubte ihnen ein Gutes zu tun! – Für ein Geschlecht von Giganten wäre die Liebe ein herrliches Ruhekissen, in dessen wollüstiger Weise sie neue Taten träumen dürften. Den Schwachen aber ist sie Ruin.« – Ein katholischer Priester, der anwesend war, griff mit der linken Hand nach seiner Halsbinde, als wäre sie ihm plötzlich zu enge geworden.
»Ruin!« dröhnte es aus dem Munde des Fremden. »Ich spreche nicht von der Liebe der Geschlechter. Von der Nächstenliebe spreche ich, von Mitleid und Erbarmen, von Gnade und Nachsicht. Es giebt keine schlimmeren Gifte in unserer Seele!« Der Priester gurgelte etwas durch die dicken Lippen.
»Christus, was hast du getan! Mir ist, man hat uns aufgezogen, wie jene Raubtiere, denen man ihren innersten Trieb mit berechnender Klugheit genommen, damit man, wenn sie zahm geworden, ungestraft mit Knuten auf sie einhauen darf. – So hat man uns die Zähne abgefeilt und die Klauen, und man hat uns gepredigt: Liebe! Man hat uns die Eisenrüstung unserer Kraft von den Schultern gezogen und hat uns gepredigt: Liebe! Man hat uns den Demantspeer unseres stolzen Willens aus den Händen gewunden und hat uns gepredigt: Liebe! Und so hat man uns nackend und bloß in den Sturm des Lebens gestellt, wo die Keulenschläge des Schicksals auf- und niedersausen, – und man predigt uns: – Liebe!«
Atemlos lauschte alles dem Sprecher. Die Diener wagten sich nicht vom Platze und standen verlegen, die Silberplatten in Händen, zuseiten des Tisches. – Wie ein heißes Gewitter donnerten die Worte des Begeisterten in das schwüle Schweigen.
»…… und wir haben – gehorcht«, hub der seltsame Fremdling wieder an. »Wir haben blind und blöde diesem wahnwitzigen Befehle gehorcht. Wir haben die Dürstenden aufgesucht, die Hungernden, die Kranken, die Aussätzigen, die Schwachen, die Elenden, und – wir sind selbst dabei dürstend, hungernd, krank, elend geworden! Wir haben unser Leben hingebracht, Gefallene aufzurichten, Zweifelnden zu raten, Betrübte zu trösten, – und wir sind selbst dabei verzweifelt! – Wir haben dem, der uns Weib und Kinder gemordet, der uns den eigenen Herd mit der Axt der Zwietracht gespalten, wir haben ihm nicht den schurkischen Schädel zerschmettert, – wir haben ihm – eine Hütte erbaut, in der er friedlich erschauen kann das Ende der Tage!«
Furchtbarer Hohn bebte in seiner Stimme. – »Der, den sie als Messias preisen, hat die ganze Welt zum Siechenhaus gemacht. Die Schwachen, Elenden, Hinfälligen nennt er seine Kinder und Lieblinge. Und die Starken, die sind dazu da, diese kraftlose Brut zu beschützen, zu besorgen, zu bedienen !? Und wenn ich es in mir fühle heiß, innig und himmlisch, das stürmende Drängen nach Licht, und wenn ich mit festem Fuß den steilen, steinigen Pfad der Erreichung aufwärts steige, und wenn ich es leuchten sehe, das lodernde, göttliche Ziel, – dann soll ich mich zu dem Krüppel bücken, der am Wege zusammengesunken dahockt, soll ihn loben, aufrichten, mitschleppen und soll meine fiebernde Kraft versickern lassen in dem ohnmächtigen Kadaver, der nach wenigen Schritten doch wieder hintaumelt? – Wie sollen wir denn hinauf, wenn wir unsere Stärke den Elenden leihen, den Bedrängten, den faulen, sinn- und marklosen Schurken?!« – Eine Unruhe erhob sich, ein Murren.
»Schweigen!« donnerte der Schwarze. »Zu feig sind Sie, einzugestehen, daß dem so ist. Sie wollen ewig im Sumpfe fortwaten; Sie glauben, Sie sehen den Himmel, weil Sie das schauen, was sich schmutzig in der Gosse spiegelt. – – Verstehen Sie mich doch! Man hat unsere Kraft an die Erde gebunden. Elend muß sie verglimmen auf dem Opferherde der Barmherzigkeit. Einzig dazu soll sie gut sein, den Weihrauch des Mitleids zu entzünden, den Dunst, der unsere eigenen Sinne betäuben soll? Sie, die Kraft, die bis zum Himmel züngeln kann in freier, großer, jauchzender Flamme?!«
Alles schwieg. Mit Lächeln fuhr der herrliche Mann fort.
»Und wenn unsere Altvordern Affen waren, wilde Tiere mit großen Naturtrieben, und wenn ihnen ein Messias erstanden wäre, der ihnen Nächstenliebe gepredigt hätte, sie hätten, seinem Wort gehorchend, nie zu höherer Entwickelung emporklimmen dürfen. Nie kann die stumpfe, vielsinnige Menge Träger des Fortschritts sein; nur der ›Eine‹, der Große, den der Pöbel haßt im dumpfen Instinkte eigener Kleinheit, kann den rücksichtslosen Weg seines Willens mit göttlicher Kraft und sieghaftem Lächeln wandeln. – Auch unser Geschlecht ist nicht die Spitze der unendlichen Pyramide des Werdens. Auch wir sind nicht vollendet. Auch wir sind unreif, nicht überreif, wie ihr im Dünkel so gerne wähnet. Darum vorwärts! Sollen wir nicht höher steigen dürfen in Erkenntnis, Willen und Macht? Soll es nicht den Starken gelingen, aus der Zwangatmosphäre des Massenneides emporzuschweben zum Lichte!?
Hört mich, ihr – Alle: Ihr steht im Kampfe! Rechts und links fallen eure Nebenmänner; fallen, getroffen von Schwäche, Krankheit, Laster, Wahnsinn! …. und wie alle die Geschosse heißen, die das schreckliche Schicksal speit. Laßt sie sinken! Laßt sie hinsterben allein und elend. Seid hart, seid furchtbar, seid unerbittlich! Ihr müßt vorwärts, vorwärts!
Was schaut ihr so entsetzt? Seid auch ihr Schwächlinge, – Alle? Fürchtet auch ihr zurückzubleiben?! Bleibt! Verendet wie Hunde! Der Starke nur hat Recht zu leben. Der Starke geht – – vorwärts …. und die Reihen werden sich lichten; – aber wenige Große, Gewaltige, Göttliche werden sonnigen Auges das neue, gelobte Land erreichen. Vielleicht nach Jahrtausenden erst. – Und sie werden ein Reich bauen mit starken, sehnigen, herrischen Armen auf den Leichen der Kranken, der Schwachen, der Krüppel …..
…….. Ein ewiges Reich!« –
Sein Auge brannte. Er war aufgestanden. Die schwarze Gestalt erstreckte sich übergroß in die Höhe. Es war, als ob ein Lichtschein sie umrahme. –
Er sah wie ein Gott aus.
Sein Blick hing weit an der herrlichen Vision seiner Seele; dann kehrte er jäh aus den Fernen zurück, und er sprach:
»Ich gehe in die Welt, die Liebe zu töten. Kraft sei mit euch! – Ich gehe in die Welt und predige den Starken: Haß! Haß! Aberhaß!« –
Alle sahen sich sprachlos an. Die Baronin preßte, überwältigt von einem unbeschreiblichen Gefühl, ihr Tuch an die Augen.
Als sie aufsah, war der Platz am Ende der Tafel – leer.
Ein Schauder durchrieselte alle.
Niemand sprach.
Die Diener reichten zaghaft die Speisen.
Mein Gegenüber, der dicke Bankherr, gewann zuerst seine Sprache wieder.
Er brummte zu mir her: »Das war entweder ein Narr, oder ….« Das Folgende verstand ich nicht; denn er kaute mit vollen Backen ein Stück Hummerpastete.
»Unser Herrgott hat sonderbare Kostgänger.« Das war das Lieblingswort des Studenten Vinzenz Viktor Karsky, und er wandte es in passenden und unpassenden Augenblicken stets mit einer gewissen Überlegenheit an, vielleicht weil er sich selbst im Stillen zu dieser Sorte rechnen mochte. Seine Genossen nannten ihn längst einen sonderbaren Kauz; sie schätzten seine Herzlichkeit, die oft an Sentimentalität grenzte, freuten sich an seinem Frohsinn, ließen ihn einsam, wenn er traurig war, und duldeten seine ›Überlegenheit‹ mit gutmütigem Vergeben.
Diese Überlegenheit Vinzenz Viktor Karskys bestand darin, daß er für Alles, was er tat oder unterließ, einen glänzenden Namen fand und, ohne zu prahlen, mit einer gewissen gereiften Sicherheit Tat auf Tat legte, wie einer, der aus tadellosen Steinen eine Mauer baut, die für alle Ewigkeit stehen soll.
Nach einem guten Frühstück sprach er gerne über Literatur, wobei er niemals tadelte oder verwarf, sondern nur die ihm angenehmen Bücher einer mehr oder minder innigen Anerkennung würdigte. Das klang dann wie eine allerhöchste Sanktion. Bücher, die ihm schlecht schienen, pflegte er überhaupt nicht zu Ende zu lesen, sagte aber dann auch kein Wort darüber, selbst wenn andere des Lobes voll waren.
Sonst hielt er sich gegen die Freunde nicht zurück, erzählte alle seine Erlebnisse, auch die intimer Art, mit liebenswürdigem Freimut und ließ es über sich ergehen, daß sie fragten, ob er nicht wieder versucht hätte, ein Proletarierkind ›zu sich emporzuheben‹. Man erzählte sich nämlich, daß Vinzenz Viktor Karsky bisweilen solche Versuche unternehme. Dabei mochten ihm seine tiefen blauen Augen und seine einschmeichelnde Stimme wohl zu gar manchem Erfolge verhelfen. Immerhin schien er die Zahl dieser Erfolge rastlos mehren zu wollen und bekehrte mit dem Eifer eines Religionsstifters eine Unzahl kleiner Mädchen zu seiner Glückseligkeitstheorie. Am Abend begegnete ihm ab und zu einer der Genossen, wenn er, eine blonde oder braune Gefährtin leicht unter dem Arme führend, seines Lehramts waltete. Und die Kleine lachte dann gewöhnlich mit dem ganzen Gesicht, Karsky aber machte eine so wichtige Miene, als wollte er sagen: »Unermüdlich im Dienste der Menschheit.« Kam aber mal einer und erzählte, daß der oder jener »hängen geblieben« wäre und nun in die nette Sippschaft hinein heiraten müsse, wippte der erfolggekrönte Wanderlehrer seine breiten, slawisch-eckigen Schultern und sagte fast verächtlich: »Ja, ja, – der Herrgott hat sonderbare Kostgänger.« –
Das Sonderbarste an Vinzenz Viktor Karsky aber war, daß es Etwas in seinem Leben gab, wovon keiner seiner nächsten Freunde wußte. Er verschwieg es gleichsam vor sich selbst; denn er hatte keinen Namen dafür; und doch dachte er daran, sommers, wenn er einsam auf weißem Weg in einen Sonnenuntergang ging, oder wenn der Winterwind sich in den Kamin seiner stillen Stube bohrte und die Kerntruppen der Schneeflocken gegen das verklebte Fenster Sturm liefen, oder im dämmerigen Kneipstübchen sogar mitten im Freundeskreis. Dann blieb das Glas unberührt vor ihm stehen; er schaute wie geblendet vor sich hin, als blicke er in ein fernes Feuer, und seine weißen Hände falteten sich unwillkürlich, als wäre ihm ein Beten gekommen – ganz von ungefähr, wie einem das Lachen oder das Gähnen kommt.
*
Wenn der Frühling in eine kleine Stadt einzieht, so gibt das ein Fest. Wie die Knospen aus enger Haft, drängen goldköpfige Kinder aus der winterschwülen Stube und wirbeln ins Land hinaus, als trüge sie der flatternde laue Wind, der ihnen Haare und Röckchen zerrt und ihnen die ersten Kirschenblüten in den Schooß wirft. Und wie sie nach langer Krankheit ein altes, langvermißtes Spielzeug bejubeln würden, erkennen sie selig Alles wieder und begrüßen jeden Baum, jeden Busch und lassen sich vom jauchzenden Bache erzählen, was er all die Zeit getrieben. Und was für eine Wonne ist das, durch das erste grüne Gras laufen, das zage und zart die nackten Füßchen kitzelt, dem ersten Weißling nachhüpfen, der in ratlos großen Bogen über den kargen Holunderbüschen sich verliert ins endlose, blasse Blau hinein. – Überall regt sich Leben. Unterm Dach, auf den rotleuchtenden Telegraphendrähten und sogar hoch auf dem Kirchturm, hart neben der brummigen, alten Glocke, ist Schwalben-Stelldichein. Die Kinder schauen mit großen Augen, wie die Wandervögel die alten lieben Nester finden, und der Vater zieht den Rosenstöcken den Strohmantel und die Mutter den ungeduldigen Kleinen die warmen Flanellhöschen aus.
Auch die Alten kommen mit scheuem Schritt über die Schwelle, reiben sich die faltigen Hände und blinzeln ins flutende Licht hinaus, und nennen sich »Alterchen« und wollens nicht zeigen, daß sie glücklich und gerührt sind. Aber ihre Augen gehen über, und sie danken beide im Herzen: Noch einen Frühling.
*
An solch einem Tag ohne eine Blume in der Hand auszugehen, ist Sünde, dachte der Student Karsky. Und deshalb schwenkte er einen duftenden Zweig in der Rechten, als müßte er dem Frühling Reklame machen. Leichtschrittig und schnell, wie um früher dem dumpfig kühlen Atem der schwarz gähnenden Haustore zu entfliehen, ging er durch die alten, grauen Giebelgassen, winkte dem Wirt der Stammkneipe, der mit feistem Lächeln unter der breiten Einfahrt seines Gasthofs prahlte, und nickte den Kindern zu, die bei dem Schlag der Mittagsglocke aus der engen Schule wirbelten. Erst gings ganz sittsam zwei zu zwei, allein zwanzig Schritte von dem Schultor platzte der Schwarm in unzählige Teilchen auseinander, und der Student mußte an jene Raketen denken, die hoch im Blauen in lauter winzige Leuchtsterne und -kugeln aufgehen. Ein Lächeln auf den Lippen und ein Lied in der Seele, eilte er jenem äußersten Bezirke des Städtchens zu, wo teils behäbige, bäurisch aussehende Gehöfte, teils weiße Villenneubauten, von kleinen Gärtchen umrahmt, gar freundlich dreinschauten. Dort vor einem der letzten Häuser erfreuten ihn die hohen Laubengänge, über deren leichtgeschwungenem Gezweig schon ein grüner Hauch schimmerte, wie ein Ahnen künftiger Pracht. Am Eingang blühten zwei Kirschbäume, und das sah aus, als wäre eine Triumphpforte für den Frühling erbaut und als schrieben die blaßrosa Blüten ein leuchtendes Willkommen darüber.
Plötzlich schrak Karsky zusammen: Mitten in dem Blühen sah er zwei tiefblaue Augen, die mit ruhiger, schlürfender Seligkeit ins Weite träumten. Er gewahrte erst nur die beiden Augen, und ihm war, der Himmel selber schaute ihn durch die Blütenbäume an. – Er kam näher und staunte. Ein blasses, blondes Mädchen kauerte da auf dem mattfarbigen geblumten Lehnstuhl; ihre weißen Hände, die nach etwas Unsichtbarem zu greifen schienen, hoben sich hell und durchscheinend von der dunkelgrünen Decke ab, die Kniee und Füße umschloß. Die Lippen waren zartrot wie kaum erschlossene Blüten, und ein leises Lächeln umsonnte sie. So lächelt ein Kind, das in der Christnacht, das neue Holzpferdchen im Arm, entschlafen ist. So schön und duftig war das bleiche, verklärte Gesicht, daß dem Studenten auf einmal alte Märchen einfielen, an die er lange, lange nicht mehr gedacht hatte. Und er blieb stehen – unwillkürlich, wie er heute bei einer Wegmadonna stehen geblieben wäre, in dem Gefühl jener großen treuinnigen Sonnendankbarkeit, das die bisweilen überkommt, die das Beten verlernt haben. – Da begegnete sein Blick dem des Mädchens. Sie schauten sich in die Augen mit seligem Verständnis. Und halb unbewußt schleuderte der Student den jungen Blütenzweig über den Zaun, daß er mit sachtem Taumeln in den Schooß des blassen Kindes niederschwebte. Die weißen, schmalen Hände griffen mit zärtlicher Hast nach dem duftigen Geschoß, und Karsky genoß den leuchtenden Dank der Märchenaugen mit wonnigem Bangen. Dann schritt er weiter feldein. Erst als er weit im Freien war und der hohe Himmel mit feierlicher Stille über ihm lag, bemerkte er, daß er unablässig sang. Es war ein kleines, altes, seliges Lied.
*
Das hab ich mir auch oft gewünscht, dachte der Student Vinzenz Viktor Karsky, krank gewesen sein einen ganzen Winter lang, und wenn der Frühling kommt, langsam und mählich ins Leben zurückkehren. Vor der Türe sitzen mit staunenden Augen und so recht ausgeruht sein und so kindisch dankbar für Sonne und Dasein. – Und alle sind dann lieb und freundlich, und die Mutter kommt dem Genesenen jeden Augenblick die Stirne küssen, und die Geschwister spielen Ringelreihn und singen bis ins Abendrot. – Und er dachte das, weil ihm immer wieder die blonde kranke Helene einfiel, die da draußen unter dem blütenschweren Kirschbaum saß und seltsame Träume sann. Wie oft sprang er von seinen Arbeiten auf und eilte zu dem blassen, stillen Mädchen. – Zwei Menschen, die das gleiche Glück leben, finden sich schnell. Die Kranke und Viktor berauschten sich beide an der kühlen, duftigen Frühlingsluft, und ihre Seelen klangen denselben Jubel. Er saß neben dem blonden Kinde und erzählte ihm tausend Geschichten mit sanfter, kosender Stimme. Was aus ihm klang, war ihm selbst fremd und neu, und er lauschte mit entzücktem Erstaunen auf seine eigenen Worte, die so rein und voll waren, wie eine Offenbarung. Und es mußte wirklich etwas Großes sein, das er verkündete; denn auch Helenens Mutter, und das war eine Frau mit breiten, weißen Scheiteln, die gar manches gehört haben mochte in Welt und Wandel, lauschte oft wie andächtig, wenn er sprach, und einmal sagte sie mit unmerklichem Lächeln: »Sie müßten eigentlich ein Dichter sein, Herr Karsky.«
*
Die Genossen aber schüttelten nachdenklich die Köpfe. Vinzenz Viktor Karsky kam selten in ihren Abendkreis; kam er einmal, blieb er schweigsam, hörte weder ihre Scherze noch Fragen und lächelte nur so heimlich ins Lampenlicht, als lauschte er auf ein fernes, trautes Singen. Auch über Literatur sprach er nicht mehr, wollte nichts lesen und murrte, wenn man ihn ungestüm aus seinem Sinnen zerrte, ganz unvermittelt: »Bitt euch, der liebe Herrgott hat sonderbare Kostgänger.«
Darüber waren die Studenten aber einig, daß der gute Karsky nunmehr zu den allersonderbarsten gehörte; denn auch von seiner biederen Überlegenheit ließ er nichts mehr merken, und die kleinen Mädchen vermißten seine menschenfreundliche Lehrtätigkeit. Er war Allen ein Rätsel geworden. Traf man ihn mal des Abends in den Gassen, ging er allein, blickte weder rechts noch links und schien bemüht, den seligen, seltsamen Glanz seiner Augen so rasch wie möglich in sein einsames Stübchen zu tragen und dort zu bergen – vor aller Welt.
*
»Was du für einen schönen Namen hast, Helene«, raunte Karsky mit behüteter Stimme, als hätte er dem Mädchen ein Geheimnis anvertraut.
Helene lächelte: »Der Onkel schilt immer und meint, so sollten eigentlich nur Prinzessinnen und Königinnen heißen.«
»Du bist auch eine Königin. Siehst du denn nicht, daß du eine Krone trägst von eitel Gold. Deine Hände sind wie Lilien, und ich glaube, Gott hat sich sogar entschlossen, seinen teuren Himmel zu zerschneiden, um dir Augen zu machen.«
»Du, Schwärmer«, grollte die Kranke mit dankbaren Augen.
»So möcht ich dich malen können!« seufzte der Student auf. Dann schwiegen sie beide. Ihre Hände fanden sich unwillkürlich, und sie hatten die Empfindung, es käme eine Gestalt auf sie zu durch den lauschenden Garten, ein Gott oder eine Fee. Seliges Erwarten füllte ihre Seelen. Ihre dürstenden Blicke trafen sich wie zwei schwärmende Falter – und küßten sich.
Und dann begann Karsky, und seine Stimme war wie fernes Birkenrauschen:
»Das ist alles wie ein Traum. Du hast mich verzaubert. Mit jenem Blütenzweig hab ich mich dir zueigengegeben. Alles ist Anders. So viel Licht ist in mir. Ich weiß gar nicht mehr, was früher war. Ich fühle keinen Schmerz, kein Unbehagen, nicht einmal einen Wunsch in mir. – So hab ich mir immer die Seligkeit gedacht – das jenseits vom Grab …«
»Fürchtest du das Sterben?«
»Das Sterben? Ja. Aber nicht den Tod.«
Helene legte ihm sanft die bleiche Hand auf die Stirne. Er fühlte, sie war sehr kalt: »Komm ins Zimmer«, mahnte er leise.
»Mir ist gar nicht kalt – und der Frühling ist so schön.«
Helene sagte das mit inniger Sehnsucht. Ihr Wort klang nach wie ein Lied.
*
Die Kirschbäume blühten nicht mehr, und Helene saß tiefer im Laubengange, wo der Schatten schwerer und kühler war. Vinzenz Viktor Karsky war Abschied nehmen gekommen. Die Sommerferien brachte er fern an einem See des Salzkammergutes bei seinen alten Eltern zu. Sie sprachen wie immer über das und dies, über Träume und Erinnerungen. Aber der Zukunft gedachte keines. Helenes Gesichtchen war bleicher als sonst, ihre Augen größer und tiefer, und die Hände zuckten leise auf der dunkelgrünen Decke. Und als der Student sich erhob und die beiden Hände behutsam wie etwas Zerbrechliches in die seinen nahm, da sagte Helene leise:
»Küß mich, du!«
Und der junge Mann neigte sich und berührte mit kühlen, gierdelosen Lippen Stirn und Mund der Kranken. Wie einen Segen trank er den heißen Duft dieses keuschen Mundes, und dabei fiel ihm eine Szene aus ferner Kindheit ein: wie Mutter ihn mal emporgehoben hatte zu einem wundertätigen Madonnenbild. Und dann ging er, gestärkt, ohne Schmerz durch den dämmerigen Laubengang. Er wandte sich noch einmal um, winkte dem blassen Kinde zu, das ihm mit müdem Lächeln nachschaute, und warf dann eine junge Rose über den Zaun. Mit seliger Sehnsucht haschte Helene danach. Die rote Blüte aber fiel zu ihren Füßen nieder. Das kranke Mädchen bückte sich mühsam; es nahm die Rose zwischen die gefalteten Hände und küßte sich die Lippen rot an den samtweichen Blättern.
Das hatte Karsky nicht mehr gesehen.
Mit gefalteten Händen ging er durch die Sommerglut.
Als er in sein stilles Stübchen trat, warf er sich in den alten Lehnstuhl und schaute in die Sonne hinaus. Die Fliegen summten hinter den weißen Tüllgardinen, und eine junge Knospe war aufgesprungen auf dem Fensterbrett. Und da kam dem Studenten von ungefähr zu Sinne, daß sie nicht: »auf Wiedersehen« gesagt hatten.
*
Sonngebräunt war Vinzenz Viktor Karsky von den Ferien in die kleine Stadt zurückgekehrt. Mechanisch ging er durch die altgewohnten Giebelgassen und warf keinen Blick auf die Häuserstirnen, die das falbe Herbstlicht fast violett erscheinen ließ. Es war der erste Weg, den er seit seiner Heimkehr machte, und doch schritt er wie einer dahin, der täglich dieselbe Strecke zurücklegt; er trat endlich durch das hohe Gittertor in den stillen Kirchhof und setzte auch dort zwischen den Hügeln und Kapellen zielsicher seinen Weg fort. Vor einem grünen Grab blieb er stehen und las von dem schlichten Kreuze ab: Helene. Er hatte gefühlt, daß er sie hier finden müsse. Ein Lächeln der Wehmut zuckte um seine Mundwinkel.
Auf einmal dachte er: Nein, wie geizig die Mutter doch war! Auf des Mädchens Hügel lag neben verdorrten Blumen ein plumper Blechkranz mit geschmacklosen Blüten. Der Student holte ein paar Rosen, kniete nieder und deckte das kantige, karge Metall ganz mit den frischen Blüten zu, daß auch nicht ein Eckchen mehr zu sehen war. Dann ging er wieder, und sein Herz war klar, wie der rote Frühherbstabend, der so feierlich über den Dächern lag. –
Karsky saß eine Stunde später in der Stammkneipe. Die alten Genossen umdrängten ihn, und auf ihr stürmisches Begehr erzählte er von seiner Sommerreise. Als er von den Alpentouren sprach, gewann er wieder seine alte Überlegenheit. Man trank ihm zu.
»Du,« begann einer der Freunde, »was war denn das damals mit dir, vor den Ferien, du warst ja ganz … na, – vorwärts, heraus mit der Farbe!«
Da sagte Vinzenz Viktor Karsky mit verstohlenem Lächeln: »Na, der liebe Herrgott …«
»… hat sonderbare Kostgänger«, ergänzten die andern im Chor. »Das wissen wir schon.«
Nach einer Weile, als niemand mehr eine Antwort erwartete, fügte er sehr ernst hinzu: »Glaubt mir, es kommt darauf an, daß man einmal im Leben einen heiligen Frühling hat, der einem soviel Licht und Glanz in die Brust senkt, daß es ausreicht, alle ferneren Tage damit zu vergolden …«
Alle lauschten, als erwarteten sie noch etwas. Karsky aber schwieg mit leuchtenden Augen. Keiner hatte ihn verstanden, allein über allen lags wie ein geheimnisvoller Bann, bis der Jüngste seines Glases Rest mit raschem Ruck austrank, auf den Tisch schlug und rief: »Kinder, ich glaub ihr wollt sentimental werden. – Auf! Ich lad euch alle zu mir ein. Da ists gemütlicher, als in der Gaststube, und dann: es kommen auch ein paar Mädel. – Du gehst doch mit?« wandte er sich zu Karsky.
»Freilich«, sagte Vinzenz Viktor Karsky heiter und trank langsam sein Glas leer. –