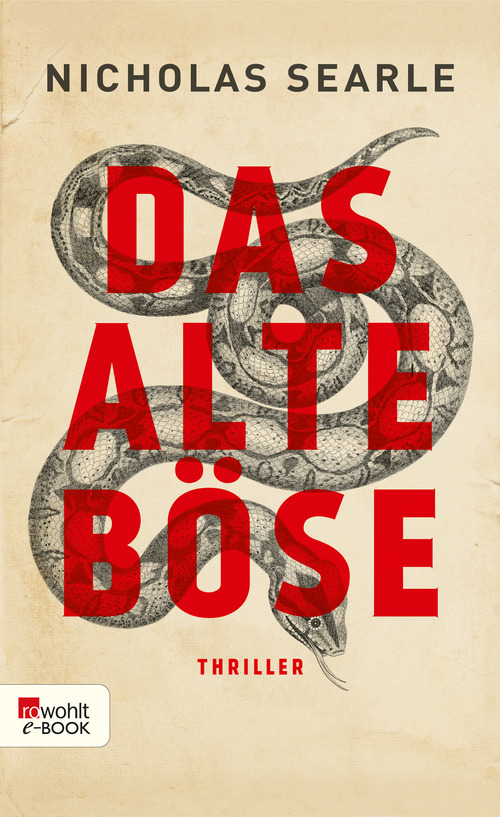
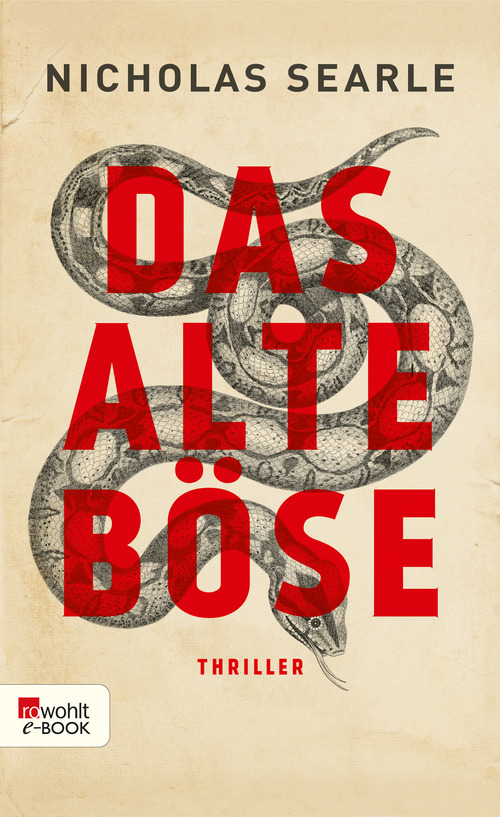
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «The good liar» bei Penguin, Random House
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The good liar» Copyright © 2016 Nicholas Searle
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Redaktion Werner Irro
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
nach dem Originalumschlag von Viking, UK (Gestaltung: Superfantastic, London)
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen
ISBN Printausgabe 978-3-499-27115-1 (1. Auflage 2018)
ISBN E-Book 978-3-644-31521-1
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-644-31521-1
Für C, immer
Es ist, denkt Roy, einfach perfekt. Kismet, Fügung, Vorsehung, Zufall, wie man es auch nennen will. All das in einem. Eigentlich weiß er nicht recht, ob er an Schicksal glaubt oder überhaupt an irgendetwas anderes als die bloße Gegenwart. Allerdings war das Leben im Grunde immer ganz gut zu ihm.
Er steht vom Computer auf und macht seinen üblichen Kontrollgang durch die Wohnung, prüft, ob die Fenster gut verschlossen und alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind. Mit der flachen Hand klopft er die Tasche des Blazers ab, der hinter der Tür hängt: Ja, der Geldbeutel ist drin. Auf dem Tischchen in der Diele liegen die Schlüssel.
Diese Dame jedenfalls, die hat der Himmel geschickt, wenigstens dem Profil auf dem Bildschirm nach zu urteilen. Endlich, nach so langer Zeit. Natürlich wird sie ein paar Kleinigkeiten angepasst, den einen oder anderen unbedeutenden Makel durch geschickte Wortwahl oder eine winzige Flunkerei in eine durch und durch positive Eigenschaft verwandelt haben. Das ist nur menschlich. Außerdem bezweifelt er, dass ihr Name wirklich Estelle ist – er heißt ja auch nicht Brian. Solch belanglose Korrekturen muss man erwarten und akzeptieren. Sie sind das Öl im Getriebe. Werden sie schließlich entlarvt, wird er sich angemessen nachsichtig und amüsiert zeigen. Anders als bei den saftigen Lügen, die einem immer wieder vorgesetzt werden, denkt er, während er den Teebeutel in den Biomüll wirft, Tasse und Untertasse abspült und beides umgedreht aufs Abtropfbrett stellt.
Er holt tief Luft, fährt den Rechner herunter und schiebt den Stuhl ordentlich unter den Schreibtisch. So große Hoffnungen hat er nicht zum ersten Mal, und kurz macht ihn der Gedanke daran sehr müde. Die grauenhaften Rendezvous in gesichtslosen Ketten-Pubs im Speckgürtel von London, mit trutschigen alten Witwen, in denen aus Verbitterung über lange, unerfüllte Ehejahre mit erfolg- und temperamentlosen Männern offenbar das Gefühl erwuchs, nach Lust und Laune schwindeln zu dürfen. Als Erbe sind ihnen weder schöne Erinnerungen noch vergoldete Renten und efeubewachsene Villen in Surrey geblieben. Sie sitzen in winzigen Reihenhäuschen, die zweifellos alle nach Frittiertem riechen, schlagen sich mit Geld vom Staat durch, verfluchen Bert, Alf oder wie auch immer er hieß und sinnieren über das Leben, das man ihnen gestohlen hat. Jetzt wollen sie haben, was immer sie kriegen können, und jedes Mittel ist ihnen recht. Und wer könnte ihnen das schon ernsthaft verübeln?
Schnelle Kontrolle. Blütenweißes Hemd: sitzt. Bügelfalten in der grauen Flanellhose: perfekt. Schuhe: blitzblank poliert. Gestreifte Krawatte: akkurat gebunden. Haar: ordentlich gekämmt. Blauen Blazer vom Bügel nehmen und überziehen. Wie angegossen. Blick in den Spiegel: Er könnte für siebzig durchgehen, sogar für sechzig, wenn nötig. Was sagt die Uhr? Das Taxi müsste gleich da sein. Von Paddington braucht der Zug nur etwa eine halbe Stunde.
Für diese verzweifelten Frauen bedeutet all das einen Ausbruch aus dem Alltag, ein Abenteuer. Für Roy ist dieser Datingquatsch etwas ganz anderes: ein professionelles Unterfangen. Er lässt sich nicht als Zeitvertreib missbrauchen, serviert sie nicht mit Samthandschuhen ab. Mit seinen blauen Augen spießt er sie auf und nimmt sie auseinander wie mit einem Skalpell. Zerlegt sie. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, und das lässt er sie spüren.
«Sagten Sie nicht, Sie seien eins siebzig und schlank?», fragt er vielleicht ungläubig, verkneift sich jedoch taktvoll die Ergänzung: und nicht eine krankhaft übergewichtige Zwergin. «Nicht ganz wie auf dem Foto, was? Wurde wohl schon vor ein paar Jährchen gemacht, oder, meine Liebe?» Er verzichtet auf den Nachsatz: vielleicht sogar von Ihrer hübscheren Schwester? «Bei Tunbridge Wells leben Sie also? Doch wohl eher Dartford, meinen Sie nicht?» Oder: «Dann bedeutet ‹Europa bereisen› also einmal im Jahr all-inclusive in Benidorm mit Ihrer Schwester, ja?»
Wenn er, wie geplant, als Zweiter den Ort des Geschehens erreicht, unternimmt er gewöhnlich erst einen diskreten Erkundungsgang an seinem Date vorbei, um die Lage zu peilen. Bei Anzeichen des üblichen Trauerspiels kann er umgehend verschwinden, ohne sich auch nur vorzustellen. Er sieht es ihnen sofort an, doch er geht trotzdem nie. Er empfindet es als seine Pflicht, diesen Frauen ihre jämmerlichen Illusionen in Scherben zu schlagen. Letztendlich ist das ja auch für sie das Beste. Nach dem üblichen Einstieg mit galantem Gruß und gewinnendem Lächeln geht er zügig zu dem über, was ein fester Bestandteil seines Skripts geworden ist.
«Eine Sache, die mir zutiefst zuwider ist», erklärt er, «ist Unaufrichtigkeit.»
In der Regel lächeln sie dann und nicken kleinlaut.
«Also, mit der Bitte um Entschuldigung und ein paar unerfreulichen Erlebnissen im Hinterkopf …» Noch ein Lächeln, dann honigsüß: «Kommen wir doch zur Sache, ja?»
Meistens nicken sie noch einmal, jetzt ohne zu lächeln, und rutschen etwas auf dem Stuhl herum. Andere bemerken das vermutlich gar nicht, doch ihm entgeht es nicht.
Am Ende teilt er akribisch die Rechnung und lässt keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wie es weitergeht. Aufgesetzte Nettigkeiten spart er sich. «So gar nicht, was ich erwartet habe», stellt er mit müdem Kopfschütteln fest. «Nein, nein. Wirklich schade. Wären Sie doch nur offener gewesen. Hätten Sie sich bloß … sagen wir: treffender beschrieben. Wir hätten beide gar nicht erst unsere Zeit verschwenden müssen. Was wir uns» – an dieser Stelle ein kurzes Funkeln in den Augen und der Anflug eines Lächelns, damit sie sehen, was ihnen entgeht – «in unserem Alter ja kaum noch leisten können. Wenn Sie doch nur …»
Heute wird er zu solchen Maßnahmen hoffentlich nicht greifen müssen. Falls aber doch, wird er seine Pflicht tun. Sich selbst, der bedauernswerten Frau und dem System gegenüber, das kunterbunt die Hoffnungslosen mit den Verblendeten zusammenwürfelt und – davon ist er überzeugt – Gefahr läuft, sich ernsthaft in Misskredit zu bringen. All die vergeudeten Stunden vor Gläsern mit Softdrinks, all die angestrengten, hölzernen Gespräche, gebeugt über fettglänzende Grillteller und massenproduzierte Rinderpasteten, Gemüseaufläufe oder Tikka Masalas aus der Mikrowelle, all die peinlichen Abschiede mit falschen Versprechungen, sich wieder zu melden. Nicht mit ihm. Und erst recht nicht so eine zum Scheitern verdammte Verbindung, wo man noch nach ein paar letzten Tagen an der Sonne sucht.
Doch pessimistisch ist Roy nicht. Kopf hoch, positiv denken! Jedes Mal ein neuer Anfang, voller Hoffnung. Diesmal wird alles anders sein, sagt er sich, als hätte er sich das nicht schon tausendmal eingeredet. Heute hat er jedoch wirklich ein gutes Gefühl.
Das Taxi ist da. Er streckt die Brust raus, lächelt, schließt die Tür und geht mit großen Schritten auf das wartende Auto zu.
Betty trifft letzte Vorbereitungen, bedacht, ihre Aufregung zu zügeln. Stephen wird sie zum Pub fahren und draußen warten, eigentlich kann nichts schiefgehen. Sie wird nicht mit rotem, verschwitztem Gesicht in einem verspäteten Zug sitzen. Keine lästigen Hüftschmerzen bekommen, während sie wenig damenhaft die Hauptstraße entlanghetzt. Keine Gefahr laufen, sich nach dem Treffen unpässlich zu fühlen und nicht nach Hause zu finden. Und sollte sie wider Erwarten das Bedürfnis haben, das Treffen frühzeitig abzubrechen, wird Stephen zur Stelle sein.
In ein paar Minuten müssen sie los, wie Stephen ihr nach kurzer Recherche bei Google und auf seinem Navigations-Dingens mitgeteilt hat. Mit dem Internet kommt sie schon zurecht, aber vieles daran ist doch verwirrend. Was zum Beispiel soll ein Tweet sein? Wie um alles in der Welt konnten wir je ohne all diese Geräte leben? Oder, und das ist doch die eigentliche Frage, warum sind die jungen Leute heutzutage so von ihnen abhängig?
Im Wohnzimmer tapst Stephen herum. Er wirkt noch aufgeregter als sie. Süß ist das. Vor dem Spiegel legt sie Lippenstift auf. Kalte Füße in letzter Minute wird es nicht geben. Das blaue Blumenkleid ist genau richtig, unterstreicht ihr helles Haar, das sie im modischsten Bob trägt, den sie sich in ihrem Alter erlauben kann. Sie wird die zierliche Silberkette und die passende Brosche nicht durch etwas Auffälligeres wie Perlen austauschen. Sie wird nicht mehr zu bequemeren – oder unbequemeren – Schuhen greifen. Sie wird keine letzte Tasse Kaffee mehr benötigen, um sich Mut zu machen.
Betty lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie ist gelassen. Und realistisch, will sie doch meinen. Früher mal mit einigem Recht als schön bezeichnet, trägt sie heute – so hofft sie – die Spuren der Zeit mit Würde. Sie begreift sie lieber als Spuren denn als Schäden. Ein gewisser Liebreiz ist ihr geblieben, doch schön ist sie nicht mehr. Das kann sie niemandem weismachen, allen Bemühungen der Hochglanzmagazine zum Trotz, einen neuen Markt für Frauen «in den besten Jahren» zu kreieren. Vielleicht ist sie etwas ganz anderes, etwas, das keinen Namen und kein Alter hat.
Sie klickt den Deckel auf den Lippenstift, bewegt die Lippen, um ihn gleichmäßig zu verteilen, betastet die Halskette, greift sich vorsichtig ans Haar und sieht ein letztes Mal in den Spiegel. Fertig. Ein Blick auf die Uhr: fünf Minuten zu früh. Stephen nimmt sie im Wohnzimmer mit einer vornehmen Umarmung in Empfang, vorsichtig, als könnte sie zerbrechen.
«Fabelhaft siehst du aus», sagt er, und sie glaubt ihm, dass er es auch so meint.
Bei diesem Regen fährt Stephen gemächlicher als sonst. Noch gemächlicher, genau genommen, denn auch unter Idealbedingungen fühlt er sich am Steuer nicht besonders wohl. Um seiner selbst willen fährt er langsam, seiner eigenen Nerven wegen, nicht etwa ihr zuliebe. Sie hält was aus, ist eindeutig belastbarer als er, trotz ihres Alters. Statt nur die Leben anderer zu studieren, hat sie selbst eines gelebt. Manche würden sie wohl ein dickköpfiges altes Huhn nennen. Stephen nicht. Solche Ausdrücke sind ihm fremd, und treffend wären sie sowieso nicht. Betty ist zierlich, aber kein Vögelchen, hat porzellanene Züge, fein und schlank proportioniert. Ihre Verfassung, die ist stark. Unverwüstlich, so würde er sie bezeichnen.
Um sich nur ja nicht zu verspäten, sind sie extra etwas früher aufgebrochen. Schmerzhaft langsam tastet Stephen sich auf Kreuzungen vor, bleibt gewissenhaft fünfzehn km/h unter der Geschwindigkeitsbegrenzung und befolgt übertrieben unterwürfig die Anweisungen der Verkehrsschilder. Ein wichtiger Tag – für sie und auch für ihn.
«Und du bist gar nicht aufgeregt?», fragt er.
«Ein bisschen», antwortet sie. «Aber eigentlich nicht. Für mich ist es natürlich leichter.»
«Wieso das denn?»
«Weil ich dabei bin. Nicht bloß abwarte, zusehe. Ich werde mittendrin stecken, du sitzt im Auto. Hilflos.»
«Aber du bist dann dadrin. Mit ihm. Wer weiß, wie er wirklich ist? Wie es mit ihm sein wird?»
«Ganz genau. Das macht es ja gerade leichter. Du verstehst das nicht, oder? Na, wie auch. Ich bin zu alt, um mir den Kopf zu zerbrechen. Am allerwenigsten darüber, was ich sage oder tue. Ich kann mich ungestraft nach Herzenslust danebenbenehmen. Ich bin ein Risikofaktor. Mir ist nichts peinlich. Wenn das nichts wird, dann wird es eben nichts. Ich komme drüber weg und schaue nach vorn.»
«Du bist schon was Besonderes», erklärt er. «Tapfer.»
«Eigentlich nicht. Was soll schon passieren? Ich gehe mit einem zweifellos perfekten Gentleman was trinken und einen Happen essen, in einem ländlichen Pub voller Leute. Und draußen sitzt mein Ritter in strahlender Rüstung mit dem Handy in der Hand. Was soll da schon passieren?»
Lächelnd fährt Stephen von der Autobahn ab.
«Estelle», sagt sie, streckt die Hand aus und strahlt ihn mit leuchtenden Augen an.
«Brian», antwortet er. «Sehr erfreut.»
Sie hat ihn gefunden. Mit zehn Minuten vornehmer Verspätung – dank Stephen, der noch ein paar bedächtige Runden durch die Nachbarschaft drehte und das Gebäude in Augenschein nahm. Es war neu gebaut und auf alt gemacht und in diesen düsteren Mittagsstunden im März hell erleuchtet.
Roy erkennt sie sofort. Mittelgroß, zart gebaut, jung geblieben, ein wenig knabenhaft, ein Anflug von Schalk im Gesicht und dazu diese bezaubernden Augen. Wunderschönes Haar. Ein umwerfendes Kleid, das ihre Figur betont. Früher war sie sicher mal ein echter Hingucker. Das Foto auf der Webseite hat nicht gelogen. Sein Unmut darüber, dass sie nicht vor ihm da war, löst sich in Luft auf. Sie gefällt ihm. O ja. Sie gefällt ihm sogar sehr.
«Was darf ich Ihnen zu trinken bestellen?», fragt er.
«Ich hätte gern einen … Wodka Martini», sagt sie.
Warum, das weiß sie nicht; der Einfall kam ihr einfach so. Die nächsten ein, zwei Stunden kann sie sich derlei Impulsivität nicht erlauben. Disziplin und Selbstkontrolle!
«Gerührt oder geschüttelt?», fragt er lächelnd und zieht eine Braue hoch. Mal was anderes als der übliche jämmerliche Sherry, denkt er.
«Ha, ha», macht sie.
Er bestellt ihren Drink, schlägt vor, sich zu setzen, und trägt die Gläser zu Tisch Nummer 16.
«Wie haben Sie mich so schnell erkannt?», fragt er.
«Ich kam rein, sah mich um, und da standen Sie an der Theke. Groß, distinguiert, elegant, ganz wie in der Beschreibung. Ihr Foto wird Ihnen sehr gerecht.»
Das kommt der Wahrheit sogar recht nah, überlegt sie. Genau genommen war er zwischen all den dynamischen und mutmaßlich höchstens sechzehnjährigen Geschäftsleuten nicht schwer auszumachen.
«Wysiwyg», sagt er.
«Wie bitte?»
«What you see is what you get. Bei mir bekommen Sie genau, was auf der Packung steht.»
«Oh», sagt sie. «Wie schade.» Sie lächelt, wie um ihm zu versichern, dass sie nur flirtet.
«Ho, ho, ho!», brummt er nach kurzer Pause und hebt dabei dreimal leicht die Schultern. «Sehr gut. Ich sehe schon, Sie haben’s faustdick hinter den Ohren. Wir werden uns prächtig verstehen.» Er mustert sie unverhohlen. «O ja.»
Sie bestellen ihr Essen: sie vegetarische Pasta, er Steak mit Spiegelei und Pommes Frites. Zwischen ein paar Gabeln gummiartigen, mit künstlichem Babybreigemüse und klebriger Käsesoße beschmierten Conchigliette nimmt sie ihn genauer unter die Lupe. Groß und breitschultrig ist er, hat einen zurückgekämmten weißen Schopf über dem roten Gesicht, auf dem kleine Äderchen eine verästelte Flusslandschaft bilden. Das gelgebändigte Haar klebt ihm sauber hinter den Ohren. Stechende Augen, beunruhigend fast, deren hellblaue Pupillen sich milchig umrahmt von der rötlichen Haut abheben, wachsam, überall zugleich, selbst wenn er sie ansieht. Wäre all das nicht durch sein Alter verwässert und verdünnt, hätte sie womöglich Angst vor ihm. Ein bisschen fürchtet sie sich wirklich.
Er muss einmal eine imposante Erscheinung gewesen sein, groß und gebieterisch. Seine Haltung verrät das noch immer, auch wenn er ein wenig eingesunken ist. Die Schultern sind runder geworden, und in den Augen liegt die Erkenntnis, dass auch er seine Sterblichkeit nicht verleugnen kann. Zu erdrückend sind die Anzeichen, wie schnell die körperlichen und geistigen Kräfte nachlassen. Sie ahnt, wie er sich fühlt, obwohl sie selbst nie imposant war: Temperament mag sie gehabt haben, sicher, aber nicht versetzt mit jener besonderen Männereitelkeit, die vom unausweichlichen Schwinden der Virilität so brutal als nichtig offenbart wird. Irgendwie tut er ihr leid.
Das Gespräch fließt mühelos dahin.
«Schmeckt gut», flunkert sie und blickt von dem Schlamassel auf ihrem Teller hoch.
«O ja», pflichtet er bei. «Hier wird man nie enttäuscht.»
«Wie ist Ihr Steak?»
«Hervorragend. Noch einen Drink?»
«Aber gerne, Brian. Da sage ich nicht nein.»
«Sie müssen nicht mehr fahren?»
«Nein, mein Enkel hat mich gebracht.»
«Ihr Enkel?»
«Ja, Stephen. Er wartet draußen im Auto. In ein Buch vertieft, würde ich wetten.»
«Die Familie steht sich also nahe?»
«Ja», antwortet sie entschieden. «Viele sind wir nicht, aber wir stehen uns sehr nahe.»
«Erzählen Sie mir von ihnen.»
Ein naheliegendes Thema, auf das sie vorbereitet ist. Ihr Sohn Michael ist Pharmamanager und lebt mit seiner Frau Anne bei Manchester. Deren Sohn, Stephen, ist Historiker an der Bristol University. Stephens Schwester Emma studiert in Edinburgh Englisch. Kurz erwähnt sie auch Alasdair, ihren verstorbenen Mann, aber natürlich ist dies kaum der richtige Zeitpunkt für die traurigen Geschichten, die sie beide an diesen Tisch geführt haben.
Dann ist Brian an der Reihe. Sein Sohn designt offenbar Küchen in Sidney, und die beiden stehen in zwar freundschaftlichem, doch nur lockerem Kontakt. Nein, Enkel hat er keine. Über seinen Sohn zu sprechen ist Brian offensichtlich unangenehm. Er selbst war der älteste von drei Brüdern, seine Geschwister sind beide schon verstorben. Und dann war da natürlich noch seine Frau. Die arme, arme Mary. Er lässt den Kopf hängen, und Betty rechnet fast mit einer Träne.
«Wissen Sie», sagt er da und blickt frischen Mutes wieder auf, «eine Sache, die mir zutiefst zuwider ist, ist Unaufrichtigkeit.» Ungerührt erwidert sie seinen Blick. «Man könnte meinen, heute schämen sich die Leute gar nicht mehr für ihre Lügen. Wenn man sie erwischt, ja, dann schon. Aber solange man damit durchkommt, ist Unaufrichtigkeit offenbar völlig in Ordnung. Ich finde das grauenhaft. Verstehen Sie, was ich meine?»
Sie mustert ihn kurz und lächelt. «Ja, ich denke schon.»
«Ich muss Ihnen also eine kleine Täuschung gestehen. Bezüglich unseres Treffens.» Er hält inne und setzt eine feierliche Miene auf. «Mein Name ist in Wahrheit gar nicht Brian. Ich heiße Roy. Roy Courtnay. Brian war nur eine Art Nom de Plume für dieses Treffen. Wenn Sie verstehen. Man fühlt sich sonst ja so auf dem Präsentierteller.»
Wohl eher ein Nom de Guerre, denkt sie leicht gereizt.
«Ach so», erwidert sie und winkt fröhlich ab. «Ich habe so was zwar noch nie gemacht, ging aber mehr oder weniger davon aus, dass das dazugehört. Natürlicher Selbstschutz. Aber dann sollte ich jetzt wohl auch gestehen, dass mein Name nicht Estelle ist. Ich heiße Betty.»
Einen Moment lang sehen die beiden sich ernst in die Augen, dann prusten sie gleichzeitig los.
«Jedenfalls war das meine letzte Lüge, so viel kann ich dir versprechen, Betty. Von jetzt an: nichts als die Wahrheit. Bedingungslose Ehrlichkeit, Betty, das kann ich garantieren. Bedingungslose Ehrlichkeit.» Er strahlt wie ein Honigkuchenpferd.
Immer mit der Ruhe, denkt sie, erwidert sein Lächeln aber ohne Vorbehalt. «Das freut mich zu hören.»
Sie haben eine Schwelle überwunden, denken beide und entspannen sich etwas. Sie kommen ins Plaudern, sprechen über junge Leute. Ein ungefährliches Thema, dessen übliche Plattitüden ihnen Gelegenheit geben, ihre Verwirrung über die heutigen Zeiten zu teilen.
«Die sind ja so mutig», sagt sie. «So vieles, was die heute tun, hätte ich mich nie getraut.»
«Aber so unbeständig», erwidert er. «Alles fliegt ihnen zu. Kein Durchhaltevermögen.»
«Ich weiß. Nichts macht ihnen Kummer. Anders als bei uns früher. Ich bin froh, dass sie so sind.»
Wahrscheinlich gehört das einfach dazu, vermutet Betty, es ist ein Schritt auf dem Weg zu größerer Nähe. Kaum etwas von alldem glaubt sie tatsächlich. Sie sagt einfach, was ihr gerade durch den Kopf geht.
Stephen hat nicht einmal ein Telefon zu Hause, erzählt sie. Sein Smartphone-Dingens ist offenbar alles, was er braucht. Sein ganzes Leben trägt er in der Gesäßtasche herum. Als sie jung waren, da sind sie sich einig, war ein Telefon im Haus das ultimative Statussymbol. Jetzt ist es ein Fauxpas, eins zu besitzen. Bettys Sohn hat drei Autos, obwohl nur zwei Leute im Haushalt leben, jetzt, wo die Kinder fort sind. Genau genommen gehören sie ihm nicht mal, sondern er zahlt jeden Monat eine halsabschneiderische Summe an ein Kreditunternehmen und gibt die Autos nach drei Jahren für neue in Zahlung. Eine abstruse Regelung, die er Betty schon mehrfach geduldig erklärt hat, die sie aber einfach nicht «kapiert», wie er sagt. Niemand dächte heute noch im Traum daran, für irgendwas zu sparen. Ihre Enkelin ist zwanzig Jahre alt und hat schon mehr Länder bereist als Betty in ihrem ganzen Leben. Ihr wird bewusst, dass sie nur noch drauflosplappert, aber das macht nichts. Es ist in Ordnung.
Stephen wird hereinbestellt und für wohlgeraten befunden. «Ein prächtiger junger Mann», urteilt Roy, als ebendieser junge Mann zur Toilette geht. «Macht dir alle Ehre, Betty. Ein prächtiger junger Mann.»
Telefonnummern werden ausgetauscht, zusammen mit aufrichtigen Absichtsbekundungen, sich bald wiederzusehen. Betty und Stephen bieten Roy an, ihn zum Bahnhof mitzunehmen, doch der lehnt ab. «Ganz so klapprig bin ich noch nicht», meint er. «Sind ja nur ein paar Schritte.» Zum Abschied küsst er Betty auf die Wange. Sie erwidert den Kuss, drückt Roy den Arm und zieht ihn ein wenig an sich, wenn auch noch nicht in die Intimität einer Umarmung. Dann streckt sie die Arme wieder aus, hält ihn fest und blickt ihm in die Augen.
«Dann bis zum nächsten Mal», sagt sie.
«Au revoir, Betty», erwidert er.
Da kommen sie. Sie schlendern die Straßen hinab, die Arglosen auf Achse. Die Sonne hat ’nen Hut auf, und die Welt ist in bester Ordnung.
Krakeelend stolpern und rasen die Jungs über das Kopfsteinpflaster, schiefe Krawatten, fliegende Ranzen, die Hemden aus den Hosen, struwweliges Haar. Schulschuhe klackern auf uraltem Stein, als sie sich wie Wasser durch die Gässchen einen Weg zur Fußgängerzone bahnen, und junge Stimmen johlen aufgeregt um die Wette.
Die Mädchen gehen langsamer, wirken aufgeräumter. Mädchen sind eben immer wohlerzogener und besonnener. Außer den unartigen. Und sie können ganz schön unartig sein, o ja.
Der Park ist in sanftes Sonnenlicht getaucht und bietet schattige Zuflucht unter ehrwürdigen Bäumen. So geht es seit Jahrhunderten: Junge Leute strömen sorglos aus der Domschule, vor Leben sprudelnd, begierig, sich wieder irgendwelchem Unfug hinzugeben, während alte Männer ihnen aus den Fenstern ihrer Häuschen neidisch zusehen und leicht bitter an ihre eigene Jugend denken.
Neugierig, wenn auch teilnahmslos beobachtet Roy sie aus seinem Sessel in der Ecke des Wohnzimmers. Besonders die Mädchen faszinieren ihn. Jungs im mittleren Schulalter sind doch nichts als tobende Rhinozerosse, hilflos mitgerissen von heftigen Hormonschüben. Ihre Altersgenossinnen hingegen sind sich dessen bewusst. Und dieses Bewusstsein bringt Verunsicherung mit sich, die sich auf verschiedenste Weise ausdrückt. Mausgraue Musterschülerinnen klammern sich an dem Glauben fest, Fleiß und Klugheit würden ihnen schon helfen, die Klippen von Versagertum und Einsamkeit zu umschiffen. Ihre kessen, hübschen – und größtenteils recht stumpfsinnigen – Klassenkameradinnen ahnen diffus, dass ihre Attraktivität vergänglich sein und gänzlich von den Unwägbarkeiten kommender körperlicher Veränderungen abhängen könnte. Und die kleinen Flittchen, die weder besonders klug sind noch besonders hübsch, sind immerhin schlau genug, das zu wissen, und bedienen sich raffinierter Tricks. Sie ziehen die Röcke hoch, sobald sie aus dem Haus sind, um die Jungs scharfzumachen. Sie wissen von dieser Sache namens Sex, die irgendwo ganz nahe lauert, und lernen ihre Macht schnell kennen. O ja.
Jetzt kommen die Älteren. Picklige Jugendliche mit langem, strähnigem Haar tanzen trübselig um unerreichbare Mädchen herum. Die Geringschätzung der Mädchen gefällt Roy, obgleich seine Verachtung dieser hoffnungslosen Männchen die ihre sogar noch übersteigt. Mit vorgeblich schüchternem Lächeln, das Roy jedoch als Schmunzeln erkennt, werfen sie – in der Regel sieht man sie zu zweit – sich hastige Mascara-Blicke zu. Ihre wahren Gefühle verbergen sie.
In den Jungs erkennt er sich nicht wieder. Idioten, denkt er. Ich war nie einer von euch. Ich war dreist und sah gut aus. Gestrauchelt und gestolpert bin ich nie.
Er ist keine fünfzehn mehr. Nicht einmal fünfzig oder achtzig. Aber Instinkt bleibt Instinkt. Einmal Charmeur, immer Charmeur, unbeschreiblich anziehend für das andere Geschlecht. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht anders.
Da kommt sie. Sie hat er zum besonderen Objekt seiner Aufmerksamkeit auserkoren. Ein vorschriftsmäßig kurzer schwarzer Rock und eine schwarze Strumpfhose verhüllen schlanke, weibliche Beine. Die Strumpfhose gehört nicht zur Schuluniform, passt aber perfekt zum Rest. Fünfzehn vielleicht oder gar frühreife dreizehn – die werden ja so schnell groß, heutzutage. Zierlich, jedenfalls, mit dieser wilden, blond gesträhnten Medusenfrisur, die offenbar nie aus der Mode kommt. Mit Lidschatten besudelt, schludrig, doch wirkungsvoll, zumindest von seinem Sessel aus gesehen. Hält sich für rebellisch, individuell, dabei trottet sie bloß den guten alten Pfad in Richtung Anpassung entlang. Wäre er noch jünger, könnte er ihr schon ein, zwei Dinge beibringen. Vielleicht würde sie die Stolze spielen, die Gleichmütige, und gelangweilt Lebenserfahrung heucheln. Vielleicht würde sie sich auch begeistert auf Entdeckungsreise wagen. Doch früher oder später würde sie Angst bekommen. Und mit Angst kennt Roy sich aus. O ja.
Stephen ist spät dran. Wie immer. Er hat versprochen, Betty ein paar Bücher zu bringen, und bis sechs muss er zu einem garantiert aufreibenden Treffen mit Gerald zurück sein. Stephen weiß schon, was er fragen wird: Alles auf Kurs? Alle Fallstricke im Blick? Alles Nötige berücksichtigt? Schauen wir doch vorsichtshalber noch mal nach, ja? Schließlich ist das Projekt verdammt wichtig.
Um ehrlich zu sein, sind die Fragen berechtigt, und Stephen braucht tatsächlich Betreuung. Das setzt ihm zu, nicht Gerald. Der ist schon in Ordnung, auch wenn er sich in seiner Rolle sichtlich wohl fühlt. Das wesentliche Problem ist aber, dass Stephen nicht weiß, ob alles auf Kurs ist. Er kann den Kurs nicht mal erkennen, ganz zu schweigen von den Fallstricken. Und was das Nötige ist, das er berücksichtigen sollte, weiß er auch noch nicht. Es ist, als entwickelte sich die ganze Sache einfach aufs Geratewohl.
Projektmanagement ist nicht Stephens Sache. Management ist nicht seine Sache. Ein echtes Ziel, geistige Anstrengung, sorgfältige Recherche, die Freude daran, neue Fakten auszugraben, die das Forschungsfeld verändern, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu schaffen, darauf kommt es an, nicht auf nüchterne Abläufe. Also ist Gerald wohl ein notwendiges Übel. Was täte er nur ohne ihn?
Er erreicht die Gasse zwischen der Drogerie und dem Maklerbüro, die den neuen mit dem alten Teil der Stadt verbindet, und eilt von der austauschbaren Einkaufsmeile hinauf in Richtung Park und jahrhundertealtes Kopfsteinpflaster. Irgendwo hinter den Eichen, deren leise raschelnde Blätter die Sonne filtern, sodass sich sanft wogende Fleckchen aus Licht und Schatten auf den weichen grünen Teppich darunter legen, schlägt die Uhr zur halben Stunde.
Ein prächtiger Tag in England, einer der wenigen in diesem Sommer. Die Sonne steht hoch am blauen Himmel, und blütenweiße Schäfchenwolken treiben in der Brise. Scharen lebhafter Kinder lassen wuselnd ihr Tagwerk hinter sich, ihr Überschwang befeuert vom Adrenalinschub durch die Schulglocke. Aus der Ferne wirken ihre Uniformen ordentlich und sauber, doch aus der Nähe zeigen sich Spuren des täglichen Gebrauchs und allerlei Versuche, Individualität zu behaupten. Über die Schulter geworfene Sakkos, schmuddelige, verknitterte Hemden, abgewetzte Schuhe. Und es riecht nach Schulkindern: Schweiß, Urin und Schmutz, vermischt mit schwerer Kunstfaser und dem merkwürdigen Mief, von dem die Schule selbst trieft, jener Mixtur des beinahe metallischen Geruchs von Putzmittel und Politur und des Aromas von altem, angestaubtem Holz, das die Parkettböden und erhabenen Paneele der Aula verströmen.
Die Fröhlichkeit der Kinder beschwingt auch ihn. Er durchquert erst das Gewühl der Jungs und dann die Reihen der Mädchen, die cliquenhafter wirken, ruhiger, reservierter. Älter, genau genommen, und ihrer selbst stärker bewusst.
Stephen gibt acht, die Mädchen nicht zu direkt anzustarren, denn er kennt das Misstrauen gegenüber Männern, das heutzutage wohl in jedem weiblichen Herzen wohnt. War das schon immer so? Er weiß es nicht, will jedoch nicht riskieren, dass man seinen Blick für lüstern hält.
Das Phänomen Jugend fasziniert ihn, auch wenn er nicht recht weiß, weshalb. Vielleicht nur aus simpler Neugier gegenüber allem Menschlichen, angestachelt von diesen jungen Menschen in jener Entwicklungsphase, in der sie beobachten, nachahmen, ausprobieren, revidieren, sich anpassen und schließlich zu einer Identität gelangen. Vielleicht auch weil er diesen letzten Schritt selbst noch nicht vollendet hat, obwohl er auf die dreißig zugeht.
Sein Blick fällt auf ein junges Mädchen auf der anderen Seite des Parks, vierzehn vielleicht, allein, linkisch, unsicher, irgendwie trotzig. Ihr Rock ist kurz, die Augen sind geschwärzt, das Kinn herausfordernd nach vorn gereckt, und doch ist sie nur ein Kind, mit Angst in den Augen. Ihr Getue löst allerlei Gefühle in ihm aus: eine Flut von etwas, das er nur als Liebe begreifen kann, die Anerkennung ihrer Verletzlichkeit und der tiefe Wunsch – egal, wie machtlos er und wie absurd die Vorstellung ist –, sie zu beschützen. Er geht in sich, prüft, ob doch irgendwo Wollust ihre Schatten wirft, die er bloß zu verträglicheren Formen verklärt. Nein, tut sie nicht, das kann er aufrichtig behaupten. Aber interessant, dass er sich vergewissern muss.
Und dann sieht er ihn, in Bettys Sessel am Fenster: Roy, der nun bereits zwei Monate bei Betty wohnt. Fest hat er seine Echsenaugen auf das Mädchen geheftet, gierig, hungrig. Ins Schreiben einer Textnachricht vertieft, geht sie ahnungslos ihres Wegs. Als sie an Stephen vorbeikommt, sieht Roy auch ihn, und ihre Blicke treffen sich. Innerhalb einer Sekunde geht Roys Gesichtsausdruck von Überraschung zu Feindseligkeit über und schließlich zu dem eines traurigen alten Mannes, der seinen Tag damit verbringt, harmlos den Lauf der Welt zu beobachten. Roy versucht sich an einem Lächeln, und Stephen erwidert es mit zaghaftem Winken. Ich kenne dich, denkt er. Wie wenig ich dich auch leiden mag.
«An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig», sagt Roy, als Stephen das Zimmer betritt.
«Wie bitte?», fragt Stephen.
«Ich sagte, du solltest vorsichtig sein», wiederholt Roy und nickt theatralisch zum Fenster.
Stephen runzelt verwirrt die Stirn, öffnet den Mund, um etwas zu sagen, besinnt sich aber eines Besseren. Roy blickt ihn eindringlich an.
«Wie wär’s mit einer Tasse Tee?», fragt Stephen.
«Da sage ich nicht nein», antwortet Roy und lehnt sich im Sessel zurück.
Stephen bringt zwei Tassen Tee, dunkelbraun und stark mit drei Stück Zucker für Roy, milchig weiß und ohne Zucker für sich selbst, und Roy fährt fort.
«Man kann nicht vorsichtig genug sein.»
Einen Augenblick hängen die Worte in der Luft.
«Ähm, ja», sagt Stephen schließlich. «Bitte?»
Kopf in den Wolken, denkt Roy. Mit den Gedanken woanders. Hoffnungsloser Fall. Völlig durcheinander. Typisch Akademiker.
«Missverständnisse», sagt er.
«Ah, ja», erwidert Stephen, abwesend und müde lächelnd. «Klar.»
«Jetzt werde mal nicht herablassend, Junge.»
Stephen sieht ihn ausdruckslos an und schweigt.
«Betty ist nicht da?», bringt er schließlich hervor.
Roy gibt nach. Als würde man einen Welpen quälen, denkt er. Nicht, dass ihn das aufhalten würde. Doch Stephen langweilt ihn. Keine echte Herausforderung. «Nein», sagt er. «Ist mit einer Freundin zum Tee.»
«Verstehe. Und weißt du, wann sie wiederkommt?»
«Kann ich nicht sagen. Macht, was sie will, die Gute.» Roy kichert. «Bin ja nicht ihr Aufpasser.»
«Nein, natürlich nicht.»
«Hast du’s eilig? Du wirkst so abwesend.»
«Viel los grade. Wollte nur diese Bücher vorbeibringen, die ich Betty versprochen habe.» Zum Beweis hält er die orangefarbene Tragetasche hoch. «Sie wollte sie ausleihen.»
«O ja», sagt Roy und blickt ihn ungerührt an.
Stephen setzt sich auf die Sofakante, die Ellbogen auf die Schenkel gestützt, trotz Hitze noch in der Jacke, bereit, wieder zu gehen.
«Und die Arbeit geht voran?», fragt Roy nach kurzer Pause.
«Ganz gut», antwortet Stephen. «Es läuft. Ich bin auf dem Weg zu einer Besprechung mit meinem Betreuer.»
«Strenger Zuchtmeister, was?»
«Gerald ist schon in Ordnung. Hält mich auf Kurs. Das brauche ich.»
«Kann ich mir denken», sagt Roy, und sie schweigen.
«Was genau untersuchst du eigentlich?»
«Den Jakobitenaufstand», gibt Stephen freudig Auskunft. «Besonders John Graham, seine Rolle zu Beginn der Bewegung und seinen Einfluss auf die Aufstände von fünfzehn und fünfundvierzig.»
«Aha?»
«Das ist eine Schlüsselperiode unserer Geschichte: die Erbfolge des Hauses Hannover und der Konflikt zwischen schottischem Katholizismus und Presbyterianismus.»
«Bestimmt hochinteressant. Ich habe mir aus Geschichte nie was gemacht. Bin eben kein Akademiker. Wieso immer zurückblicken, finde ich. Vorbei ist vorbei, wenn du mich fragst. Kann man sowieso nicht ändern.»
«Aber man kann es vielleicht verstehen.»
«O ja. Kann man wohl. Ich sage ja gar nichts dagegen», erwidert Roy. «Ich verneige mich vor deinem überlegenen Wissen. Ist nur nichts für mich, das ist alles. Dauernd in der Vergangenheit zu leben.»
Das Ticken der Uhr macht die Distanz zwischen ihnen spürbar.
«Na ja», sagt Roy. «Jeder, wie er mag.»
«Ich muss dann mal wieder», sagt Stephen. «Ich habe Gerald gesagt, ich bin um sechs bei ihm.»
«Gut, gut», antwortet Roy und dreht sich wieder zum Fenster. Was ihn betrifft, ist Stephen bereits fort.
Wie es sich nach einem Sommer gehört, dessen gelegentliche Verheißungen nie Wirklichkeit wurden, ist der Herbstanfang widernatürlich warm und schön.
Roy bricht zu einem Spaziergang auf, nur um aus dem Haus zu kommen. Betty hat sich an ihr pingeliges Putzprogramm gemacht. Den Staubsaugerlärm ertragen und ständig die Füße heben zu müssen, während er in Ruhe seine Zeitung lesen will, genügt gewöhnlich, um ihn in Gang zu bringen. Sie hebt Sachen auf, sprüht, wischt Staub und räumt die Spuren seiner Anwesenheit weg, schüttet Wasser in die hintersten Ecken und spült die Toilette, wobei sie pausenlos ebenso fröhlich wie schief vor sich hin summt. Noch so einen entsetzlichen Minivortrag über die Klogewohnheiten «kleiner Buben», wie er ihn sich einmal anhören musste, erträgt er nicht. Fast hätte er Mitleid mit ihr gehabt, so peinlich war ihr das, dem armen Ding.
Also brummelte er etwas in der Art, sie in Ruhe machen lassen zu wollen, und schlurft nun mühsam das Kopfsteinpflaster entlang. Erst wenn er außer Sicht ist, kann er die Füße heben und etwas schneller gehen.
Sich so gebrechlich zu stellen kostet ihn einige Mühe, aber es muss sein. Überlegung, Vorbereitung und hin und wieder auch Entsagung waren nötig, um seinen natürlichen Elan im Zaum zu halten. Doch so ist es besser – für ihn und auch für Betty. Sie wissen, wo sie hingehören. Betty ist viel besser dran, wenn sie sich stillvergnügt um den Haushalt mit all seinen Eigenheiten kümmern, ihm das Essen machen und alles reinlich halten kann. Und darauf hat er es abgesehen.
Fürs Erste zumindest. Er ist auf Aufregenderes aus als den Komfort, umsorgt zu werden. Kein leichtes Unterfangen, sicher, aber er will noch einmal alles wagen. Eine letzte nervenaufreibende Runde am Roulettetisch. Mit Betty sollte das möglich sein. Die Untätigkeit hat ihn gewurmt, und Betty kann – ohne ihr Wissen freilich – endlich Abhilfe schaffen. Eine Menge Dinge sind dafür sorgsam im Gleichgewicht zu halten. Doch das ist ja gerade seine Stärke.
Inzwischen ist er ein gutes Stück vom Haus entfernt und nähert sich dem Durchgang zur Fußgängerzone. Jetzt kann er seinen Schritt wohl beschleunigen. Doch kaum dass er das tut, muss er sich auch schon wieder bremsen. Sein Herz klopft, er ist außer Atem, fühlt sich schwächlich und flau. Vielleicht ist er doch nicht so tipptopp in Form, wie er es gern wäre. Zum Draufgänger ist er wohl doch zu alt. Ein wenig neben der Spur, taumelt er weiter.
Im Little Venice Coffee Shop bestellt er eine Kanne Kaffee und ein Stück Schokoladenkuchen mit Sahne obendrauf. Hier ist seine Oase. Er hat nicht viele Schwächen, aber anständiger Kaffee ist eine. Nicht viele Cafés in England – von dieser kleinen, hübsch aus den Augen und aus dem Sinn in der Wildnis von Wiltshire gelegenen Kathedralstadt ganz zu schweigen – sind in der Lage, gute Arabica-Bohnen zu beschaffen und etwas Genießbares daraus zu brühen. Dieses hier schon, und obendrein kann es sich mit gutem Service brüsten: beflissen und dazu effizient. Als der Kaffee kommt, schließt er seufzend die Augen und lässt sich das Aroma in die Nase steigen. Mit etwas Phantasie fühlt er sich fast wie in einem Wiener Kaffeehaus oder auf dem Polstersessel einer Konditorei in irgendeinem spießigen, selbstzufriedenen Städtchen in Deutschland. Im Grunde sind natürlich alle deutschen Städte spießig und selbstzufrieden. Ein wenig träumt er vor sich hin, findet sich jedoch schnell im hundserbärmlichen England von heute wieder. Vor sechzig Jahren vielleicht, denkt er, oder eher siebzig und noch mehr. Er breitet seine Zeitung aus und ist zufrieden.
Endlich ist er weg. Offenbar bekommt man ihn nachmittags wirklich nur aus diesem Sessel, indem man zu putzen anfängt. Manchmal muss sie auch selbst das Haus verlassen und ausgedachten Tee mit ausgedachten Freundinnen trinken oder so tun, als habe sie etwas zu besorgen, damit sie sich sammeln, den Puls beruhigen und wieder gute Miene zum bösen Spiel machen kann.
Er hat seine Gewohnheiten. Er steht vor ihr auf. Ab und an wird sie bereits um sechs geweckt, weil er in der Küche zugange ist und klappernd seinen Tee kocht. Dann, etwa eine Stunde später, hört sie ihn über den Boden schlurfen und langsam die Treppe hinaufstapfen. Er legt sich noch mal zwei, drei Stunden hin, bevor er wieder auftaucht.
Ihr kommt das entgegen. Es erlaubt ihr, den Tag nach Lust und Laune zu beginnen. Sie kann in das kleine Badezimmer gehen und, während sie ihr Bad einlässt, die Toilette und das Laminat daneben putzen. Am Anfang kam es ihr davon fast hoch. Wie kann ein einziger alter Mann bloß so querbeet seinen Urin verspritzen und das offenbar nicht mal bemerken? Mittlerweile ist sie abgehärtet. Roy hat sich als gänzlich unempfänglich für ihre Bitten erwiesen, sich entweder hinterher um das Problem zu kümmern oder es von vornherein zu vermeiden. Er sieht sie nur verständnislos an und schweigt.
Dennoch, im Großen und Ganzen ist das ein kleiner Preis, genau wie die übrige Bandbreite seiner Eigenheiten. Und wenngleich sich diese Eigenheiten – ein doch recht schmeichelhafter Begriff, denkt sie – zu einem hübschen Haufen angesammelt haben, nimmt Betty sie weiterhin in Kauf und denkt langfristig.
Sie selbst badet und frühstückt ausgiebig, bevor Roy sich frisch rasiert wieder zeigt. Manchmal hat er das Badezimmer dann beim Waschen neuerlich verwüstet. Sie weiß dafür zu sorgen, dass auf dem Küchentisch die Zeitung bereitliegt, die er mit skeptischem Blick überfliegt, während sie sich um sein Frühstück kümmert. Ein paar Vormittage, an denen er ratlos Schranktüren öffnete und zuschlug, waren nötig, bis sie akzeptierte, dass es so leichter ist. Er isst den Toast und konzentriert sich auf die Zeitung, die er mit der leicht zitternden Linken auf Leseabstand hält. Von Zeit zu Zeit entfährt ihm ein galliger Kommentar zur Lage der Nation, doch für gewöhnlich kann sie in aller Ruhe ihren Beschäftigungen nachgehen.
Jetzt summt sie Motive aus Beethoven-Symphonien, Melodien aus Ella Fitzgeralds Cole Porter Songbook sowie Refrains von Beatles-Hits und staubt die Bücherregale ab.
Ist das genug? Eine Wolke zieht am Fenster vorbei. Vielleicht zog sie ihr auch übers Herz. Wird das reichen? Erträgt sie das, und falls ja, wie lang? Wie lange wird es dauern, bis sie wieder alleine lebt? Es muss klappen, beschließt sie, unbedingt. Sie muss alles geben, um Roys unangenehme Gewohnheiten und seinen Müßiggang zu akzeptieren, damit sie die Befriedigung und Sicherheit bekommt, nach der es sie so dürstet.
Stephen, stellt sie fest, legt langsam eine Art störrischen Widerwillen an den Tag, Roys Verhalten zu tolerieren und seine Abneigung gegen ihn zu verbergen. Ungewöhnlich für einen derart höflichen jungen Mann und bislang nur durch leiseste Kopfbewegungen ausgedrückt, durch subtiles Mienenspiel und hier und da ein ungeschicktes Wort, was, so scheint es, außer ihr niemand bemerkt.
Vielleicht kann er nicht anders. Er betet sie an, das weiß sie. Sie muss mit ihm sprechen. Er muss das verstehen. Es aushalten. Sich verstellen. Sie weiß, dass sie ihm wichtig ist und er Roy nicht leiden kann, aber er muss einfach.
«Und gefällt es Ihnen hier?», fragt Anne, als sie etwa fünf Wochen später an ihren Sherrys nippen.
«O ja», sagt Roy. «O ja.» Er wirft einen verstohlenen Blick auf seine Uhr und widersteht dem Drang, sie zu schütteln, aus Angst – nein, in der Hoffnung –, sie könnte stehengeblieben sein. Ist sie aber nicht, das weiß er. Gütiger Gott, sind die wirklich erst fünfundzwanzig Minuten da?
So viel Aufwand für diese unscheinbare Bohnenstange und seine abgetakelte Frau. Er schenkt ihnen ein Lächeln, das ebenso gut eine Grimasse sein könnte. Fast den ganzen Samstag war Roy aus dem Haus verbannt, während Betty alles zurechtgemacht und rausgeputzt hat und Stunden mit der Frage zubrachte, ob der opulente Blumenstrauß, den sie besorgt hatte, besser auf dem Kaffeetisch oder der kleinen Anrichte aus Walnussholz stehen sollte. Die bringen doch sowieso Blumen mit, hat er hilflos eingewandt, nichts als Geldverschwendung. Und natürlich hatten sie auch wirklich welche dabei.
Den ganzen Vormittag musste er geriatrische Umtriebigkeit über sich ergehen lassen: Sie kommentierte jeden Handgriff und verwickelte ihn in eine lange Diskussion darüber, was er anziehen sollte. Du liebe Zeit, als wüsste er nicht selbst, was zu tun war. Am Ende blieb ihm nichts übrig, als ein Machtwort zu sprechen.
Und jetzt sitzen sie hier beisammen, die Teilnehmer dieser merkwürdigen Versammlung, und trinken Sherry, alle außer Roy ganz offensichtlich angespannt, trotz ihrer Bemühungen, das Gegenteil vorzuspielen.
Es ist eng in dem kleinen Wohnzimmer. Gut möglich, dass früher oder später jemand irgendwas von Bettys Nippes umstößt. Michael und Anne rutschen verlegen auf der Kante des winzigen Sofas herum. Ihre mäßig ansehnliche Tochter Emma – Brille, strähniges Haar und schlechte Haut – sitzt auf einem Küchenstuhl, Stephen auf der Treppe. Woher haben sie nur diese hässlichen Visagen? Von Betty bestimmt nicht. Ihr Göttergatte muss ein ganz schöner Anblick gewesen sein. Mit den kleinen schwarzen Augen und der schiefen Stirn kommen Michael, Stephen und Emma ihm vor wie eine Wieselfamilie. Von dem schnoddrig-ätzenden Manchester-Akzent ganz zu schweigen.
Betty wuselt pausenlos zwischen ihnen umher, macht großes Bohei um die Häppchen und brabbelt wie ein Wasserfall irgendwelche Nichtigkeiten. Roy lehnt sich im Sessel zurück. Irgendwie ist das auch recht lustig, wie unbehaglich sie sich angesichts dieses ersten Treffens fühlen.
Er unterdrückt ein Gähnen und blickt aus dem Fenster. Immerhin haben sie ein anständiges Auto. Michaels großer, metallic glänzender deutscher Wagen steht am Straßenrand im Regen. Entgegen allem Anschein ist diese Nulpe wohl doch kein völliger Versager.
Irgendwer hat was zu ihm gesagt. Einen Augenblick schließt er die Augen, zügelt seine Langeweile und bemüht sich um Höflichkeit. «Wie bitte?», sagt er schließlich.
«Ich fragte, ob Sie sich schon an das Leben jenseits der Großstadt akklimatisiert haben», wiederholt Michael mit Engelsgeduld, klingt dabei jedoch, als spräche er mit einem Schwachkopf.
Akklimatisiert. Ja, das Wort passt zu dieser Brillenschlange. Er nennt sogar seine Mutter beim Vornamen. Betty dies, Betty das, nicht Mutter oder wenigstens Mum. Kein Respekt. Eine Schande. Zusammenreißen lautet die Devise.
«O ja», antwortet er mit dünnem Lächeln, das er sich nicht einmal selbst abnimmt. «So schwer ist das nicht. Ich lebe gern hier.»
«Und Ihre Wohnung in London haben Sie verkauft?»
Dreist. Schon klar, worauf er hinauswill. Doch Roy antwortet ganz ruhig.
«Nein. Noch nicht. Ich überlege noch, prüfe meine Anlagemöglichkeiten.» Lächelnd blickt er zu Betty.
«Ach, Sie spekulieren?», fragt Michael, hartnäckiger, als Roy ihm zugetraut hätte.
«Nein, nein. Eigentlich nicht. Nein, mein Geld ist sicher. Ich kenne noch wen von früher. Einen Makler, der mich jahrelang betreut hat. Was immer der auftut, soll mir recht sein. Wir kommen schon zurecht, nicht wahr, Liebes?»
«Bitte?», fragt Betty verwirrt, sie ist gerade auf dem Weg zur Küche. «Ach so, ja, sicher doch.»
Alle lächeln sich unaufrichtig an und nippen an ihren Sherrygläsern. Ihr mögt mich nicht, denkt Roy. Abgesehen von Betty natürlich. Ihr könnt mich nicht leiden. Und ich pfeife drauf. Er kichert innerlich. Und fängt sich wieder. Es wird schwerer mit der Zeit, immer schwerer, die nötige Lackschicht aus Höflichkeit und vorgeblich eifrig freundlichem Interesse zu bewahren. Kommt mit dem Alter. Er muss sich nicht nur mehr anstrengen, er muss es besser machen. Allen Beteiligten zuliebe muss er sich verbindlich und erfreut geben, als willkommener Neuzugang im Schoß dieser selbstzufriedenen Sippschaft, nicht als Störenfried.