

Buch
Ramón Espejos Leben verläuft bei Weitem nicht so wie geplant. Nicht nur, dass er auf einem kaum erschlossenen Kolonieplaneten gestrandet ist. Der Mann, den er in einem Streit um eine Frau getötet hat, war ein Diplomat mit mächtigen Freunden. Ramón sieht sich gezwungen, vor der Polizei in die unerforschte Wildnis im Norden des Planeten zu fliehen. Und dabei konnte er noch nicht einmal herausfinden, ob die Frau den ganzen Ärger wert gewesen wäre. Da entdeckt er ein bislang unbekanntes Alienvolk – und wird von ihm gefangen genommen.
Doch Ramón hat Glück im Unglück. Als ein weiterer Gefangener entkommt, wollen die Aliens um jeden Preis verhindern, dass das Wissen um ihre Existenz öffentlich wird. Sie zwingen Ramón, den Flüchtigen zu verfolgen. Dieser wittert die Chance, bei der Jagd über den fremden Planeten selbst zu entkommen …
Autor
George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos Das Lied von Eis und Feuer wurde als die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie Game of Thrones verfilmt. George R. R. Martin wurde u. a. sechsmal der Hugo Award, zweimal der Nebula Award, dreimal der World Fantasy Award (u. a. für sein Lebenswerk und besondere Verdienste um die Fantasy) und dreimal der Locus Poll Award verliehen. 2013 errang er den ersten Platz beim Deutschen Phantastik Preis für den Besten Internationalen Roman. Er lebt heute mit seiner Frau in New Mexico.
GEORGE R.R.
MARTIN
GARDNER DOZOIS
DANIEL ABRAHAM
PLANETEN
JÄGER
Roman
Deutsch von Andreas Helweg
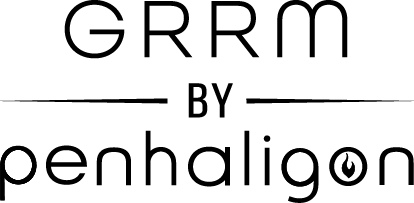
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2008
unter dem Titel »Hunter’s Run« bei Harper Voyager, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2008 by
George R.R. Martin, Gardner Dozois & Daniel Abraham
Published by agreement with the authors and the authors’ agent, The Lotts Agency, Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© 2017 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Redaktion: Catherine Beck
HK · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-19293-8
V001
www.penhaligon.de
Für Connie Willis, die alles, was sie weiß, von Gardner und George gelernt und es sämtlich an Daniel weitergegeben hat
Ouvertüre
Ramón Espejo erwachte und schwebte in einem Meer aus Dunkelheit. Einen Augenblick lang trieb er friedlich dahin, entspannt und unbekümmert, dann kehrte seine Identität behäbig und wie ein unerwünschtes Anhängsel zurück.
Nach dem tiefen, warmen Nichts war es kein Vergnügen, sich zu erinnern, wer er war. Obwohl er nicht richtig wach war, spürte er, wie sein eigenes Gewicht auf sein Herz drückte. Verzweiflung und Wut und die ständig nagenden Sorgen dröhnten in seinem Kopf. Für eine selige Weile war er niemand gewesen, und jetzt war er wieder er selbst. Mit seinem ersten bewussten Gedanken leugnete er die Enttäuschung, die er darüber verspürte zu leben.
Er war Ramón Espejo. Er arbeitete als Prospektor außerhalb von Nuevo Janeiro. Er war … er war … Ramón Espejo.
Da er nun erwartete, dass sich die Einzelheiten seines Lebens wieder einstellten – was er gestern Abend gemacht hatte, was er heute vorhatte, auf wen er wütend war, was ihn kürzlich geärgert hatte –, blieb der nächste Gedanke einfach aus. Er wusste, dass er Ramón Espejo war, aber nicht, wo er war. Oder wie er hierhergekommen war.
Beunruhigt wollte er die Augen öffnen und bemerkte, dass sie längst offen standen. Wo auch immer er sich befand, an diesem Ort gab es überhaupt kein Licht, es war dunkler als die Nacht im Dschungel, dunkler als die tiefen Höhlen in den Sandsteinklippen bei Schwanenhals.
Vielleicht war er auch blind.
Der Gedanke löste einen Anflug von Panik aus. Da gab es diese Geschichten über Männer, die sich mit billigem, synthetischen Moscatel oder Sweet Mary abgefüllt hatten und blind aufgewacht waren. War das passiert? Hatte er die Kontrolle verloren? Ein winziges Rinnsal Angst zog kalt über seinen Rücken. Aber er hatte keine Kopfschmerzen und auch kein Brennen im Bauch. Er schloss die Augen, blinzelte mehrmals kräftig und hoffte gegen alle Vernunft, seine Sehkraft wieder zum Leben zu erwecken. Das hatte lediglich zur Folge, dass helle, pastellfarbene Kügelchen auf seinen Retinae explodierten, dahinhuschende Farben, die irgendwie noch beunruhigender waren als die Dunkelheit.
Die Lethargie fiel von ihm ab, und er wollte schreien. Sein Mund bewegte sich langsam, aber er hörte nichts. War er etwa auch taub? Er versuchte, sich herumzuwälzen und aufzusetzen, konnte es jedoch nicht. Also ließ er sich ins Nichts zurückfallen, schwebte wieder, kämpfte nicht mehr dagegen an. Nur seine Gedanken rasten. Jetzt war er hellwach, doch noch immer erinnerte er sich nicht, wo er war oder wie er hierhergekommen war. Vielleicht war er in Gefahr: Seine Starre war gleichermaßen vielsagend und unheilschwanger. War er in einer Mine verschüttet worden? Hatte ihn ein Bergrutsch erwischt? Er konzentrierte sich auf seinen Körper und richtete seine Sinne auf sein Inneres, um schließlich zu entscheiden, dass er kein Gewicht und keinen Druck spürte, keinerlei Einschränkungen. Du würdest auch nichts spüren, wenn dein Rückenmark durchtrennt wäre, schoss es ihm voll kaltem Schrecken durch den Kopf. Aber nachdem er kurz nachgedacht hatte, war er von seinem Irrtum überzeugt: Er konnte sich ein wenig bewegen, nur wenn er sich aufsetzen wollte, hielt ihn etwas fest und zog ihn an Armen und Schultern nach unten. Es war, als würde er sich in Sirup bewegen, nur arbeitete der Sirup gegen ihn, hielt ihn sanft fest und schob ihn unnachgiebig zurück.
Auf seiner Haut spürte er keine Feuchtigkeit, keine Luft, keinen Hauch, keine Hitze und keine Kälte. Auch schien er nicht auf einer festen Unterlage zu liegen. Offensichtlich hatte ihn sein erster Eindruck nicht getäuscht. Er schwebte, war in der Dunkelheit gefangen, starr an einer Stelle. Er stellte sich vor, er sei ein Insekt, das in Bernstein saß, in einem klebrigen Sirup, der ihn einhüllte, in dem er vollständig untergetaucht war. Aber wie konnte er dabei atmen?
Gar nicht, begriff er. Ich atme nicht.
Panik ließ ihn zerspringen wie Glas. Alle Reste klarer Gedanken lösten sich auf, und er kämpfte wie ein Tier um sein Leben. Er krallte sich in das allgegenwärtige Nichts und versuchte, sich irgendwie durch eingebildete Luft nach oben zu ziehen. Er versuchte auch zu schreien. Zeit hatte keine Bedeutung mehr, der Kampf nahm ihn völlig gefangen, deshalb konnte er nicht sagen, wie lange es dauerte, bis er sich erschöpft zurücksinken ließ. Der Sirup brachte ihn sanft, aber entschieden wieder genau in die Anfangsposition zurück. Eigentlich hätte er schnaufen müssen, eigentlich hätte sein Puls in seinen Ohren dröhnen sollen und sein Herz heftig klopfen – aber nichts. Kein Atem, kein Herzschlag. Keine brennende Lunge, die nach Luft schnappt.
Er war tot.
Er war tot und trieb durch ein riesiges, trockenes Meer, das sich in alle Richtungen bis zur Unendlichkeit ausdehnte. Selbst blind und taub spürte er die Unermesslichkeit dieses unfassbaren mitternächtlichen Ozeans.
Er war tot und im Limbus, dem Limbus, den der Papst in San Esteban beharrlich leugnete, und er wartete in der Finsternis auf das Jüngste Gericht.
Bei dem Gedanken hätte er fast gelacht – das war besser als das, was ihm der katholische Priester in der winzigen Lehmziegelkirche in seinem Dorf in den Bergen Nordmexikos versprochen hatte. Vater Ortega hatte ihm oft versichert, dass er direkt ins Feuer und die Qualen der Hölle gehen würde, wenn er ohne Beichte sterben würde – doch er konnte den Gedanken nicht abschütteln. Er war gestorben, und diese Leere, die unendliche Dunkelheit, unendliche Stille, diese Gefangenschaft allein mit seinem eigenen Verstand, hatte ihn sein Leben lang erwartet, ungeachtet der Segnungen und Salbungen der Kirche, ungeachtet der Sünden und gelegentlich nur halb aufrichtigen Buße. Unzählige Jahre lagen vor ihm, in denen er nichts anderes zu tun hatte, als sich mit seinen Sünden und Verfehlungen zu beschäftigen. Er war gestorben, und die Strafe bestand darin, für immer und ewig dem unversöhnlichen, unsichtbaren Auge Gottes ausgesetzt zu sein.
Aber wie war es passiert? Wie war er gestorben? Seine Erinnerungen wirkten träge wie der Motor eines Traktors an einem kalten Wintermorgen – schwer zu starten und schwer in Gang zu halten, ohne ihn abzuwürgen.
Er fing an, sich vorzustellen, was ihm am stärksten vertraut war. Elenas Zimmer in Vila Diego mit dem kleinen Fenster über dem Bett und den dicken Wänden aus gestampfter Erde. Die Hähne am Becken, die bereits rosteten und uralt aussahen, obwohl die Menschheit erst seit vierzig Jahren auf dem Planeten war. Die winzigen roten Flitzerlinge, die über die Decke huschten und deren mehrfache Beinreihen sich drehten wie Ruder. Die scharfen Gerüche von Eiswurzel und Ganja, vergossenem Tequila und gebratenen Paprika. Das Dröhnen der Transporter, die über ihn hinwegflogen und sich durch die Luft hinauf in den Orbit mühten.
Langsam nahmen die jüngsten Ereignisse seines Lebens wieder Form an, wenn auch verschwommen wie eine schlecht fokussierte Projektion. Er war bei der Segnung der Flotte in Vila Diego gewesen. Es hatte eine Parade gegeben. An einem Stand hatte er gebratenen Fisch und Safranreis gegessen und sich das Feuerwerk angeschaut. Der Rauch hatte ihn an den Geruch des Tagebaus erinnert, und die abgebrannten Feuerwerkskörper zischten wie Schlangen, wenn sie ins Meer fielen. Ein in Flammen gehüllter Riese hatte vor Schmerzen mit den Armen gefuchtelt. War das echt? Der Geruch von Limonen und Zucker. Der alte Manuel Griego hatte über seine Pläne gesprochen, als die Enye-Schiffe schließlich aus dem Sprung zur Planetenkolonie São Paulo auftauchten. Als ihn die Erinnerung an den Duft von Elenas Körper plötzlich überwältigte, errötete er. Aber das war, bevor …
Es hatte einen Kampf gegeben. Er hatte mit Elena gekämpft, ja. Der Klang ihrer Stimme – schrill und vorwurfsvoll und garstig wie ein Pitbull. Er hatte sie geschlagen. Daran erinnerte er sich. Sie hatte geschrien und mit den Krallen nach seinen Augen gehackt und versucht, ihm in die Eier zu treten. Und danach hatten sie sich wie immer versöhnt. Später hatte sie über die Narbe von der Machete auf seinem Arm gestrichen, während er zufrieden einschlief. Oder war das eine andere Nacht gewesen? So viele ihrer Nächte hatten so geendet …
Es hatte einen anderen Kampf gegeben, noch davor, mit jemand anderem … Aber die Gedanken daran scheuten zurück wie ein Maultier vor einer Schlange.
Er war beim ersten Licht gegangen, hatte sich aus ihrem Zimmer geschlichen, in dem der schwere Geruch von Schweiß und Sex gehangen hatte, während sie noch schlief, sodass er nicht mit ihr reden musste und die kühle Morgenbrise auf der Haut spürte. Plattpelzer waren vor ihm davongehuscht, während er die schlammige Straße entlangging. Ihre Alarmschreie klangen wie Oboen in Panik. Mit seinem Transporter war er zur Ausrüsterstation geflogen, denn er würde verschwinden … ehe sie ihn erwischten …
Wieder verweigerte sich sein Verstand. Diesmal war es nicht die abstoßende Vergesslichkeit, die seine Welt verschlungen zu haben schien, sondern etwas anderes. Es gab da etwas in seinem Kopf, an das er sich nicht erinnern wollte. Er biss die Zähne zusammen und zwang sein Gedächtnis, sich seinem Willen zu beugen.
Er hatte den Tag damit verbracht, zwei Auftriebsröhren im Transporter neu auszurichten. Jemand war dabei gewesen. Griego, der hatte über Teile gemeckert. Dann war er ins Ödland geflogen, in die Wildnis, ins Terreno Cimarrón …
Aber sein Transporter war explodiert! Oder? Plötzlich erinnerte er sich an die Explosion, aber er sah sie aus der Ferne. Er war nicht drin gewesen; trotzdem ging mit der Erinnerung Verzweiflung einher. Die Zerstörung des Transporters war ein Teil davon; wovon auch immer. Er versuchte, sich auf diesen Moment zu konzentrieren – auf die Helligkeit der Flammen, den heißen, plötzlichen Windstoß nach der Erschütterung …
Hätte sein Herz geschlagen, wäre es nun vor Schreck stehen geblieben, als die Erinnerung zurückkehrte.
Jetzt wusste er es. Und vielleicht wäre es besser gewesen, gestorben zu sein und in der Hölle zu sitzen.
TEIL 1
1
Ramón Espejo hob das Kinn und forderte seinen Gegner zum Schlag heraus. Die Zuschauermenge füllte die Gasse hinter der heruntergekommenen Bar namens El Rey und bildete einen Kreis. Die Leiber drängten sich angespannt aneinander, näherten sich, um einen guten Blick zu haben, und wichen gleichzeitig in sichere Distanz zurück. Ins laute Stimmengewirr mischten sich Rufe, die die zwei Männer zum Kampf drängten, und schwache, unsichere Ermahnungen, sich zu vertragen. Der große Mann, der ihm gegenüber im Kreis schwankte und wankte, war ein blasser Europäer: rote Wangen vom Schnaps, breite, weiche Hände, zu Fäusten geballt. Er war größer als Ramón, hatte die höhere Reichweite. Ramón sah, wie der Blick des Mannes hin und her huschte, gleichzeitig auf der Hut vor der Menge und vor Ramón.
»Komm schon, pendejo«, sagte Ramón und grinste. Er hatte die Arme weit ausgebreitet, als wollte er den Kämpfer umarmen. »Du wolltest Macht. Komm her und hol sie dir.«
Die LEDs des Barschildes wechselten nacheinander von Nachtblau zu Rot und Bernsteingelb. Weit über allen strahlten die unzähligen Sterne des Nachthimmels zu hell und zu nah, um von den Lichtern Vila Diegos überblendet zu werden.
Das Sternbild des Steinmanns starrte auf sie herab, während sie sich umkreisten, einer der Sterne glühte unheilvoll wie ein rotes Auge, als würde er zuschauen, sie anspornen.
»Das sollte ich echt machen, du hässlicher kleiner Pomadenkopf!«, fauchte der Europäer. »Ich sollte dir mal richtig in den schmächtigen Arsch treten!«
Ramón fletschte nur die Zähne und winkte den Mann zu sich. Der Europäer wollte wieder nur ein Wortgefecht, aber dazu war es zu spät. Die Stimmen der Zuschauer schwollen zum Rauschen eines Wasserfalls an. Der Europäer setzte sich mit der Grazie eines umkippenden Baums in Bewegung; die große linke Faust schob sich langsam durch die Luft wie durch Melasse. Ramón trat in den Schwinger hinein und ließ das Fallmesser aus dem Ärmel in die Hand rutschen. Aus der gleichen Bewegung, mit der er dem größeren Mann die Faust in den Bauch rammte, ließ er das Messer aufschnappen.
Die Überraschung im Gesicht des Europäers wirkte fast komisch. Schnaubend entwich ihm die Luft.
Ramón stach noch zweimal zu, schnell und hart, und drehte die Klinge – nur zur Sicherheit. Er war dem Mann nah genug, damit ihm sein blumiges Eau de Cologne in der Nase kribbelte, nah genug, um seinen Süßholzatem im Gesicht zu spüren. Die Menge verstummte, als der Europäer auf die Knie sackte und sich breitbeinig auf die dreckige Straße setzte. Die großen, weichen Hände öffneten und schlossen sich wahllos und glänzten vom Blut, das bleich wurde, wenn die LEDs rot leuchteten, und schwarz, wenn das Licht ins Blaue wechselte.
Der Mund des Europäers stand offen. Blut sprudelte über seine Zähne. Langsam, sehr langsam, wie in Zeitlupe, kippte er seitlich um. Er zuckte einmal mit den Füßen, seine Hacken trommelten auf den Boden. Und dann lag er still.
Aus der Menge rief jemand erschrocken einen Fluch.
Die schrille Selbstzufriedenheit und das Hochgefühl schwanden. Ramón blickte in die Gesichter der Zuschauer – aufgerissene Augen, Münder, die vor Überraschung ein O bildeten. Der Alkohol im Blut schien sich zu verflüchtigen, Nüchternheit machte sich in seinem Kopf breit. Das Gefühl, verraten worden zu sein, erfasste ihn – diese Leute hatten ihn gedrängt, ihn zum Kampf ermuntert. Und jetzt wandten sie sich ab, weil er gewonnen hatte!
»Was?«, schrie Ramón die anderen Gäste des El Rey an. »Ihr habt gehört, was er gesagt hat! Ihr habt gesehen, was er gemacht hat!«
Aber die Gasse leerte sich. Selbst die Frau, die mit dem Europäer zusammen gewesen war und die ganze Sache angefangen hatte, war verschwunden. Mikel Ibrahim, der Chef des El Rey, wankte auf ihn zu, das bärenartige, große Gesicht verzogen wie ein geduldig leidender Heiliger. Er streckte ihm die Pranke entgegen. Ramón hob wieder das Kinn und richtete sich auf, als wäre Mikels Geste eine Beleidigung. Der Wirt seufzte nur, schüttelte langsam den Kopf und winkte fordernd mit den Fingern. Ramón spitzte die Lippen, wandte sich halb ab und klatschte ihm das Messer, Griff voraus, in die wartende Hand.
»Die Polizei ist unterwegs«, warnte der Chef. »Du solltest nach Hause gehen, Ramón.«
»Du hast gesehen, was passiert ist«, erklärte Ramón.
»Nein, ich war da nicht hier«, erwiderte Mikel. »Und du auch nicht, ja? Geh nach Hause. Und halt die Klappe.«
Ramón spuckte aus und stolzierte in die Nacht davon. Erst als er losging, bemerkte er, wie betrunken er war. Auf dem Platz am Kanal hockte er sich hin, lehnte sich an einen Baum und wartete, bis er sicher war, weitergehen zu können, ohne zu schwanken. Um ihn herum brachte Vila Diego die Wochenlöhne mit Alkohol, Kaafa Kyit und Sex durch. Von den einfachen Zigeunerhausbooten auf dem Kanal dröhnte Musik herüber; ein schnelles, fröhliches Akkordeon mischte sich mit Trompeten und Steel Drums und den Rufen von Tänzern.
Irgendwo in der Dunkelheit schrie traurig eine Zehnflosse, ein »Vogel«, der in Wirklichkeit eine fliegende Eidechse war und auf unheimliche Art so klang wie eine in Elend und Verzweiflung schluchzende Frau. Das brachte die abergläubischen mexikanischen Bauern, die einen großen Prozentteil der Bevölkerung der Kolonie ausmachten, zu der Ansicht, dass La Llorona, die Weinende, mit ihnen von Mexiko die Sterne durchquert hatte und nun auf diesem neuen Planeten durch die Nacht spukte. Dabei weinte sie nicht nur um alle Kinder, die auf der Erde zurückgeblieben und verloren gegangen sind, sondern auch um jene, die in dieser harten neuen Welt sterben mussten.
Natürlich glaubte er solchen Unfug nicht. Aber als der geisterhafte Gesang zu einem herzzerreißenden Crescendo anschwoll, überlief ihn dennoch ein Schauer.
Ramón bereute es, den Europäer erstochen zu haben; hätte es nicht genügt, ihn ein wenig zu verprügeln, ihn zu demütigen und wie ein Weibsstück zu ohrfeigen? Aber wenn Ramón betrunken und wütend war, ging er immer zu weit. Er hätte gar nicht so viel trinken sollen, das wusste er, denn wenn er sich dann in Gesellschaft befand, endete es fast immer so. Er hatte den Abend mit einem unguten Gefühl im Bauch angefangen, das ihn in der Stadt ständig überkam, und als er endlich genug getrunken hatte, damit dieses Gefühl nachließ, hatte wie immer jemand etwas gesagt oder getan, das ihn in Wut versetzte. Nicht jedes Mal endete es mit dem Messer, aber gut ging es fast nie aus. Ramón gefiel das nicht, aber er schämte sich auch nicht dafür. Er war ein Mann – ein unabhängiger Prospektor in einer harten Frontwelt-Kolonie, die noch nicht einmal eine Generation alt war. Gott, er war ein Mann! Er trank viel, er kämpfte hart, und jeder, der damit ein Problem hatte, sollte seine pinche Meinung lieber für sich behalten!
Eine Familie von tapanos – kleine, waschbärenartige Amphibien mit Schuppen wie die Stacheln eines Igels – krabbelte aus dem Wasser und betrachtete Ramón mit dunklen, glänzenden Augen, ehe sie zur Plaza weitergingen, wo sie nach Essensresten und Müll suchen würden. Ramón schaute ihnen nach, wie sie rutschige dunkle Spuren des Kanalwassers hinter sich herzogen, dann seufzte er und wuchtete sich auf die Beine.
Elenas Apartment lag im Labyrinth der Straßen um den Gouverneurspalast. Es befand sich über einem Fleischerladen, und die Luft, die durch das hintere Fenster hereinzog, roch häufig nach altem Blut. Er dachte daran, in seinem Transporter zu schlafen, doch er fühlte sich klebrig und erschöpft. Er wollte duschen und ein Bier trinken und dazu etwas Warmes essen, damit sein Magen aufhörte zu knurren. Langsam stieg er die Treppe hinauf und bemühte sich, leise zu sein, aber in ihren Fenstern brannte noch Licht. Weit im Norden hob am Raumhafen ein Shuttle ab, dessen Positionslichter blau und rot leuchteten, während sich das Schiff auf die Sterne zubewegte. Ramón hoffte, das Klicken und Zischen der Tür würde vom Dröhnen der Triebwerke übertönt. Aber er hatte kein Glück.
»Wo zum Teufel bist du gewesen?«, schrie Elena, als er eintrat. Sie trug ein dünnes Baumwollkleid mit einem Fleck am Ärmel. Das Haar, schwärzer als der Himmel, hatte sie zu einem Knoten gebunden. Vor Wut fletschte sie die Zähne und verzog den Mund fast zu einem Viereck. Ramón schloss die Tür hinter sich und hörte, wie sie die Luft anhielt. Binnen eines Augenblicks war der Zorn verraucht. Er folgte ihrem Blick zu der Stelle, wo das Blut des Europäers sein Hemd und sein Hosenbein durchtränkt hatte, und zuckte mit den Schultern.
»Wir müssen das Zeug verbrennen«, sagte er.
»Alles in Ordnung, mi hijo? Was ist passiert?«
Er hasste es, wenn sie ihn so nannte. Er war niemandes kleiner Junge. Aber es war besser als Streit, also lächelte er und zog an seinem Gürtel.
»Mir geht’s bestens«, antwortete er. »Den anderen cabrón hat es schlimmer erwischt.
»Die Polizei … Wird die Polizei …?«
»Vermutlich nicht«, sagte Ramón, ließ die Hose über die Knie fallen und zog sich das Hemd über den Kopf. »Trotzdem sollten wir das Zeug verbrennen.«
Sie stellte keine weiteren Fragen und brachte die Kleidung zur Verbrennungsanlage, die sich die Wohnungen des Blocks teilten, während Ramón duschte. Die Zeitanzeige im Spiegel verriet ihm, dass es noch drei oder vier Stunden dauern würde, bis es dämmerte. Er stand unter dem warmen Wasser und betrachtete seine Narben – das breite weiße Band auf dem Bauch, wo ihn Martín Casaus mit einem Blechhaken aufgeschlitzt hatte, den unförmigen Klumpen am Ellbogen, wo ein betrunkener Bastard ihm mit einer Machete beinahe den Knochen durchtrennt hatte. Alte Narben. Manche waren älter als andere. Sie störten ihn nicht; eigentlich mochte er sie sogar. Sie ließen ihn stark aussehen.
Als er herauskam, stand Elena am hinteren Fenster und hatte die Arme unter dem Busen verschränkt. Als sie sich zu ihm umdrehte, machte er sich darauf gefasst, dass sie vor Wut wie ein Hochofen brodeln würde. Stattdessen war ihr Mund eine winzige Rosenknospe, und ihre Augen waren groß und rund. Sie sprach wie ein Kind, schlimmer noch: wie eine Frau, die ein Kind sein wollte.
»Ich habe Angst um dich«, sagte sie.
»Brauchst du nicht«, erwiderte er. »Ich bin zäh.«
»Aber du bist nur ein Mann«, sagte sie. »Als Tomás Martinez umgebracht wurde, waren sie zu acht. Die sind auf ihn los, als er aus dem Haus seiner Freundin kam, und …«
»Tomás war eine kleine Hure«, gab Ramón zurück und winkte ab, als wollte er sagen, ein echter Kerl müsse auch mit acht Mann fertigwerden, die eine Rechnung begleichen sollten. Elenas Lippen entspannten sich zu einem Lächeln. Sie ging auf ihn zu und wiegte mit den Hüften, als würde ihre Möse zu ihm wollen und den Rest widerwillig mitziehen. Es hätte auch leicht anders kommen können. Sie hätten sich genauso gut die ganze Nacht anschreien, einander mit Sachen bewerfen und schließlich prügeln können. Doch selbst das hätte vielleicht mit Sex geendet. Allerdings war er ehrlich dankbar, den Teil mit dem Streit zu überspringen, weil er müde genug war, um einfach nur zu vögeln und dann zu schlafen und ansonsten den verschwendeten, leeren Tag zu vergessen, den er gerade hinter sich hatte. Elena zog ihr Kleid hoch, und Ramón schloss ihr vertrautes Fleisch in die Arme. Aus dem Metzgerladen unten stieg der Geruch alten Bluts auf wie ein ekliges Parfüm von Erde und Menschheit, das ihnen durch den leeren Raum gefolgt war.
Danach lag Ramón erschöpft im Bett. Das nächste Shuttle hob ab. Normalerweise war es kaum eins im Monat. Aber bald würden die Enye kommen, früher als erwartet, und die Plattform über Vila Diego musste an die großen Schiffe mit ihrer Alienfracht angepasst werden.
Schon vor Generationen hatte sich die Menschheit über die Gravitation von Erde und Mars und Europa erhoben und war mit Eroberungsträumen in den Weltraum gezogen. Die Menschen wollten ihren Samen im Universum verbreiten wie der Sohn eines Hohen Rats in einem Hafenbordell, aber sie waren enttäuscht worden. Das Universum war bereits besetzt. Andere sternreisende Völker waren schneller gewesen.
Aus den Träumen von Weltreichen wurden Träume von Reichtümern, und auch die verblassten zu beschämtem Staunen. Mehr noch als die großen und rätselhaften Technologien der Silber-Enye und Turu war es die Natur des Weltalls, die sie überwältigte, so wie sie auch alle anderen sternreisenden Völker überwältigte. Die weite Dunkelheit war zu groß. Zu riesig. Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit war so langsam, dass man kaum von Kommunikation sprechen konnte. Regieren war unmöglich. Was es an Gesetzen gab, die über lokale Gültigkeit hinausgingen, war lächerlich. Die Außenposten der Handelsallianz, der beizutreten die Menschen von den Silber-Enye »überzeugt« worden waren (ungefähr so, wie Admiral Perrys Kanonenboote damals Japan »überzeugt« hatten, sich vor vielen Generationen dem Handel zu öffnen), lagen weit verstreut, und manche hatten seit Generationen keinen Kontakt mehr oder waren verloren gegangen. Oder sie standen auf irgendeiner Liste zu bearbeitender Angelegenheiten irgendeines Bürokraten so weit hinten, dass sich vermutlich erst ein Bürokrat einer noch nicht geborenen Generation darum kümmern würde.
Den Weltraum über diese unendliche Nacht hinweg zu beherrschen – oder ihn auch nur dauerhaft zu besiedeln – konnte nur aus dem provinziellen, engen Blickwinkel möglich erscheinen, wenn man die Welt vom Mittelpunkt eines Gravitationsfelds her betrachtete. Sobald man zwischen den Sternen war, wusste man es bald besser.
Kein Volk hatte es geschafft, solch riesige Entfernungen zu überwinden, daher hatte man danach gestrebt, die Zeit zu besiegen. Und genau hier hatte die Menschheit schlussendlich ihre kleine Nische in der überfüllten, chaotischen Dunkelheit des Universums gefunden. Enye und Turu sahen den Schaden, den die Menschheit ihrer Umwelt zufügte, die tief im Menschen verankerte Neigung zu Veränderung und Kontrolle sowie die stark eingeschränkte Fähigkeit, Konsequenzen einzuschätzen. Und sie hatten darin eher einen Vorteil als einen Fehler gesehen. Die riesigen Bürokratien, sowohl der Menschen als auch der Aliens, hatten Verhandlungen aufgenommen, die sich mit der Geschwindigkeit eines Gletschers über Generationen hinzogen. Wo man leere Planeten fand, unfügsam, unbequem und gefährlich, schickte man die Menschen hin. In den sich langsam dahinziehenden Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die es dauerte, um die Wunder und Gefahren der Evolution an solchen Orten zu zähmen, zu brechen oder auszulöschen, hatten die Silber-Enye und Cian und Turu und sonstigen großen Zivilisationen, die zufällig in der Nähe waren, den Transport übernommen wie Schiffe in alten Zeiten, als die Menschheit von kleinen Inseln und unbedeutenden Hügeln der Erde aufgebrochen war.
Die Kolonie São Paulo hatte gerade die zweite Generation erreicht. Es gab noch Frauen, die sich an die erste Landung auf einer unberührten Welt erinnern konnten. Vila Diego, Nuevo Janeiro, San Esteban, Amadora. Kleiner Hund. Fiedlers Sprung. Alle Städte des Südens waren seitdem aufgeblüht wie Schimmel in einer Petrischale. Menschen starben an den schleichenden Giften in der vorgefundenen Nahrung. Menschen hatten die riesigen Katzeneidechsen entdeckt – die bald den Spitznamen chupacabras nach dem blutsaugenden Fabelwesen der guten alten Erde bekommen hatten. Stolz und dämlich hatten sie an der Spitze der Nahrungskette des Planeten gestanden, und für diese Entdeckungen waren Menschen gestorben. Die Silber-Enye mit ihren Austernaugen nicht. Die Insekten-und-Glas-Turu ebenfalls nicht. Die geheimnisvollen Cian mit ihrer Vorliebe für Schwerelosigkeit auch nicht.
Und jetzt kamen die großen Schiffe früher als vorgesehen, und jedes halb lebendige Schiff gefüllt mit – wie angenommen wurde – neuer Ausrüstung und Bewohnern anderer Kolonien, die hofften, auf São Paulo einen Platz für sich zu finden. Und natürlich auch mit der Chance zur Flucht für diejenigen, für die diese Kolonie zu einem Gefängnis geworden war. Mehrfach war Ramón gefragt worden, ob er nicht hinaufgehen wolle in die Dunkelheit, aber die hatten ihn falsch verstanden. Er war im Weltraum gewesen; er war hierher gekommen. Das Einzige, was ihn locken könnte, von hier zu verschwinden, war die Aussicht auf einen Ort, wo weniger Menschen lebten. Und das war unwahrscheinlich. So schlecht er auch nach São Paulo passte, er konnte sich keinen Ort vorstellen, an dem es besser wäre.
Er erinnerte sich nicht, dass er eingeschlafen war, als er am späten Morgen von der Sonne geweckt wurde, die ihm durch Elenas Fenster ins Gesicht schien. Sie summte im Nebenzimmer und ging ihren morgendlichen Geschäften nach. Sei bloß still, du Scheißschlampe, dachte er und zuckte zusammen, weil sein Kater zuschlug. Sie hatte kein Talent zum Singen – jeder Ton kam schrill und schief heraus. Ramón lag reglos da und wollte sich zwingen weiterzuschlafen, um dieser Stadt zu entfliehen, diesem nervigen Gesumme, dieser Frau, diesem Augenblick in der Zeit. Dann wurde das Summen von einem wütenden Zischen übertönt, und einen Moment später wehte der Duft von Knoblauch, Chili-Wurst und bratenden Zwiebeln ins Zimmer. Ramón merkte plötzlich, wie leer sein Magen war. Seufzend drückte er sich auf die Ellbogen hoch, schwang die noch schweren Beine aus dem Bett und bewegte sich wackelig zur Tür.
»Du siehst so scheiße aus«, sagte Elena. »Ich weiß echt nicht, warum ich dich überhaupt reinlasse. Rühr das nicht an! Das ist mein Frühstück. Du kannst dir dein eigenes verdienen!«
Ramón warf die Wurst von einer Hand in die andere, bis sie kalt genug war, um abzubeißen.
»Ich schufte fünfzig Stunden die Woche für den Kredit. Und was machst du?«, herrschte Elena ihn an. »Du lungerst im terreno cimarrón rum und kommst nur in die Stadt, um zu versaufen, was du verdient hast. Du hast nicht mal ein eigenes Bett!«
»Gibt es Kaffee?«, fragte Ramón.
Elena deutete mit dem Kinn auf eine verschrammte Thermoskanne aus Plastik und Chitin auf dem Küchentresen. Ramón spülte eine Blechtasse aus und goss sich Kaffee von gestern ein. »Ich mache schon noch meinen großen Fund«, sagte er. »Uran oder Tantal. Ich verdiene so viel Geld damit, dass ich für den Rest meines Lebens nicht mehr arbeiten muss.«
»Und dann lässt du mich sitzen und holst dir eine junge puta vom Hafen, die dir überallhin nachläuft. Ich kenne die Männer.«
Ramón klaute sich noch eine Wurst von ihrem Teller. Sie schlug ihm so hart auf die Finger, dass es wehtat.
»Heute gibt es eine Parade«, sagte Elena. »Nach der Segnung der Flotte. Der Gouverneur zieht eine große Schau ab, die zu den Enye ausgestrahlt wird. Vielleicht denken die, wir wären alle froh, weil sie früher kommen. Es gibt Rum umsonst und Tanz.«
»Die Enye halten uns für dressierte Hunde«, erwiderte Ramón mit dem Mund voller Wurst.
Die Falten um Elenas Mundwinkel wurden hart, ihre Augen kalt.
»Wird bestimmt lustig«, sagte sie giftig.
Ramón zuckte mit den Schultern. Er schlief in ihrem Bett. Dafür, das wusste er, musste er einen Preis bezahlen.
»Ich zieh mich an«, sagte er und trank den letzten Schluck Kaffee. »Ich habe ein bisschen Geld. Also lade ich dich ein.«
Sie ließen die Segnung der Flotte fallen – Ramón hatte keine Lust, sich das dumme Geleiere der Priester anzuhören, die kellenweise Weihwasser auf die mitgenommenen Fischerboote spritzten –, aber zur anschließenden Parade kamen sie rechtzeitig. Die Hauptstraße, die am Gouverneurspalast vorbeiführte, war breit genug, damit fünf Zugmaschinen nebeneinander fahren konnten, wenn man den Verkehr für die Gegenrichtung sperrte. Große Festwagen zogen langsam vorbei und mussten oft minutenlang halten. Weltliche Objekte – ein »Turu-Raumschiff« mit vielen Lichtern, das von Pferden gezogen wurde, und ein Plastik-chupacabra mit rot glühenden Augen und einem Maul, das auf- und zuging und dabei große Zähne entblößte, die aus alten Rohren gefertigt waren – vermischten sich mit überdimensionalen Darstellungen von Jesus, Bob Marley und der Jungfrau von Despegando Station. Dann kam eine überlebensgroße (erkennbare, aber nicht sehr schmeichelhafte) Karikatur des Gouverneurs, der die riesigen Lippen spitzte, als wollte er den Silber-Enyes die Ärsche küssen, und die ganze Straße lachte. Die erste Welle der Kolonisten, die den Planeten São Paulo genannt hatten, stammte aus Brasilien, und obwohl nur wenige jemals Portugal besucht hatten, wurden sie von den spanisch sprechenden Kolonisten im Allgemeinen als die »Portugiesen« bezeichnet. Die Spanier waren überwiegend Mexikaner und mit der zweiten und dritten Welle angekommen. Die »Portugiesen« dominierten immer noch die höheren Positionen in der hiesigen Regierung und Verwaltung und saßen damit auf den bestbezahlten Stellen. Bei der spanischsprechenden Mehrheit waren sie nicht beliebt, weil sich diese in ihrer neuen Heimat wie Bürger zweiter Klasse fühlten. Daher folgte dem riesigen Wagen mit dem Gouverneur ein Chor aus Spott und Buhrufen.
Nach den großen Festwagen kam die Musik: Steelbands, Streicher, Mariachigruppen, karibische Gruppen, marschierende Einheiten der Zouaves und Gitarristen, die Fado spielten. Stelzenläufer und Akrobaten. Junge Frauen in halb fertigen Karnevalskostümen tanzten vorbei wie Vögel. Da Elena neben ihm stand, hütete sich Ramón, auf die halb entblößten Brüste zu schauen (zumindest hütete er sich davor, sich dabei erwischen zu lassen).
Im Labyrinth der Seitenstraßen herrschte dichtes Gedränge. Es gab Kaffeestände und Rumverkäufer, Bäcker verkauften glasierte Rotmantelpastete und chupacabras. An Essensständen gab es Bratfisch und Tacos, Satay und Jug-jug, dazu Straßenmusikanten, Straßenkünstler, Feuerschlucker und Hütchenspieler – alle versuchten, bei dem improvisierten Fest möglichst viel herauszuschlagen. In der ersten Stunde hatte er noch Spaß daran. Danach machten Ramón der Lärm, das Gedränge und der Geruch der Menschen unruhig. Elena spielte wieder das kleine Mädchen, kreischte vor Freude wie ein Kind, zerrte ihn von einer Attraktion zur nächsten und gab sein Geld für Zuckerstangen und süße Totenköpfe aus. Er konnte sie ein bisschen bremsen, indem er vernünftiges Essen kaufte – eine Wachspapiertüte mit Safranreis, scharfen Peperoni und gebratener Butterflosse, dazu ein großes, schlankes Glas mit aromatisiertem Rum. Dann suchte er einen Hügel im Park neben dem Palast aus, wo sie sich ins Gras setzen und zuschauen konnten, wie sich der riesige Menschenstrom langsam vorbeiwälzte.
Nach dem Essen leckte sich Elena die Soße von den Fingern, lehnte sich bei ihm an und schlang den Arm um ihn wie eine Kette, als Patricio Gallegos die beiden entdeckte und langsam den Hügel hinaufstieg. Er wankte beim Gehen, weil er sich bei einem Felsrutsch die Hüfte gebrochen hatte; die Arbeit in den Minen war nicht ungefährlich. Ramón sah ihm entgegen.
»Hey«, sagte Patricio. »Wie läuft’s?«
Ramón zuckte so gut wie möglich mit den Schultern, während Elena an ihm klebte wie Efeu an der Ziegelwand.
»Und selbst?«, fragte Ramón.
Patricio bewegte die Hand hin und her – weder gut noch schlecht. »Ich habe für eine der Firmen Mineralsalze an der Südküste begutachtet. Ein Scheißjob, aber sie zahlen regelmäßig. Nicht so, wie wenn man unabhängig ist.«
»Man tut, was man tun muss«, sagte Ramón.
Patricio nickte, als habe er eine echte Weisheit von sich gegeben. Auf der Straße drehte sich der chupacabra-Wagen langsam, das große, idiotische Maul kaute Luft. Patricio ging nicht. Ramón beschattete die Augen und sah ihn an.
»Was denn?«, meinte Ramón.
»Hast du die Sache mit dem Botschafter von Europa gehört?«, fragte Patricio. »Der ist gestern Nacht in einen Kampf am El Rey geraten. Irgendein verrückter pendejo hat ihn mit einem Flaschenhals oder so abgestochen.«
»Und?«
»Ja. Er war schon tot, ehe sie ihn ins Krankenhaus schaffen konnten. Der Gouverneur ist ziemlich angepisst.«
»Und weshalb erzählst du mir das?«, wollte Ramón wissen. »Ich bin nicht der Gouverneur.«
Elena saß still wie ein Stein neben ihm, hatte jedoch die Augen durchtrieben zusammengekniffen. Ramón wünschte, dass Patricio gehen oder wenigstens den Mund halten würde. Aber der Mann bekam es nicht mit.
»Der Gouverneur ist mit den ankommenden Enye-Schiffen beschäftigt. Jetzt muss er auch noch den Kerl aufspüren, der den Botschafter getötet hat, und zeigen, dass in der Kolonie Recht und Ordnung und so herrschen. Ein Cousin von mir arbeitet für den Polizeipräsidenten. Da drüben ist der Teufel los.«
»Okay«, sagte Ramón.
»Ich habe nur so gedacht, weißt du, du hängst ja manchmal im El Rey rum.«
»Gestern aber nicht«, erwiderte Ramón und sah ihn finster an. »Frag Mikel, wenn du willst. Ich war die ganze Nacht nicht da.«
Patricio lächelte und trat unbeholfen einen Schritt zurück. Das chupacabra gab ein schwaches, künstliches Brüllen von sich, und die Menschenmenge lachte und applaudierte lautstark.
»Ja, okay«, sagte Patricio. »Ich habe ja nur gedacht. Weißt du …«
Da das Gespräch beendet schien, lächelte Patricio erneut, nickte und humpelte den Hügel wieder hinunter.
»Du warst das doch nicht, oder?«, fragte Elena halb flüsternd, halb gezischt. »Du hast doch diesen verfluchten Botschafter nicht umgebracht?«
»Ich habe niemanden umgebracht, und schon gar keinen Europäer. Ich bin doch nicht blöd«, sagte Ramón. »Warum guckst du dir nicht deine Scheißparade an?«
Es wurde Nacht, und die Parade ging zu Ende. Unten am Hügel auf einem Feld nah am Palast wurde mit einer Fackel ein Holzhaufen um Alten Zozobra angezündet – manche Kolonisten von Barbados nannten ihn Mr. Harding –, eine hastig zusammengeschusterte Puppe, die fast sieben Meter hoch war. Das Gesicht stellte eine groteske Karikatur eines Europäers oder Norteamericanos dar, hatte grün bemalte Wangen und eine riesige Pinocchio-Nase. Das Feuer loderte auf, und die gigantische Puppe fing an, in Flammen eingehüllt mit den Armen zu rudern und vor Schmerz zu stöhnen. Der Anblick war irgendwie unheimlich und ließ es Ramón kalt den Rücken hinunterlaufen, als habe er das zweifelhafte Privileg erhalten, zuschauen zu dürfen, wie eine Seele im Feuer der Hölle gemartert wurde.
Alles Pech, das die Menschen im Laufe des Jahres verfolgt hatte, sollte mit dem Alten Zozobra verbrennen, doch während sich der Riese in den Flammen langsam wand und krümmte und das tiefe, elektronisch verstärkte Klagen von den Mauern des Gouverneurspalasts widerhallte, beschlich Ramón die düstere Vorahnung, dass es eher sein Glück war, das verbrannte. Und dass er von jetzt an Unheil und Missgeschick zu erwarten habe.
Elena saß schweigend da, das Kinn vorgeschoben, und um ihren Mund zeigten sich weiße Linien, seit er sie angefahren hatte – ein Blick auf sie genügte, um zu wissen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis diese Prophezeiung Wirklichkeit werden würde.