

Zum Buch
Im März 2012 reist Hisham Matar zusammen mit seiner Frau Diana und seiner Mutter nach Libyen. Erst jetzt, nach dem Sturz Gaddafis, ist es ihm möglich, in das Land seiner Kindheit zurückzukehren; das Land, das er seit über dreißig Jahren nicht mehr betreten hat. Denn Hisham Matars Vater, ein ehemaliger libyscher Diplomat und Politiker und später einer der mächtigsten Widerstandskämpfer gegen Gaddafis Regime war 1990 in seinem Kairoer Exil mitten auf der Straße vom libyschen Geheimdienst entführt und in das berüchtigte Gefängnis Abu Salim in Tripolis gebracht worden. In den ersten sechs Jahren gelang es dem Vater, seiner Familie insgesamt drei Briefe zukommen zu lassen, danach haben sie nie mehr von ihm gehört.
Hisham Matars Leben war geprägt von der Ungewissheit über das Schicksal seines Vaters, von der Suche nach der Wahrheit, von der Hoffnung, von der Verzweiflung. Für einen Augenblick schien ihn der arabische Frühling der Antwort auf die bohrenden Fragen nach dem Schicksal seines Vaters näherbringen zu können. Doch sein Vater sollte trotz aller Anstrengungen für immer unauffindbar bleiben. In Gesprächen mit Zeitzeugen, Mitgefangenen und Verwandten kommt Hisham Matar der Wahrheit so nahe, wie es nur geht. Und in seinen Erinnerungen und Beobachtungen, den vielen Ereignissen und Erlebnissen schildert er nicht nur die Geschichte seines Landes, seiner Qualen und verheißungsvollen Möglichkeiten, sondern erzählt auch die reiche, aufwühlende Geschichte seiner Familie, der es gelang, Krieg, Diktatur, Exil und Revolution zu überstehen.
Zum Autor
HISAM MATAR, Sohn libyscher Eltern, wurde 1970 in New York City geboren, wuchs in Tripolis und, nach der Emigration der Familie, in Kairo auf. Seit 1986 lebt Hisham Matar in England. Er schreibt für verschiedene Zeitungen und hat zwei international vielbeachtete Romane verfasst, »Im Land der Männer« (2006) und »Geschichte eines Verschwindens« (2011), die mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden.
Zum Übersetzer
WERNER LÖCHER-LAWRENCE, geb. 1956, studierte Journalismus, Literatur und Philosophie und ist der Übersetzer von u. a. Nathan Englander, Nathan Hill, Hilary Mantel, Louis Sachar und Meg Wolitzer.
HISHAM MATAR
Die Rückkehr
Auf der Suche nach meinem verlorenen Vater
Aus dem Englischen
von Werner Löcher-Lawrence
Luchterhand
Inhalt
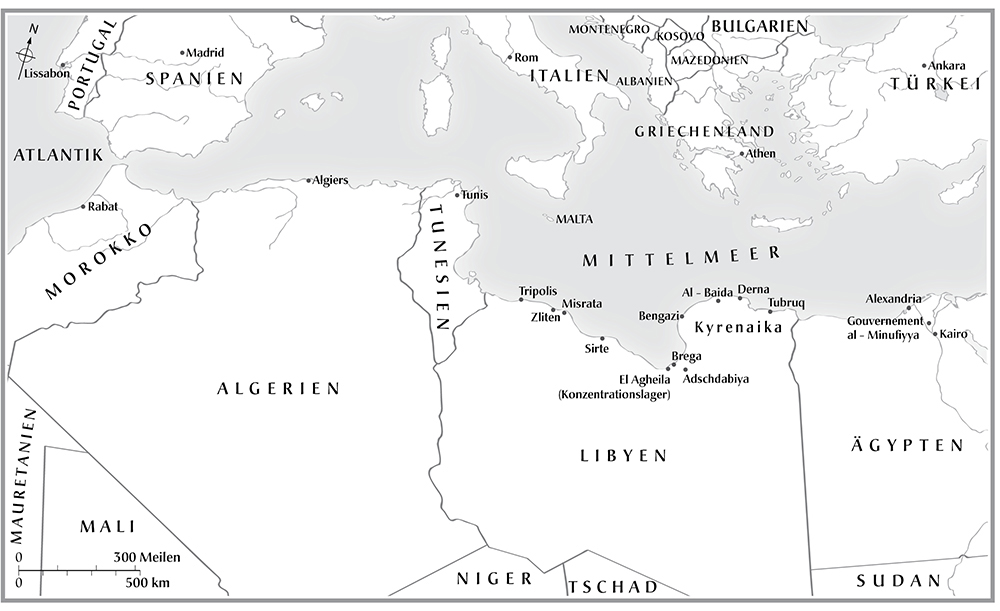
1. Falltür
Früher Morgen, März 2012. In einer Lounge des Kairoer Flughafens saßen meine Mutter, meine Frau Diana und ich in einer auf den gefliesten Boden geschraubten Sitzreihe. Flug 835 nach Bengasi, verkündete eine Stimme, werde planmäßig starten. Von Zeit zu Zeit warf mir meine Mutter einen nervösen Blick zu. Auch Diana schien besorgt. Sie legte eine Hand auf meinen Arm und lächelte. Ich sollte aufstehen und mir die Beine vertreten, sagte ich mir, doch mein Körper rührte sich nicht. Nie hatte ich mich zu größerer Reglosigkeit fähig gefühlt.
Das Terminal war fast leer. Uns gegenüber saß ein einzelner Mann. Er war etwa Mitte fünfzig, übergewichtig und wirkte erschöpft. Etwas an der Art, wie er dasaß, die Hände im Schoß gefaltet und leicht nach links gebeugt, drückte Resignation aus. War er Ägypter oder Libyer? Wollte er dem Nachbarland einen Besuch abstatten, oder kehrte er nach der Revolution nach Hause zurück? War er für oder gegen Gaddafi gewesen? Vielleicht war es ja auch einer jener Unentschlossenen, die ihre Zweifel für sich behalten hatten.
Die Stimme informierte uns, dass das Flugzeug jetzt zum Einsteigen bereit sei. Ich stand ganz vorne in der Schlange, Diana neben mir. Mehr als einmal war ich mit ihr bereits in Nordkalifornien gewesen, wo sie geboren war. Ich kannte die Pflanzen dort, die Entfernungen und die Farbe des Lichts, mit der sie aufgewachsen war. Jetzt endlich fuhr ich mit ihr in mein Land. Sie hatte die Hasselblad und die Leica dabei, ihre zwei Lieblingskameras, und hundert Filme. Diana arbeitet mit großer Genauigkeit. Wenn sie einmal etwas angefangen hat, verfolgt sie es bis zum Ende, was mich fasziniert, in diesem Moment aber auch besorgt machte. Ich will Libyen nicht noch mehr geben, als es mir bereits genommen hat.
Mutter ging an den Fensterscheiben auf und ab, durch die man hinaus auf die Rollbahn sehen konnte. Sie telefonierte. Mehr und mehr Leute, hauptsächlich Männer, strömten in das Terminal, und hinter Diana und mir hatte sich eine lange Schlange gebildet, die durch den Raum mäanderte. Ich gab vor, etwas vergessen zu haben, und zog Diana zur Seite. Nach all den Jahren zurückzukehren war keine gute Idee, dachte ich plötzlich. Meine Familie hatte Libyen 1979 verlassen, vor dreiunddreißig Jahren. Das war die Kluft, die den Mann vom damals achtjährigen Jungen trennte. Das Flugzeug würde sie überqueren, und so eine Reise barg zweifellos Gefahren. Sie konnte mir eine Fähigkeit rauben, an deren Erwerb ich hart gearbeitet hatte, die Fähigkeit, fern von Orten und Menschen zu leben, die ich liebe. Joseph Brodsky, Nabokov und Conrad, sie alle hatten recht gehabt. Diese Schriftsteller waren nie in ihre Heimat zurückgekehrt, sondern hatten versucht, jeder auf seine Weise, ohne sie auszukommen. Was du hinter dir zurücklässt, löst sich auf. Kehre zurück, und du siehst dich mit dem Verschwinden oder der Entstellung dessen konfrontiert, was du einmal geliebt hast. Aber Dmitri Schostakowitsch, Boris Pasternak und Nagib Machfus hatten ebenfalls recht: Verlasse deine Heimat nicht. Gehe, und die Verbindungen zu deinem Ursprung werden abgeschnitten. Du wirst zu einem toten Baum, hart und leer.
Was tust du, wenn du weder gehen noch zurückkehren kannst?
Im Jahr zuvor, im Oktober 2011, hatte ich mit dem Gedanken gespielt, niemals nach Libyen zurückzukehren. Ich war in New York, es war kalt und zugig, und ich wanderte den Broadway hinauf, als sich die Überlegung in meinem Kopf auszuformen begann. Sie hatte etwas Makelloses, eine Idee, die ohne mein Zutun entstanden war. Wie in jugendlichen Momenten der Trunkenheit fühlte ich mich mutig und unbesiegbar.
Ich war im Monat zuvor nach New York gekommen, das Barnard College hatte mich als Gastdozent zum Thema Exilliteratur und Entfremdung eingeladen. Aber es gab auch eine frühere Verbindung zur Stadt. Im Frühjahr 1970 waren meine Eltern nach Manhattan gezogen, als mein Vater zum ersten Sekretär der libyschen Vertretung bei den Vereinten Nationen ernannt worden war. Im Herbst dieses Jahres wurde ich geboren. Drei Jahre später, 1973, kehrten wir nach Tripolis zurück, und seitdem hatte ich New York vielleicht vier, fünf kurze Besuche abgestattet. So war es zwar meine Geburtsstadt, aber dennoch ein Ort, den ich kaum kannte.
In den vielen Jahren seit unserer Flucht aus Libyen haben meine Familie und ich Beziehungen zu verschiedenen Ersatzstädten aufgebaut: Nairobi war die erste Station 1979, und wir sind seither oft dort gewesen. Kairo wurde im Jahr darauf zur Heimstatt unseres neuen Lebens im Exil, auf unbestimmte Zeit. Rom war immer ein Urlaubsziel; mit fünfzehn ging ich zur weiteren Ausbildung nach London und habe dort über neunundzwanzig Jahre lang hartnäckig versucht, mir ein Leben aufzubauen. In meinen frühen Dreißigern zog ich nach Paris, ich hatte London über, die Stadt verdross mich, und ich schwor mir, nie nach England zurückzukehren, nur um zwei Jahre später doch wieder dort zu landen. Aber wo ich auch war, hatte ich mir immer vorgestellt, eines Tages ruhig und in Frieden auf jener fernen Insel zu leben, auf der ich geboren wurde, Manhattan. Ich malte mir aus, wie mir ein neuer Bekannter vielleicht auf einer Dinnerparty, in einem Café oder der Umkleide eines Schwimmbads die alte, ermüdende Frage stellte: »Wo kommst du her?« und ich, unbeeindruckt und frei von aller Unruhe, beiläufig antwortete: »Aus New York.« In meinen Phantasien gefiel es mir, dass diese Aussage gleichermaßen wahr und falsch war, wie bei einem Zaubertrick.
Dass ich in meinem vierzigsten Lebensjahr, als sich Libyen selbst zerriss, nach Manhattan zog, und das am 1. September, dem Tag, da 1969 ein junger Hauptmann namens Muammar al-Gaddafi König Idris abgesetzt und viele mein Leben bestimmende Dinge ihren Ursprung genommen hatten – wo ich lebe, in welcher Sprache ich schreibe und auch diese Gedanken jetzt formuliere –, das alles machte es schwer, die Vorstellung zu ignorieren, dass da eine Art göttlicher Wille am Werk war.
In jeder politischen Geschichte Libyens bilden die 1980er Jahre ein besonders entsetzliches Kapitel. Regimegegner wurden auf öffentlichen Plätzen und in Sportarenen aufgehängt, aus dem Land geflohene Dissidenten verfolgt und einige von ihnen entführt oder umgebracht. Es gab aber auch den ersten bewaffneten, entschlossenen Widerstand gegen die Gewaltherrschaft. Mein Vater war eine der prominentesten Figuren der Opposition. Die Organisation, der er angehörte, hatte ein Ausbildungslager im Tschad, südlich der libyschen Grenze, sowie mehrere Untergrundzellen im Land selbst. Vaters Armeelaufbahn, seine kurze Amtszeit als Diplomat und das private Vermögen, das er als erfolgreicher Geschäftsmann in den 1970er Jahren hatte ansammeln können, indem er so verschiedene Dinge wie Mitsubishi-Automobile und Converse-Schuhe importierte, machten ihn zu einem gefährlichen Feind. Der Staat hatte versucht, ihn zu kaufen, hatte versucht, ihn einzuschüchtern. Ich weiß noch, wie ich eines Nachmittags, da war ich zehn, elf Jahre alt, neben ihm in unserer Wohnung in Kairo saß und das Gewicht seines Arms auf meinen Schultern spürte. Im Sessel uns gegenüber saß einer der Männer, die ich »Onkel« nannte, Männer, die, wie ich irgendwie wusste, seine Verbündeten oder Anhänger waren. Das Wort »Kompromiss« fiel, und Vater sagte: »Ich verhandle nicht. Nicht mit Kriminellen.«
Wann immer wir in Europa waren, trug er eine Waffe bei sich. Bevor wir ins Auto stiegen, mussten wir in sicherer Entfernung warten, während er auf die Knie ging und unter den Wagen sah, die Hände ans Fenster legte, hineinspähte und nach einer möglichen Verdrahtung suchte. Männer wie er waren in Bahnhöfen und Cafés erschossen oder mit dem Auto in die Luft gesprengt worden. Während der 80er Jahre, als ich noch in Kairo lebte, hatte ich in der Zeitung vom Tod eines renommierten libyschen Wirtschaftswissenschaftlers gelesen. Er war im Hauptbahnhof in Rom aus dem Zug gestiegen, ein Fremder hatte ihm eine Pistole an die Brust gehalten und abgedrückt. Das Foto neben dem Artikel zeigte den Toten von Zeitungen bedeckt, wahrscheinlich vom Tag des Attentats, nur die polierten Lederschuhe sahen darunter hervor. Ein andermal war es ein Bericht über einen in Griechenland erschossenen libyschen Studenten, der in einem Athener Straßencafé auf dem Monastiraki-Platz gesessen hatte, als ein Motorroller neben ihm hielt und der Mann hinter dem Fahrer eine Pistole zog und ihn mit mehreren Schüssen tötete. In London wurde ein libyscher Nachrichtensprecher des BBC World Service ermordet, und im April 1984 kam es zu einer Demonstration vor der libyschen Botschaft am Londoner St. James’s Square. Ein Botschaftsmitarbeiter schob ein Fenster im ersten Stock hoch und feuerte mit einer Maschinenpistole in die Menge. Eine Polizistin, Yvonne Fletcher, wurde getötet, elf libysche Demonstranten erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen.
Gaddafis Verfolgung exilierter Regimekritiker, die vom späteren Chef des Auslandsgeheimdienstes Mussa Kussa auf einer öffentlichen Kundgebung Anfang der 80er Jahre publik gemacht wurde, bezog auch die Familien der Dissidenten mit ein. Mein einziger Bruder Ziad war fünfzehn, als er ins Internat in die Schweiz kam, kehrte aber schon einige Wochen später, mitten im Halbjahr, nach Kairo zurück. Wir holten ihn vom Flugplatz ab, und als er zwischen den Leuten im Ankunftsbereich auftauchte, sah er weit blasser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ein paar Tage zuvor hatte ich Mutter einige Telefonanrufe machen sehen, mit zitternden Händen hatte sie die Nummern gewählt.
Die Schweizer Schule lag abgeschieden hoch in den Alpen. Die einzige öffentliche Verkehrsverbindung zum nächsten Dorf bestand in einer Seilbahn, die nur tagsüber ein paar Stunden in Betrieb war. Zwei Tage hintereinander sah Ziad einen Wagen vor dem Haupttor der Schule stehen. Drinnen saßen vier Männer, alle langhaarig, was typisch war für die Leute von Gaddafis Revolutionskomitees. Spätabends wurde Ziad dann ans Telefon im Schulbüro gerufen, und die männliche Stimme am anderen Ende sagte: »Ich bin ein Freund deines Vaters. Du musst genau tun, was ich dir sage: Verlasse sofort die Schule und nimm den ersten Zug nach Basel.«
»Warum? Was ist passiert?«, fragte Ziad.
»Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Du musst dich beeilen. Nimm den ersten Zug nach Basel. Ich erwarte dich dort, und dann erkläre ich dir alles.«
»Aber es ist mitten in der Nacht«, sagte Ziad.
Der Mann gab keine weiteren Erklärungen, sondern wiederholte nur wieder: »Nimm den ersten Zug nach Basel.«
»Das geht nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Bitte rufen Sie nicht wieder an«, sagte Ziad und legte auf.
Der Mann rief daraufhin Mutter an, die in der Schule anrief. Auch sie sagte Ziad, er müsse die Schule sofort verlassen, und erklärte ihm, was genau er zu tun habe.
Ziad weckte seinen Lieblingslehrer, einen jungen Cambridge-Absolventen, der wahrscheinlich gedacht hatte, es müsse toll sein, in den Alpen Literatur zu unterrichten und zwischendurch Ski zu fahren.
»Sir, mein Vater muss operiert werden, und er möchte mich vorher noch sehen. Ich muss mit dem ersten Zug nach Basel. Würden Sie mich bitte zum Bahnhof fahren?«
Der Lehrer rief meine Mutter an, und sie bestätigte Ziads Geschichte. Der Rektor musste geweckt werden. Auch er rief meine Mutter an, und als sie ihm alles bestätigt hatte, checkte Ziads Lehrer den Zugfahrplan. Der nächste Zug nach Basel ging in vierzig Minuten. Wenn sie sich beeilten, konnten sie ihn noch erreichen.
Sie mussten an dem Wagen vorbei, es gab keinen anderen Weg. Ziad beugte sich vor und nestelte an einem Schuhriemen, als sie an den Männern vorbeikamen. Der Lehrer fuhr vorsichtig die sich ins Tal windende Straße hinunter. Nach ein paar Minuten tauchten Scheinwerfer hinter ihnen auf, und der Lehrer sagte: »Ich glaube, die folgen uns.« Ziad tat so, als hätte er nichts gehört.
Am Bahnhof angekommen, schoss Ziad ins Innere und versteckte sich auf der Toilette. Er hörte den Zug einfahren, wartete, bis er vollständig zum Halten gekommen war, gab ein paar Sekunden dazu, damit die Zuggäste aus- und einsteigen konnten, rannte dann los und sprang noch mit auf. Die Türen schlossen sich, der Zug fuhr ab. Ziad war sicher, dass er seine Verfolger abgehängt hatte, doch dann kamen die vier Männer den Gang herunter. Sie sahen ihn, und einer lächelte ihm zu. Sie folgten ihm von einem Waggon zum anderen und murmelten: »Junge, glaubst du, du bist ein Mann? Dann komm und zeig es uns.« Ganz vorne im Zug stand der Schaffner und schwatzte mit dem Lokführer.
»Diese Männer verfolgen mich«, sagte Ziad zu ihm, und zweifellos bebte seine Stimme vor Angst, denn der Schaffner glaubte ihm sofort und sagte, er solle sich neben ihn setzen. Die Männer zogen sich in den nächsten Wagen zurück. Als der Zug in Basel ankam, sah Ziad auf dem Bahnsteig Männer in Uniform stehen. Bei ihnen war der Partner meines Vaters, der in der Schule angerufen hatte.
Ich weiß noch, wie Ziad uns das alles am Esstisch erzählte. Ich war völlig überwältigt, und ein Gefühl von Sicherheit und Dankbarkeit erfüllte mich, aber auch eine neue Angst, die scharf in meinem Inneren pulsierte. Anzusehen war sie mir nicht. Während Ziad erzählte, tat ich so, als faszinierte mich sein Abenteuer, später am Abend jedoch war ich niedergeschlagen, und die Sache ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich musste immer wieder daran denken, was die Männer gesagt hatten. Ziad hatte es uns mehrere Male vorgeflüstert, wobei er den drohenden Ton und den Tripoliser Akzent perfekt traf: »Junge, glaubst du, du bist ein Mann? Dann komm und zeig es uns.«
Kurz darauf musste ich zu einem Augenspezialisten. Mutter setzte mich in ein Flugzeug, und ich flog allein, obwohl ich erst zwölf war, von Kairo nach Genf, wo mich mein Vater abholen sollte. Wir telefonierten noch einmal, bevor es zum Flughafen ging.
»Wenn du mich aus irgendeinem Grund nach der Ankunft nicht sehen solltest, geh zur Information und sag ihnen, sie sollen diesen Namen ausrufen«, sagte er und las mir einen der Namen vor, unter denen er reiste. Ich kannte ihn gut. »Was immer du tust«, wiederholte er, »gib ihnen nicht meinen richtigen Namen.«
Ich kam in Genf an, sah ihn nicht und ging zur Information, um zu tun, was er gesagt hatte. Als mich die Frau hinter der Theke nach dem Namen fragte, geriet ich jedoch in Panik. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Als sie sah, wie durcheinander ich war, lächelte sie und gab mir das Mikrofon: »Magst du ihn selbst ausrufen?« Ich nahm das Mikrofon und sagte mehrmals: »Vater, Vater«, bis ich ihn mit breitem Lächeln auf mich zulaufen sah. Es war mir peinlich, und ich weiß noch, wie ich ihn auf dem Weg aus dem Flughafen fragte: »Warum durfte ich nicht deinen richtigen Namen sagen? Wovor hast du denn Angst?« Wir liefen durch das Gedränge und kamen dabei an zwei Männern vorbei, die Arabisch sprachen, mit einem perfekten libyschen Akzent. Wenn ich damals unseren Dialekt hörte, durchfuhr mich jedes Mal eine wilde Angst. »Wie sieht dieser Jaballa Matar eigentlich aus?«, fragte der eine den anderen. Ich verstummte und beschwerte mich anschließend nie wieder über die komplizierten Reisevorkehrungen meines Vaters.
Es kam für ihn nicht in Frage, mit seinem richtigen Pass zu reisen. Er benutzte falsche Dokumente mit Pseudonymen. In Ägypten fühlten wir uns sicher. Aber im März 1990 wurde Vater vom ägyptischen Geheimdienst aus unserer Kairoer Wohnung entführt und an Gaddafi ausgeliefert. Er kam ins Gefängnis Abu Salim in Tripolis, das als »Endstation« bekannt war: Dorthin schickte das Regime all diejenigen, die es vergessen wollte.
Mitte der 1990er riskierten einige Leute ihr Leben, um drei Briefe meines Vaters zu uns, seiner Familie, zu schmuggeln. In einem von ihnen schreibt er: »Die Grausamkeit dieses Ortes übertrifft bei weitem alles, was wir über die Gefängnisfestung der Bastille gelesen haben. Alles ist von Grausamkeit durchsetzt, doch ich bin und bleibe stärker als ihre Unterdrückungstaktiken … Mein Kopf weiß nicht, wie man sich beugt.«
In einem anderen Brief steht dieser Satz: »Manchmal verstreicht ein ganzes Jahr, ohne dass ich die Sonne sehe oder aus dieser Zelle gelassen werde.«
In ruhiger, genauer und mitunter ironischer Sprache demonstriert er ein erstaunliches Bemühen um Geduld:
Und jetzt eine Beschreibung dieses noblen Palastes … Die Zelle ist ein Betonkasten. Die Wände sind aus vorgefertigten Teilen zusammengesetzt. Es gibt eine Stahltür, durch die keine Luft dringt, und etwa dreieinhalb Meter über dem Boden ein Fenster. Das Mobiliar folgt ganz dem Stil Ludwigs XVI.: eine alte Matratze, von meinen zahlreichen Vorgängern durchgelegen und an vielen Stellen aufgerissen. Die Welt hier ist leer.
Durch diese Briefe und die Aussagen von Gefangenen, die ich mithilfe von Amnesty International, Human Rights Watch und der Schweizer NGO TRIAL bekommen habe, wissen wir, dass mein Vater wenigstens von März 1990 bis April 1996 in Abu Salim war, worauf er aus seiner Zelle geholt und in einen anderen, geheimen Teil des Gefängnisses oder in ein anderes Gefängnis verlegt oder hingerichtet wurde.
Ende August 2011 fiel Tripolis, und die Revolutionäre brachten Abu Salim unter ihre Kontrolle. Sie brachen die Zellentüren auf, und endlich konnten die in die Betonkästen gepferchten Männer hinaus in die Sonne. Ich saß zu Hause in London und verbrachte den Tag am Telefon mit einem der Männer, die da auf die Stahltüren einhämmerten. »Moment, Moment«, rief er, und ich hörte, wie sein Vorschlaghammer auf Metall traf. Es klang nicht wie eine im Freien hängende Glocke, sondern wie eine, die tief in der Erde begraben war, eine ferne Erinnerung: Ich will da sein, und ich will nicht da sein. Zahllose Stimmen riefen durcheinander: »Gott ist groß!« Er überließ den Hammer einem anderen Mann, und ich hörte ihn keuchen, jeder Atemzug voll des Sieges und der Entschlossenheit. Ich will da sein, und ich will nicht da sein. Sie kamen zu einer Zelle im Keller, der letzten noch verbliebenen. Wieder Geschrei, die Leute wetteiferten darum, selbst Hand anzulegen. Mein Mann rief: »Was? Da drin?« Durcheinander. Dann rief er: »Bist du sicher?«, kam zurück ans Telefon und sagte, in der Zelle sei eine wichtige Person aus Adschdabiya, der Heimatstadt meines Vaters, seit vielen Jahren schon sitze er da in Einzelhaft. Ich konnte nicht sprechen. Ich will da sein, und ich will da sein. »Bleib dran«, sagte der Mann am Telefon, er wiederholte es alle paar Sekunden: »Bleib dran.« Ob es zehn Minuten dauerte oder eine Stunde, kann ich nicht sagen. Als sie die Tür endlich aufbekamen, fanden sie einen alten, blinden Mann in einem fensterlosen Raum. Seine Haut hatte seit Jahren keine Sonne gesehen. Sie fragten ihn nach seinem Namen, er konnte ihn nicht nennen. Aus welcher Familie stammte er? Er wusste es nicht. Wie lange war er schon hier? Er hatte offenbar sein Gedächtnis verloren, aber er besaß etwas: ein Foto meines Vaters. Warum? Was hatte er mit Vater zu tun? Der Gefangene wusste es nicht. Obwohl er sich an nichts erinnern konnte, war er glücklich, frei zu sein. Das war das Wort, das der Mann am Telefon gebrauchte: »glücklich«. Ich wollte nach dem Foto fragen. War es ein neues oder ein altes? Hing es an der Wand, hatte der Mann es unter seinem Kissen versteckt, oder lag es neben seinem Bett? Gab es ein Bett? Hatte der Gefangene ein Bett? Ich stellte keine dieser Fragen, und als der Mann sagte: »Es tut mir leid«, dankte ich ihm und legte auf.
Bis Oktober, während ich mich auf meinen Unterricht in New York zu konzentrieren versuchte, hatten die Revolutionäre auch die übrigen politischen Gefängnisse gestürmt, eines nach dem anderen, jeden einzelnen geheimen unterirdischen Raum. Zellen wurden geöffnet, Männer befreit und ihre Namen veröffentlicht. Vater war nicht unter ihnen. Zum ersten Mal ließ sich die Wahrheit nicht mehr verleugnen. Es war klar, dass er erschossen, gehängt, verhungert oder zu Tode gefoltert worden war. Niemand weiß, wann, und die es wussten oder wissen, sind tot oder geflohen, haben zu große Angst zu reden, oder es interessiert sie nicht. War es im sechsten Jahr seiner Gefangenschaft, als seine Briefe aufhörten? War es bei dem Massaker in jenem Jahr in Abu Salim, als 1270 Gefangene zusammengetrieben und erschossen wurden? Oder ist er einsam und allein umgekommen, vielleicht im siebten, achten oder neunten Jahr? Oder erst im einundzwanzigsten, als die Revolution ausbrach? Vielleicht während eines der vielen Interviews, in denen ich das Regime anklagte? Aber vielleicht war Vater ja gar nicht tot, wie Ziad auch weiterhin glaubte, selbst nachdem alle Gefängnisse geöffnet worden waren. Vielleicht war er in Freiheit, wie mein Bruder hoffte, und fand wegen eines Gedächtnisverlusts, weil er nicht mehr sehen, sprechen oder hören konnte, nicht zurück zu uns und irrte wie Gloucester in König Lear umher. »Gebt mir die Hand: Ihr seid nur einen Fuß / Vom letzten Rand«, sagt Edgar zu seinem blinden Vater, der beschlossen hat, sein Leben zu beenden. Seine Worte wollen mir seit fünfundzwanzig Jahren nicht aus dem Kopf.
Es muss die Geschichte von dem Gefangenen sein, der sein Gedächtnis verloren hatte, die Ziad glauben ließ, dass Vater vielleicht doch noch lebte. Ein paar Tage nach meiner Ankunft in New York rief er an und bat mich, jemanden zu suchen, der ein Bild von Vater produzieren konnte, wie er heute aussähe; er wollte, dass wir es überall im Land verteilten und online stellten. »Vielleicht erkennt ihn jemand«, sagte er. Ich sprach mit einer forensischen Künstlerin in Kanada, die so viele Fotos von ihm, seinen Geschwistern und meinem Großvater wie nur möglich wollte. Nachdem ich sie damit versorgt hatte, rief sie an und stellte eine Reihe Fragen über die Umstände, die er im Gefängnis hatte ertragen müssen: Was hatte er zu essen bekommen, wie groß war die Wahrscheinlichkeit von Folter und Krankheit? Zehn Tage später kam die Zeichnung, Vater mit unbarmherzig herunterhängenden Wangen, tief in den Schädel eingesunkenen Augen, und die schwache Narbe auf der Stirn war stark hervorgehoben. Das Schlimmste an der Zeichnung war ihre Glaubwürdigkeit. Ich fragte mich, was sich sonst noch verändert haben konnte. Was war zum Beispiel aus seinen Zähnen geworden, die Dr. Mazzoleni in Rom einmal jährlich überprüft hatte? Wir alle waren zu dem italienischen Zahnarzt gegangen und insgeheim stolz gewesen, wenn er wieder einmal sagte: »Sie sollten Libyen und seinen Mineralien für Ihre ausgezeichneten Zähne dankbar sein.« Und was war mit seiner Zunge und ihrer ganz eigenen Art, meinen Namen zu modellieren, was mit der die Lautstärke bestimmenden Kehle und den übrigen Teilen des Resonanzkörpers, dem Kopf mit seinen Nasenlöchern und anderen Höhlungen, dem Gewicht von Knochen, Fleisch und Hirn – all dem, was den Klang seiner sanften Stimme geformt hatte? Wie würde sich seine neue, ältere Stimme anhören? Ich schickte Ziad das Bild nicht, und nach einer Weile hörte er auf, danach zu fragen. Erst bei unserem nächsten Treffen zeigte ich es ihm, und er sah es an und sagte: »Das ist er nicht wirklich.« Ich stimmte ihm zu und steckte es zurück in den Umschlag. »Zeig es Mutter nicht«, fügte er noch hinzu.
An jenem kalten Oktoberabend in New York begann ich sowohl an meiner Fähigkeit zu zweifeln, nach Libyen zurückzukehren, als auch an meinem Willen, es nicht zu tun. Ich ging zurück in unsere Wohnung auf der Upper West Side und sagte Diana nichts von dem »makellosen« Gedanken, der mir auf dem Broadway gekommen war. Wir aßen zu Abend, anschließend sammelte ich die Teller ein und spülte sie langsam. Danach hörten wir Musik und machten einen Spaziergang durch die dunklen Straßen. In der Nacht schlief ich kaum. Aber mir wurde Folgendes klar: Nie nach Libyen zurückzukehren bedeutete, mir nie mehr zu erlauben, darüber nachzudenken, was letztlich auch eine Form von Widerstand war, und von Widerstand hatte ich genug.
Ich verließ das Haus bei Tagesanbruch und war froh über New Yorks Gleichgültigkeit. Wie ein Waisenkind seine Mutter sehen mag, die es auf den Stufen einer Moschee zurückgelassen hat, hatte ich immer Manhattan betrachtet. Es bedeutete mir nichts und doch alles. In Augenblicken der Verzweiflung stand es für die Möglichkeit, mich am Ende aus dem Exil zu mogeln. Meine Beine waren schwer. Mir wurde bewusst, wie alt ich geworden war, aber auch, dass sich da immer noch etwas Jungenhaftes in mir rührte, als hätte, als wir Libyen verließen, ein Teil von mir aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Ich war so, wie David Malouf sich Ovid in seiner Verbannung vorstellte: durch das Exil infantilisiert. Ich ging zu meinem Büro im College, um mich in meine Arbeit zu versenken, und dachte unterwegs über meine Vorlesung am Nachmittag nach, die sich mit Kafkas Prozess beschäftigen würde. Ich dachte an Ks Güte gegenüber den beiden Männern, die kamen, um ihn hinzurichten, seine finstere, heroische Kapitulation und das, was er sich sagte: »… das einzige, was ich jetzt tun kann, ist, bis zum Ende den ruhig einteilenden Verstand behalten«, und die verbessernde, bedauernde Entdeckung: »Ich wollte immer mit zwanzig Händen in die Welt hineinfahren …« Es war gut, sagte ich mir, dass ich über meine Vorlesung nachdenken konnte. Ich ging über einen Gitterrost im Bürgersteig. Darunter war ein Raum, kaum hoch genug, um darin stehen zu können, und ganz sicher nicht breit genug, um sich hinzulegen. Ein tiefer, grauer Kasten im Boden. Ich hatte keine Ahnung, wozu er diente. Ohne zu wissen, wie es geschah, fand ich mich auf den Knien wieder und spähte hinein, aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte keine Falltür entdecken, kein Rohr oder etwas, das hinausführte. Es überkam mich unversehens. Ich weinte und konnte mich dabei hören.