
Natalie Zemon Davis
Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Gewalt
Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich
Aus dem Amerikanischen von Nele Löw Beer
FISCHER Digital
Mit einem Nachwort von Norbert Schindler

Natalie Zemon Davis wurde 1928 in Detroit geboren. Sie lehrte Geschichte an den Universitäten von Toronto, von Kalifornien (Berkeley), an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Seit 1978 ist sie Professorin für Geschichte in Princeton.
Sie hat ein umfangreiches Werk veröffentlicht, ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, Beratungs- und Herausgebergremien. Für 1986/87 ist sie als Präsidentin der American Historical Association gewählt worden. Für ihre Forschungsarbeiten ist sie seit 1968 mit zahlreichen Preisen ausgestattet worden, darunter mit sechs amerikanischen und europäischen Ehrendoktoraten.
Die in diesem Band versammelten Essays der berühmten amerikanischen Historikerin Natalie Zemon Davis geben eine subtile und faszinierend konkrete Darstellung des gesellschaftlichen Umbruchs am Beginn der Neuzeit, der nicht nur die Lebensweise der Eliten, sondern auch der unteren Bevölkerungsschichten verändert hat. Die populäre Kultur erscheint selbst als dynamisches Moment dieses Umbruchs.
Mit ihrer »dichten Beschreibung« der städtischen Kultur des 16. Jahrhunderts eröffnet die Autorin neue historische Sichtweisen, verweist sie auf Parallelen zu unserer heutigen Situation.
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Impressum der Reprint Vorlage
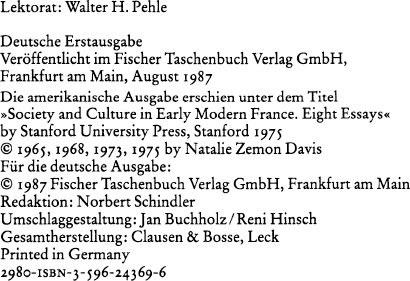
ISBN dieser E-Book-Ausgabe:978-3-10-561706-9
Ich habe diese Frage auch in einem neueren Aufsatz diskutiert. Er erschien unter dem Titel »Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion«, in: Charles Trinkaus und Heiko A. Oberman (Hrsg.), The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion, Leiden 1974, 307–36
Der Name wurde unterschiedlich ausgesprochen: Golfarin, Gorfarin, Gourfarin und Griffarin. Golfarin ist ein altes französisches Wort für »Freßsack«. Dieser Vorwurf wurde den Gesellen häufig von ihren Meistern an den Kopf geworden, denen ihre Forderung nach einer höheren Lebensmittelzulage nicht paßte. Von Golfarin wurde der Name am häufigsten zu Griffarin, einem Neologismus, der auf Klauen oder Krallen anspielte, und damit auf die Macht der Zunft. Siehe N.Z. Davis, »A Trade Union in Sixteenth-Century France«, in: Economic History Review 19 (1966), 48–69
Mit »säkularistisch« (secularistic) spiele ich auf eine breite, aber untereinander verknüpfte Reihe von Phänomenen an: auf die Erklärung, Planung und Rechtfertigung von Ereignissen in diesseitigen Begriffen und auf die Übernahme wachsender Verantwortung für die Lenkung gesellschaftlicher Aktivitäten, die zuvor vom Priesterstand gelenkt worden waren, durch Laien.
Die Tradition der Rebellion legt der spezielle Begriff nahe, der in Lyon für solche populären Revolten verwendet wurde: rebeine. Zu rebeines in Lyon siehe zum Beispiel Claude Bellièvre, Souvenirs, hrsg. v.C. Perrat, Genf 1956, S. 45, 72, 81–101; Guillaume Paradin, Memoires d l’histoire de Lyon, Lyon 1573, S. 234–35; Claude de Rubys, Histoire veritable de la ville de Lyon, Lyon 1604, S. 332, 502, und René Fédou, »Une révolte populaire à Lyon au XVe siècle: La Rebeyne de 1436«, in: Cahiers d’histoire 4 (1959), 129–49. Diese alte Tradition der rebeine ist nur einer von mehreren Faktoren, die Henri Hausers Behauptung unterminieren, daß die Korn-Unruhe von 1529 zum Teil Ausdruck protestantischer Ketzerei war (»Etude critique sur la ›Rebeine‹ de Lyon«, In: Revue historique 61 (1896), 265–307). Henri Hours stellte Hausers Ansicht in »Procès d’hérésie contre Aimé Meigret«, in: Bibliothéque d’humanisme et renaissance 19 (1957), 20–21, in Frage. Darüber hinaus kann keiner der 113 bekannten Aufrührer mit protestantischer Ketzerei in Verbindung gebracht werden, und ihre Berufsstruktur (viele waren ungelernte Arbeiter) unterscheidet sich signifikant von der der protestantischen Bewegung.
Meine Analyse eines Differenzierungs- und Säkularisierungsprozesses ist mit der von Robert N. Bellah in seinem Aufsatz »Religious Aspects of Modernization in Turkey and Japan«, in: The American Journal of Sociology 64 (1958), 1–2 verwandt, wo er zwischen herkömmlichen und auf Prinzipien gegründeten Gesellschaften unterscheidet. Lyon gehört zweifellos zu letzterem Typ. Charles Glocks Diskussion dieses Problems in »The Role of Deprivation in the Origin and Evolution of Religious Groups« (R. Lee und M. Marty, Hrsg., Religion and Social Conflict, New York 1964) ist ebenfalls relevant. Er unterscheidet zwischen Bedingungen, die eine säkulare, und solchen, die eine religiöse Reaktion auf soziale und ökonomische Deprivation ermutigen (S. 29). Ich setze mich jedoch von seiner Analyse ab, indem ich den Versuch der Gesellen, die katholische Kirche zu reformieren, als eine realistische (nicht eine kompensatorische) Reaktion auf das ansehe, was sie als ungerechte Behandlung durch den Priesterstand empfanden.
Etienne Dolets Behauptung, er sei im Jahre 1543 von Handwerksmeistern, als Rache für seine Unterstützung der Gesellen, der Inquisition übergeben worden, ist schwer zu glauben. Erstens waren die Meister, die den Kampf gegen die Arbeiter führten, größtenteils Sympathisanten des Protestantismus: sie hatten bereits die Werke gedruckt, die Dolet vor Gericht gebracht hatten, oder standen kurz davor. Zweitens zeigten Dolets Ansichten über die Gesellen (wie sie sich in seinem Avant-naissance finden, das im Jahre des ersten Streiks geschrieben wurde), daß er keineswegs mit ihnen sympathisierte. Es ist eher wahrscheinlich, daß er den Arbeitern, die er 1538–40 einstellte, gute Bedingungen anbot, denn wie sonst hätte er eine Druckerei einrichten und inmitten ernster Arbeitskämpfe so viele Werke drucken können? Kein Zweifel, daß die anderen Meister dadurch irritiert waren, aber daß sie ihn der Inquisition übergeben hätten, ist unglaubhaft. Statt dessen ist diese Behauptung Dolets entweder seiner Paranoia zuzuschreiben (siehe: Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle, Paris 1947, S. 34–54) oder ein kluges Manöver, die Aufmerksamkeit der Inquisition von seinen vielen evangelischen Publikationen abzulenken.
Nur bei ihrem kurzen und aussichtslosen Kampf mit der Ratsversammlung wegen des Collège de la Trinité drohte die Kirche mit Exkommunikation – hier den Vätern, die ihre Kinder in diese Schule schickten. Es ist wahr, daß in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts die theologische Fakultät der Universität Paris eine Untersuchung über die heterodoxen Praktiken gewisser compagnonnages anstellte. Es ist auch wahr, daß im frühen sechzehnten Jahrhundert die Mißstände und Verderbtheiten in den Handwerksbruderschaften generell von der Französischen Kirche verdammt wurden; siehe: E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières … avant 1789, Paris2 1900, I, 703–4; II, 131. Aber im späten sechzehnten Jahrhundert wollte die Lyoner Kirche zuerst und vor allem die Ketzer zurückgewinnen und hatte weder den Wunsch noch den Apparat, sich auf die Details der Gesellenorganisationen einzulassen. Zu einem ähnlichen Beispiel kirchlicher Toleranz siehe H. Hauser, »Les compagnonnages … à Dijon aux XVIIe et XVIIIe siècles«, in: Revue bourguignonne 17 (1907), 24–32
In einem wichtigen Buch, Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State, to 1620, Cambridge, Mass. 1971, zeigt Brian Pullan, wie das katholische Empfinden der Gegenreformation dazu beitrug, die neuen Wohlfahrtsinstitutionen in Venedig zu formen.
In den Archives de la Charité de Lyon sind etwa zweihundert Familien festgehalten, die während dieser Gesamtzeit von fünfzehn Monaten den Listen hinzugefügt wurden, aber der Beruf der Männer ist nur in 93 Fällen angegeben. Bei den Handwerkern geben die Listen nur selten an, ob der Mann Meister oder Geselle war. Zusätzlich wird der Beruf von drei Frauen angegeben: eine Weberin, eine Krankenschwester und eine Handschuhmacherin.
Abhängigkeit angenommen, weil die Akten die Kinder sonst nicht erwähnt hätten
darunter zwei schwangere Frauen
darunter eine schwangere Frau
Der Mangel an Interesse, den der weltliche Klerus gegenüber der Reform der Armenpflege aufwies, wird illustriert durch die Provinzialsynode, die im März 1527/28 in Lyon zusammenkam und an der Vauzelles an einflußloser Stelle teilnahm. Es wurde ein wenig darüber diskutiert, wie man die Lutherische Ketzerei unterdrücken und die geistliche Moral und Erziehung reformieren könnte; es wurde viel darüber geredet, ob man mithelfen sollte, für das Lösegeld des Königs zu zahlen, es wurde überhaupt nicht über die Armenhäuser oder die Armen geredet.
C.D. Mansi, Hrsg., Sacrorum conciliorum … collectio, Nachdruck, Paris und Leipzig 1901–27, Bd. 32, Spalte 1130ff.
Brian Pullan wies nach, daß in gleicher Weise die Scuole Grandi, die großen Laienbruderschaften von Venedig, zwar ihre Wohltätigkeit ausdehnten und neue Beziehungen zum venezianischen Staat entwickelten, aber dennoch außerstande waren, mit den gröbsten Problemen der Armut im sechzehnten Jahrhundert fertigzuwerden. »Die Scuole Grandi existierten, um den anerkannten, eingesessenen und wohlanständigen Armen zu dienen … Sie kümmerten sich nicht in erster Linie um Landstreicher oder Vertriebene … Sie sorgten für die frommen, wohlanständigen Armen, nicht für Kriminelle und Prostituierte … Handwerker nahmen sie in großer Zahl auf, aber in die tieferen Niederungen der Gesellschaft stiegen sie nicht hinab.« Es war die Aufgabe neuer religiöser Bewegungen, sich in Zusammenarbeit mit dem Staat um dieses Problem zu kümmern. Rich and Poor in Renaissance Venice, Cambridge, Mass., 1971, 168–87.
Brian Pullan berichtet, daß große Spenden für die Mitgift armer Mädchen in den venezianischen Scuole Grandi schon im fünfzehnten Jahrhundert einsetzten.
Während dieser Zeit wurden zwei Knaben auch adoptiert; einer von einem Verleger, der andere von einem Zimmermann.
Seit der Originalveröffentlichung dieses Aufsatzes sind mehrere wertvolle Untersuchungen erschienen, darunter Harold J. Grimm, »Luthers Contribution to Sixteenth-Century Organization of Poor Relief«, in: Archive for Reformation History 61 (1970), 222–33; Robert M. Kingdon, »Social Welfare in Calvin’s Geneva«, in: American Historical Review 76 (1971), 50–69; Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité des Lyon, 1534–1789, (Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Lyon, XXVI), Paris 1971; Marc Venard, »Les œuvres de charité en Avignon à l’aube du XVIIe siècle«, in: XVII Siècle 90–91 (1971), 127–43; Howard Solomon, Public Welfare, Science and Propaganda in Seventeenth Century France. The Innovations of Théophraste Renaudot, Princeton, N.J. 1972; Michel Mollat, Hrsg., Etudes sur l’histoire de la pauvreté (Moyen Age-XVIe siècle) (Publikations de la Sorbonne, Etudes, VIII) Paris 1974; Brian Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice, Cambridge, Mass. 1971; Richard C. Trexler, »Charity and the Defense of Urban Elites in the Italian Communes«, in: F. Jaher, Hrsg., The Rich, the Well Born and the Powerful, Urbana, III. 1974, S. 64–109; Olwen H. Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750–1789, Oxford 1974; Cissie C. Fairchilds, Poverty and charity in Aix-en-Provence, 1640–1789, Baltimore 1976.
Erasmus’ Kolloquim bildet einen interessanten Kontrast zu einem bekannten Dialog aus dem vierzehnten Jahrhundert zwischen einer Frau und ihrem Beichtvater, Schwester Katrei. Als Teil der Sammlung mystischer Literatur, die Meister Eckhart zugeschrieben wird, stellt der Traktat eine Frau dar, die letztlich mehr als ihr Beichtvater weiß – nicht durch religiöse Studien oder Lektüre, sondern durch Erfahrung und Erleuchtung. Siehe Robert E. Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages, Berkeley und Los Angeles 1972, 215–18, und Franz Pfeiffer, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, Göttingen 1906–07, Bd. II, 448–75.
Nancy Roelker fand ein anderes Verhaltensmuster bei den hugenottischen adeligen Frauen, die häufiger als ihre Männer den ersten Schritt zur Bekehrung machten (»The Appeal of Calvinism to French Noblewomen in the Sixteenth Century«, in: The Journal of Interdisciplinary History 2 [1972], 402). Klassenunterschiede wie etwa die bedeutsamere Rolle, die adelige Frauen im öffentlichen Leben spielen konnten im Vergleich zu der, die städtischen Frauen erlaubt war, helfen diesen Gegensatz zu erklären.
In Nîmes wurden in den frühen sechziger Jahren vier Frauen vom Konsistorium beauftragt, Almosen für die Armen zu sammeln (Samuel Mours, Le protestantisme en France au seizième siècle, Paris 1959, S. 218), aber Frauen wurden nicht zu Diakoninnen gemacht. Jean Morély, ein früherer Lehrer am Hofe von Jeanne d’Albret machte sogar den Vorschlag, daß Frauen in der Reformierten Kirche als Diakoninnen dienen sollten. Der Vorschlag erschien in seinem Traicté de la discipline et police chrestienne (1562) zusammen mit anderen phantasievollen Ideen für eine dezentralere und demokratischere Kirchenpolitik, wurde aber nie verwirklicht. Statt dessen wurde Morélys Arbeit von Pastoren in Genf und nationalen Synoden in Frankreich rundweg verdammt. Siehe: Robert Kingdon, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement, Madison, Wisc. 1967, 46–84, bes. 59.
Es scheint nicht gerechtfertigt zu behaupten, wie Roelker das tut, daß Calvins Haltung zur Scheidung »die Frauen zu einer Gleichstellung mit ihren Männern hinführte«. »Indem Ehefrauen wie Ehemännern gestattet wurde, ein Scheidungsverfahren zu beantragen«, bringt sie vor, »erhöhte Calvin ihre Würde und vergrößerte ihre legalen Rechte. Im Genfer Recht festgeschrieben, konnte dies nur die Stellung der Frauen anheben« (»The Appeal of Calvinism«, S. 406). Die Einrichtung der Scheidung mit dem Recht, im Falle von Ehebruch oder sehr langer Abwesenheit wieder zu heiraten, war natürlich eine wichtige Neuerung Calvins und anderer protestantischer Reformatoren. Aber diese Änderung behob nicht die Ungleichheit in den bestehenden Ehegesetzen. Das kanonische Recht hatte schon seit langem Frauen wie Männern das Recht gegeben, im Falle des Ehebruchs des Ehepartners vor einem kirchlichen Gericht das Trennungsverfahren zu beantragen oder unter bestimmten Umständen Verfahren zur Annullierung oder Auflösung der Ehe. Was darüber bestimmte, ob Männer und Frauen in der Tat die gleiche Möglichkeit zur Trennung oder Scheidung hatten, ob vor oder nach der Reformation, war erstens die informelle Wirkung der Doppelmoral, die den Ehebruch des Mannes eher tolerierte als den der Frau, und zweitens die relativ größeren ökonomischen Schwierigkeiten, die sich der Frau beim Unterhalt für sich und ihre Kinder stellten, bevor sie wieder heiraten konnte. Für alle – mit Ausnahme sehr wohlhabender Männer und Frauen – war die Scheidung oder die legale Trennung eine kaum wirklich in Betracht gezogene Möglichkeit. Auf jeden Fall hat die erschöpfende Forschungsarbeit von Roger Stauffenegger gezeigt, daß im späten sechzehnten und frühen siebzehnten Jahrhundert in Genf Scheidungen selten ausgesprochen wurden – Pastoren und Konsistorium drängten die Paare immer, ihre Streitigkeiten zu lösen. Siehe Keith Thomas, »The Double Standard«, in: Journal of the History of Ideas 20 (1959), 200–202; John T. Noonan, Jr., Power to Dissolve, Cambridge, Mass. 1972, Kap. 1–3, 7; R. Stauffenegger, »Le mariage à Genève vers 1600«, in: Mémoires de la société pour l’histoire du droit 27 (1966), 327–28.
Dasselbe kann man im Hinblick auf die Klassenverhältnisse in den beiden Reformationen feststellen, wobei die reformierte Kirche die Formen des religiösen Verhaltens von Handwerkern und sogar Bauern nach oben hin assimilierte, während die katholische Kirche der »Bauernreligion« größeren Freiraum ließ. Obwohl der Calvinismus ohne Zweifel die himmlische und kirchliche Hierarchie vereinfachte, stellte keine der beiden Kirchen das Konzept der sozialen Hierarchie in Frage.
Sowohl Conard wie Cornard wurden als Namen für die Mitglieder der Abtei der Mißregierung in Rouen verwendet, wenn auch Conard häufiger war. Für das Publikum im sechzehnten Jahrhundert hatten die Wörter den Beiklang von Narretei, Sexualität, Macht und Lärm. Ein conard war als ein sot oder Narr definiert. Das Wort wurde auch mit con assoziiert: So behaupten etwa Bilder des sechzehnten Jahrhunderts, die weiblichen Genitalien machten die Männer zu Narren und seien zugleich die Quellen der männlichen Energie. Ein conard war ein gehörnter Ehemann, der die phallischen Hörner auf seinem Kopf trug. Nach einem Kommentar aus dem siebzehnten Jahrhundert waren die beiden Wörter verwandt wegen ihres ähnlichen Klangs, weil Narren und betrogene Ehemänner Hörner auf dem Kopf trugen und weil ein Ehemann ein Narr war, wenn er sich hörnen ließ. Das Tragen der Hörner konnte auch Teuflisches, Heidnisches, Jüdisches beschwören wie auch antike Bedeutungen von Ehre und Sieg und die mittelalterliche gehörnte Mitra des Bischofs, die manchmal auch von einem Abt getragen wurde. Schließlich zeigt ein Holzschnitt aus den dreißiger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts den Abt der Conards, wie er in ein Horn bläst, das eine Flagge mit einem Horn darauf und den auf den Kopf gestellten Wörtern »O Conards« trägt. Die Absicht mag hier gewesen sein, das Spottgelärme zu zeigen, das eine Abtei der Mißregierung machte. Siehe E. Picot und P. Lacombe, Hrsg., Querelle de Marot et Sagon, Rouen 1920, Bd. 1; Pierre Borel, Trésor de Recherches et Antiquitez Gauloises et Françoises, Paris 1655, 101, 110; Grand Larousse de la langue française, Paris 1972, Bd. II, 1847; Eduard Fuchs, Die Frau in der Karikatur, München 1907, 183 (Nachdruck Frankfurt 1973); J.A. Pitt-Rivers, The People of the Sierra, London 1954, 116; William Willeford, The Fool and His Scepter, Evanston, Ill. 1969, 184; Ruth Mellinkoff, The Horned Moses in Medieval Art and Thought, Berkeley, Calif. 1970, Kap. 8, 10.
Die unverheirateten jungen Mädchen hatten auch ihre vorgeschriebenen Rollen im ländlichen Festtagsleben: Sie tanzten mit den jungen Männern, sie nahmen an den Maifestlichkeiten teil, und sie gingen manchmal mit den jungen Männern zu Neujahr zur »quête de l’aguilaneuf« oder »l’aquilaneuf« (verderbte Versionen von »au guy l’an neuf«, was sich von der druidischen Sitte des Mistelzweigsammelns herleitet; siehe M. du Tilliot, Mémoires pour servir à l’histoire de la Fête des Foux, Lausanne und Genf2 1751, 67–71). Aus den jungen unverheirateten Frauen des Dorfes wurden zu bestimmten Zeiten des Jahres, besonders im Mai, auch Königinnen auf Zeit gewählt. Aber waren die Dorfmädchen in eigenen Jugendgruppen organisiert? Van Gennep berichtet von verschiedenen reinages und Bruderschaften unverheirateter Mädchen zu Ehren der Heiligen Katharina (Arnold van Gennep, Manuel de Folklore Français, Paris 1943–49, Bd. I, 207–12), aber es gibt keine Anzeichen dafür, daß sie im Mittelalter oder im sechzehnten Jahrhundert auf dem Land bestanden.
Van Gennep gibt viele Varianten des Wortes Charivari in verschiedenen Teilen Frankreichs an: chalivali, calvali, chanavari, coribari, kériboeéri – sogar hourvari und andere. (Manuel, Bd. I, 622 und 622, Anm. 2).
Charivaris waren besonders gewalttätig, wenn bei der Wiederheirat ein starker Altersunterschied feststellbar war. Manchmal fanden sie nicht statt, wenn beide Gatten vorher schon einmal verheiratet gewesen waren. Geldbußen, die von den Burschen eines anderen Dorfes erhoben wurden, die daherkamen, um den eigenen Mädchen den Hof zu machen, und die Kämpfe, die manchmal bei diesen Gelegenheiten ausbrachen, spiegeln meines Erachtens ebenfalls die Erkenntnis der Bedrohung des Kreises der Heiratsfähigen wider.
Ich folge hier der Adoleszenz-Definition von Elizabeth Douvan und Joseph Adelson, The Adolescent Experience, New York 1966, 4–21, 346–47. Die Arbeiten von Philippe Ariès, Kenneth Keniston und John und Virginia Demos haben uns geholfen, die Entwicklung moderner Adoleszenzvorstellungen zu verstehen (siehe Anm. 42). Aber wir sollten den Terminus »Adoleszenz« nicht nur für die Formen und Definitionen reservieren, denen dieses Lebensstadium in westlichen Ländern während des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts unterliegt. Das scheint besonders wichtig, weil die Untersuchung von Douvan und Adelson über ein sehr großes amerikanisches sample zeigt, daß einige der angeblich typischen Wesenszüge der Adoleszenz – Unzufriedenheit, Sturm und Drang – selbst heute nur für einen kleinen Prozentsatz adoleszenter Jugendlicher charakteristisch sind (S. 350–51). Es wäre also besser anzunehmen, daß die Adoleszenz, der Zeitraum vom Eintritt der Pubertät bis zur vollen Übernahme der Erwachsenenrollen in wie immer geringem Maße in jeder Gesellschaft anerkannt wird, und man könnte dann systematisch die verschiedenen Arten untersuchen, auf die sie definiert, bewertet und organisiert wird. David Hunt hat in bezug auf Ariès’ Behandlung des Säuglingsalters und der frühen Kindheit einen ähnlichen Vorschlag gemacht (Parents and Children in History. The Psychology of Family Life in Early Modern France, New York 1970, Kap. 2).
Im Vorwort zu seiner Neuauflage der Geschichte der Kindheit hat Ariès einen Teil des Beweismaterials, das ich in meinem Essay vorgelegt habe, in Betracht gezogen (München 1978, 50–54). Er fragt nach dem Alter der Mitglieder der Jugendabteien und weist darauf hin, daß sie Organisationen der Junggesellen (»célibataires«) zu einer Zeit waren, in der Männer häufig spät heirateten. »Der Gegensatz bestand also zwischen dem Verheirateten und dem Unverheirateten.« Wie ich bereits vorbrachte, konnte der Zeitraum der männlichen jeunesse im sechzehnten Jahrhundert auf dem Land durchaus vom vierzehnten Lebensjahr bis Anfang Zwanzig dauern, aber das heißt nicht, daß ihr deutlich unterscheidbare und jugendliche Merkmale fehlten. Zeitgenossen meinten, das Wort »bachelier« habe die ursprüngliche Bedeutung von »Jugend« (»ein junger Adoleszenter, der im Begriff ist, in das Alter der Männlichkeit einzutreten«, Pierre Borel, Dictionnaire des termes du vieux françois, Paris 1750, 17), und die Riten und Festlichkeiten, die oben beschrieben wurden, erhielten ihre Bedeutung sowohl vom jugendlichen wie vom unverheirateten Status ihrer Akteure. Schließlich war die Zahl der älteren Junggesellen in einem Dorf im Vergleich zur Zahl der Jugendlichen klein. Es gibt einige Belege dafür, daß Junggesellen nach einem bestimmten Alter nicht nur Zielscheibe des Spottes der dörflichen Jugendabtei waren, sondern in gewisser Weise auch an die Stellung der Verheirateten oder Verwitweten angeglichen wurden (A. Varagnac, Civilisation traditionelle et genres de vie [Paris, 1948], 99–100, 117–118, 253).
Die medizinische Literatur des sechzehnten Jahrhunderts meinte, daß die männliche Pubertät im Durchschnitt mit 14 beginnt und das »age d’adolescence« gewöhnlich von 14 bis 20 oder 21 dauert und eine Zeit »natürlicher Kraft« ist, während der körperliches Training wichtig ist (Laurent Joubert, Erreurs populaires au fait de la medecine et regime de santé … la premiere partie, Bordeaux 1578, Buch II, Kap. 2; Hierosme de Monteux, Commentaire de la conservation de santé, Lyon 1559, 202–3). Ariès selbst weist darauf hin, daß Drucke, die die Lebensstadien darstellen, den älteren Jugendlichen bei der Werbung um ein Mädchen zeigen. Obwohl die lange Debatte über das genaue Alter, in dem Kinder zuerst zur Beichte gehen und das Bußsakrament erhalten sollten, beim Trientiner Konzil noch immer ungelöst war, stellten Theologen immer fest, daß geschlechtliche Sünden erst ab dem Alter von vierzehn Jahren geschehen konnten. Die Handbücher der Beichtväter befaßten sich mit den sinnlichen Gedanken des Teenagers und seinem Bedürfnis, andere zu berühren, und die Regeln der Kollegien trennten aus ähnlichen Gründen die Sechzehnjährigen von den Knaben im Alter von acht oder neun Jahren (siehe H.C. Lea, A History of Auricular Confession and Indulegences in the Latin Church, Philadelphia 1896, Bd. 1, 400–404; Jean Gerson, »Brève manière de confession pour les jeunes«, in: Opera omnia, hrsg.v.Mr. Glorieux, Paris 1966, Bd. 7, 408–9; Astrik Gabriel, Student Life in Ave Maria College, Mediaeval Paris, Notre Dame, 1955, 105). Eine andere Art der Unterscheidung zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsenendasein trifft der liberale Protestant Sébastien Castellion in seiner Beschreibung der Stadien der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts. Während des Zeitalters des Gesetzes oder des Vaters befiehlt Gott der Menschheit wie ein Vater dem kleinen Kind, wobei er nur äußeren Gehorsam erwartet; während des Zeitalters des Evangeliums oder des Sohnes bringt Christus der jugendlichen Menschheit die Lehre durch das Evangelium; während des Zeitalters des Heiligen Geistes wird der erwachsene Mensch durch die vollkommene Inspiration des Geistes gelenkt (F. Buisson, Sébastien Castillion, [Paris 1892], Bd. 2, 193–97). Siehe auch die Diskussion der besonderen Gefahren und Freuden der Jahre zwischen Pubertät und Heirat, In: Charles V. Langlois, La vie en France au moyen âge, Paris 1925, Bd. 2, 217–25. Die Charakterisierung der jugendlichen Entwicklung in diesen Werken ist nicht gerade dieselbe, die man heute vornehmen würde, aber sie ist eine Charakterisierung!).
Wie auf dem Lande war die Mitgliedschaft in den Abteien auf Männer beschränkt. Alle Würdenträger mit weiblichen Namen waren als Frauen verkleidete Männer (siehe Kapitel 5). Frauen nahmen natürlich an den Festlichkeiten teil und schauten ihnen zu. Bei der Parade von 1541 in Rouen besuchten die Conards Frauen, tanzten mit ihnen und gaben ihnen Süßigkeiten und Blumen. Bei der chevauchée de l’âne von 1566 in Lyon waren mit der Abtei zusammen einige Frauen in weiblichen Kostümen im Festzug, das heißt zwölf Frauen, die als »Egyptiennes« gekleidet waren. Festorganisationen für Frauen noch am nächsten kam die Institution der auf Zeit gewählten Königinnen, wie etwa in Abbeville, wo seit dem vierzehnten Jahrhundert in jedem Stadtviertel am Osterdienstag eine Königin gewählt wurde. (R. Vaultier, Le folklore pendant la Guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trésor des Chartes, Paris 1965, 61–62). Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wurden französische Bordelle manchmal »Abbayes« genannt und hatten eine Äbtissin an der Spitze, aber dies waren Vergnügungsorganisationen ganz anderer Art.
Rabelais übergeht Zweitheiraten mit einem antiklerikalen Witz, aber er verbreitet sich über die Frau, die den Ehemann schlägt. »Bei der Erschaffung der Welt oder ein bißchen später verschworen sich die Frauen, den Männern bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen, weil die überall versuchten, sich zu ihren Herren aufzuwerfen.« Panurge sorgt sich, daß er eine solche Frau heiraten könnte, und plant sie statt dessen lieber zu schlagen. (Le Tiers Livre, Kap. 6, 9, 12, 14, 18).
Weibliche Ärzte akzeptierten ebenfalls die Theorie der »wandernden Gebärmutter« und verschrieben Rezepte gegen weibliche Hysterie. Siehe A Choice Manual of … Select Secrets in Physick … Collected and Practised by … the Countesse of Kent, London 1653, 114, 145; Recueil des Remedes … Recueillis par les Ordres Charitables de … Madame Fouquet, Dijon4 1690, 168–89; Jean de Rostagny, Traité de Primerose sur les erreurs vulgaires de la medecine, Lyon 1689, 774; Angelique Du Coudray, Abrégé de l’art des Accouchements, Paris 1759, 173.
Einige Schriftstellerinnen aus dem sechzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert wie Margarete von Navarra, Madame de Lafayette, Aphra Behn und Mary de la Rivière Manley akzeptierten diese Ansicht nicht. Obwohl sie es nicht so darstellten, als seien Frauen notwendigerweise lüsterner als Männer, nahmen sie an, daß die sexuellen Begierden der Frauen denen der Männer mindestens gleich seien.
Die englische Definition der Tötung eines Ehemannes durch seine Frau als Verrat statt als Mord könnte als ein frühes Beispiel der hier beschriebenen Symbolik gelten. Verrat als vom Hochverrat unterschiedenes Verbrechen tauchte im vierzehnten Jahrhundert auf und bestand als solches bis zum frühen neunzehnten Jahrhundert fort. Dazu zählte die Tötung eines Herrn durch seinen Diener, eines Ehemannes durch seine Frau und eines Prälaten durch einen Weltgeistlichen oder einen Mönch. Wie Blackstone das Gesetz darstellt, scheint es sich von früherer germanischer Rechtspraxis zu unterscheiden, die den Mord an jedem der beiden Gatten durch den anderen als gleichschweres Verbrechen behandelte. Die Entwicklung des Begriffs Verrat und des zugehörigen Gesetzes hing eng mit der Entwicklung der Idee der Souveränität zusammen. J.G. Bellamy, The Law of Treason in England in the Later Middle Ages, Cambridge, Engl. 1970, 1–14, 225–31; William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford 1770, Buch IV, Kap. 14, einschließlich Anm. t.
Der Gebrauch von männlich/weiblich als Ausdruck sozialer Beziehungen (Herr/Diener, Souverän/Untertan und dergleichen) ist nicht die einzige Art von sexuellem Symbolismus im frühneuzeitlichen Europa, obwohl Grundlage der Diskussion in diesem Aufsatz. Eric Wolf betrachtet männlich/weiblich als Ausdruck der Beziehungen öffentlich/häuslich und instrumentell-ordnend/expressiv-ordnend in »Society and Symbols in Latin Europe and in the Islamic Near East«, in: Anthropological Quarterly 42 (Juli 1968), 287–301. Als Versuch einer sehr umfassenden Theorie des sexuellen Symbolismus siehe Sherry B. Ortner, »Is Female to Male as Nature is to Culture?«, in: Michelle Zimbalist Rosaldo und Louise Lamphere, Hrsg., Woman, Culture and Society, Stanford, Kalif. 1974, 67–87.
Die Zweideutigkeiten in Epicoene stellten sich durch den Umstand her, daß die Schweigende Frau im Stück ein Mann war, der eine Frau spielte, das heißt ein männlicher Schauspieler, der einen Mann spielte, der eine Frau spielte. Professionelle Schauspielertruppen nahmen natürlich immer Männer für Frauenrollen – in England bis zur Restaurationszeit, in Frankreich bis zur Regierungszeit Heinrichs IV. Siehe J.H. Wilson, All the King’s Ladies. Actresses of the Restoration, Chicago 1958, und Léopold Lacour, Les premières actrices françaises, Paris 1921.
Obwohl die Belege für die Bärenjagd an Lichtmeß am vollständigsten und deutlichsten aus den französischen und spanischen Pyrenäen kommen, gibt es Anzeichen dafür, daß sie im Mittelalter weiter verbreitet war. Im neunten Jahrhundert zog Hinkmar von Reims über »schändliche Spiele« mit Bären und Tänzerinnen her. Richard Bernheimer hat eine Verbindung zwischen der Bärenjagd und der Jagd auf den wilden Mann behauptet, die in verschiedenen Teilen Europas veranstaltet wurde, was Claude Gaignebet bestätigte, der sie darüberhinaus mit dem populären Stück von Valentin und Ourson in Beziehung setzt. Breughel stellte dieses Spiel in einer Radierung und in seinem Gemälde der Schlacht zwischen Karneval und Fasten dar: ein Mann, als Frau maskiert und angezogen, hält dem wilden Mann einen Ring hin. Siehe R. Bernheimer, Wild Men in the Middle Ages, Cambridge, Mass. 1952, 52–56; C. Gaignebet, »Le combat de Carneval et de Carême de P. Breughel (1559)«, in: Annales, Economies, Sociétés, Civilisations 27 (1972), 329–31.
Die Amazonen spielen zum Beispiel in Thomas Hobbes’ bemerkenswerter theoretischer Diskussion der Herrschaft in der Familie eine Rolle. Wie zu seiner Zeit üblich, besteht er darauf, daß diese Herrschaft nur bei einer Person liegen darf, aber »wenn einige die Herrschaft nur dem Manne als dem hervorragenderen Geschlecht zugeschrieben haben, so verrechnen sie sich damit. Denn zwischen Mann und Frau besteht nicht immer ein solcher Unterschied an Stärke und Klugheit, als daß ohne Krieg entschieden werden könnte, wem das Recht zusteht.« In Staaten wird der Konflikt durch das Gesetz entschieden, das meist eine Entscheidung zugunsten des Vaters fällt. Aber im Naturzustand wird die Entscheidung von der Erzeugern der Kinder getroffen. Sie kann durch Vertrag getroffen werden. »Wir finden in der Geschichte, daß die Amazonen mit den Männern der Nachbarländer, mit denen sie wegen Nachkommenschaft verkehrten, vertraglich festlegten, daß ihnen die männlichen Nachkommen geschickt werden, die weiblichen jedoch bei ihnen bleiben sollten, sodaß die Herrschaft über die Mädchen bei der Mutter lag.« Wenn kein Vertrag geschlossen wird, liegt die Herrschaft bei der Mutter – das heißt, wenn es keine Ehegesetze gibt, bei der einzigen Person, die weiß, wer die wahren Eltern sind, und die in der Lage ist, das Kind großzuziehen. Leviathan (übers.v.Walter Euchner, Neuwied 1966) Teil II, Kap. 20.
Die Verbindung dieser verkleideten Figuren mit »Elfen«, die auch bei einigen anderen Aufständen hergestellt wurde, fügt dem politischen Kleidertausch eine weitere Dimension hinzu. Im ländlichen Europa des achtzehnten Jahrhunderts war der Elfenglaube noch sehr verbreitet, der aus verschiedenen Traditionen stammte, darunter einer, die die Elfen mit den Geistern der Toten in Verbindung brachte. Elfen konnten männliche oder weibliche Gestalt annehmen, sie konnten verschiedene Größe und Erscheinungsform haben und unterschiedlich gekleidet sein, aber sie besaßen alle eine spirituelle Macht, die sie entweder übelwollend oder wohlwollend gegen die Menschen gebrauchen konnten. Frauen- und Elfenmacht verbünden sich in diesen Aufständen, um den Bauern zu helfen. Siehe K.M. Briggs, The Fairies in Tradition and Literature, London 1967, und Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic, London 1971, 606–14.
Wo möglich, habe ich versucht, sowohl katholische als auch protestantische Darstellungen desselben Vorkommnisses zu verwenden. Zum Beispiel habe ich zu den Ereignissen von 1562 in Toulouse unter anderem die Darstellung des Katholiken G. Bosquet verwendet (Histoire de M.G. Bosquet, sur les troubles Advenus en la ville de Tolose l’an 1562, Toulouse 1595) und die reformierte Histoire ecclésiastique. Ich habe Beschreibungen katholischer Gewaltanwendung von katholischen Autoren besonders ernst genommen (wie in den Mémoires des Priesters Claude Haton) und ebenso Beschreibungen protestantischer Gewaltanwendung, die aus der Histoire ecclésiastique stammen. Diese Quellen sagen nicht notwendigerweise die ganze Wahrheit über die Gewalttätigkeiten ihrer Partei, aber wir können zumindest annehmen, daß das, was sie ausdrücklich beschreiben, auch wirklich passiert ist. Ich habe es auch besonders ernst genommen, wenn bestimmte Formen von Gewalttätigkeit bei den Anklagen einer Partei gegen die gegnerische Partei ausgelassen wurden, da die Autoren sehr wenig Bereitschaft zeigen, ihre Gegner in einem günstigen Licht erscheinen zu lassen. Wenn bestimmte Arten der Gewalttätigkeit dem Feind in der Regel nicht zugeschrieben werden, können wir, denke ich, annehmen, daß sie tatsächlich nicht sehr oft geschahen.
In Bezug darauf, ob man Darstellungen der Entweihung von Toten, der Folter und obszöner Handlungen als Tatsachen akzeptieren soll, wenn es keine »unparteiischen« Augenzeugenberichte gibt, habe ich mein eigenes Urteilsvermögen benutzt, das sich auf eine allgemeine Kenntnis der Bandbreite möglichen Verhaltens im sechzehnten Jahrhundert stützt. Meine Richtschnur waren hier die französische Rechtspraxis und das französische Strafrecht, Rabelais, Beschreibungen von Pierre de L’Estoile über Verhaltensweisen, die im späten sechzehnten Jahrhundert in Paris üblich waren, und die Kommentare von Montaigne über Folterungen in seiner Zeit (»Über die Grausamkeit«, »Über die Kannibalen«).
Ich habe in diesem Abschnitt versucht, Janine Estèbes wichtige Erkenntnis über die Rolle des Volkes bei den Massakern der Bartholomäusnacht zu verallgemeinern, daß nämlich die Protestanten als die »Lästerer« erschienen (Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy, Paris 1968, 194–5). Jedoch scheint es mir wenig Beweise dafür zu geben, daß die Katholiken eine »fremde Rasse« (S. 197) auslöschen wollten. Das ist eine Übertreibung und Fehlinterpretation der Belege über die Ermordung schwangerer Frauen und die Kastration von Männern (siehe unten, S. 195 und 199). Die Ketzer wurden wegen ihrer unreinen, spalterischen und lasterhaften Handlungen gehaßt, nicht als »Rasse«, und die Menge trieb sie zuweilen eher in die Messe zurück, anstatt sie zu töten.
Eine hilfreiche Diskussion des Verhältnisses zwischen den Befleckungsängsten und der Sorge um soziale Schranken findet sich bei: Mary Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London 1966, Kap. 7. (Deutsche Übersetzung: M.D., Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Berlin 1985).
Auch protestantische Autoren hoben die göttliche Intervention hervor, um damit Gottes Mißfallen an katholischen Aufrührern und katholischer Gewalttätigkeit zu dokumentieren. Zum Beispiel wurde behauptet, in Draguignan habe man zwei von der Menge erschlagene Protestanten drei Monate später gefunden, ohne daß ihre Körper irgendwelche Anzeichen von Verwesung gezeigt hätten, und ihre Wunden hätten immer noch frisch ausgesehen. Ein Katholik, der die Leichen bewacht hatte, wurde von protestantischen Soldaten getötet, und sein Körper verfaulte sofort und wurde von Krähen und Hunden gefressen. In Marennes (Charente-Maritime) starb ein reicher Bürger, der versucht hatte, die Abhaltung protestantischer Gottesdienste zu verhindern, und einen Protestanten verprügelt hatte, kurz darauf am Schlagfluß. Darin sah man die »Hand Gottes«, und daraufhin bekehrten sich seine Kinder zu der neuen Religion. Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées au Royaume de France, hrsg. v.G. Baum und E. Cunitz, Paris 1883–89, Bd. 1,428, 357.
Eine neue Studie über Spanien im fünfzehnten Jahrhundert hat gezeigt, wie komplex der Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Lebensmittelpreise und antisemitischen Pogromen war. Der Autor meint, daß ein Anstieg der Lebensmittelpreise zum allgemeinen Hintergrund verschiedenster Volkserhebungen gehört. Je schärfer der Preisanstieg, um so wahrscheinlicher war es, daß die Unruhe nicht »ausschließlich antisemitischen Charakter« hatte. Angus MacKay, »Popular Movements and Pogroms in Fifteenth-Century Castile«, in: Past and Present 55 (Mai 1972), 58–59.
Jean Crespin (Histoire des Martyrs) schätzt, daß in den Massakern von 1572 in Rouen etwa 550 Männer und 50 Frauen getötet wurden, in Orléans 1800 erwachsene Männer und 150 erwachsene Frauen. Von der Lyoner Blutvesper sind keine weiblichen Toten überliefert. In Paris waren so viele Frauen unter den Opfern, daß am 28. oder 29. August verfügt wurde, es sollten keine Frauen, besonders keine schwangeren Frauen mehr getötet werden. Aber selbst hier zeigen die Auflistungen erheblich weniger weibliche als männliche Tote. Das gleiche trifft auf frühere katholische Massenaktionen zu, zum Beispiel 1562 in der Provence (siehe Anm. 87). Aus diesen Schätzungen wird klar, daß schwangere Frauen nicht die bevorzugten Zielscheiben gewesen sein können, obwohl sie offensichtlich nicht geschont wurden. Ob sie die »auserwählten Opfer« (victimes de choix) katholischer Haufen waren, wie Estèbe behauptet (Tocsin, S. 197), weiß ich nicht. Sie bringt das, ebenso wie die Kastration männlicher Leichen, mit dem Versuch in Verbindung, »eine fremde Rasse, eine verhaßte und verfluchte Rasse« auszulöschen. Wie oben gesagt, finde ich keinen Beweis dafür, daß man die Hugenotten als »Rasse« betrachtet hätte. Wegen ihrer Ketzerei erschienen sie als Außenseiter und ihren Mördern schließlich nicht mehr als Menschen, aber das ist keine rassische Unterscheidung. (Zur Kastration von Leichen siehe S. 199.) Was protestantische Morde an Frauen angeht, so berichten katholische Quellen (siehe Anm. 87), daß Frauen im Massaker von Saint Médard in Paris, bei den Maiereignissen in Toulouse 1562 und in der Diözese von Angoulême von Hugenotten getötet wurden. Die Vergewaltigung von Nonnen wurde aus Montauban im Jahre 1562 berichtet. Insgesamt sagen die Darstellungen protestantischer Massenaktionen wenig über Angriffe auf Frauen aus. Anders verhält es sich dagegen mit den Statuen der Jungfrau Maria und weiblicher Heiliger.
In meinem geplanten Buch über Lyon im Zeitalter der Reformation zeigt die Untersuchung der sozialen und beruflichen Verteilung mehrerer tausend männlicher Protestanten aus dieser Stadt in der Zeit bis 1572, daß ihre Rekrutierung aus der konsularischen Elite, den Notabeln und den menu peule zahlenmäßig etwa dem Anteil dieser Gruppen an der Bevölkerung entsprach. Die Analyse zeigt aber auch, daß sie besonders aus den neueren oder höher qualifizierten Berufen kamen – Berufen, in denen die Alphabetisierungsrate höher lag oder die sich (wie etwa die Tavernenwirte) durch die Entwicklung der Städte im frühen sechzehnten Jahrhundert gewandelt hatten. An der Spitze der städtischen Gesellschaft neigt eher die neue als die etablierte Elite zum Protestantismus (in Lyon sind es daher aus den Ratsherren-Familien eher die wohlhabenden Kaufleute als die Juristen, die zum Protestantismus tendieren). Diese Berufsstruktur bildet sich natürlich nicht genau im Kreis der Opfer der Massaker ab, da stets vielerlei Faktoren am Werk waren, wenn jemand als Opfer auserkoren wurde. Zum Beispiel wurden bei der Blutvesper in Lyon nur wenige Angehörige des Verlagsgewerbes getötet (die libraires Jean Honoré, Mathieu Penin und Jean Vassin, der Buchbinder Mathurin Le Cler und der Korrektor Jean de Saint Clément), obwohl ein großer Prozentsatz der Mitglieder dieses Gewerbes in den sechziger Jahren protestantisch gewesen war und viele Meister und Verleger es 1572 immer noch waren. Meinem Eindruck nach befanden sich zwar auch in anderen Städten Mitglieder des Druckgewerbes unter den Opfern, sie waren aber im Verhältnis zu ihrer Zugehörigkeit zur Reformierten Kirche unterrepräsentiert. Dies läßt sich möglicherweise mit den besonderen Beziehungen, die die Männer aus diesem Gewerbe besaßen, erklären oder mit ihrer häufigen Abwesenheit aus Frankreich.
Für Meaux wurden die Namen von zehn Handwerkern aufgeschrieben, worauf der Autor sagt »und viele andere Handwerker, bis zur Zahl von zweihundert oder mehr«. Die Genauigkeit der Zahl ist zweifelhaft, aber sie spiegelt den Eindruck wider, den die Zeitgenossen von der Schicht der Bevölkerung hatten, die von den Massakern betroffen war.
An verschiedenen Orten wurden Exkremente auch von katholischem Volk auf Protestanten geworfen (Crespin, Martyrs, 2:545; 3:203–4, 672). In einem außerordentlichen Fall wurden in Toulouse Protestanten, die sich in den Abwässerkanälen am Fluß versteckten, von großen Wasserströmen, die die Katholiken in die cloacas gegossen hatten, mit Exkrementen bedeckt herausgeschwemmt und dann ertränkt. (Hist. eccl., 3, 19)
Es gibt noch weitere Beispiele für die Neubenennung von Werkzeugen oder Akten der Gewaltanwendung. Die Protestanten in Béziers und Monpellier nannten die Knüppel, mit denen sie Priester, Mönche und andere katholische Feinde schlugen, épomettes oder »Federwische«. Katholiken in Mont-de-Marsan und Umgebung verwendeten denselben Terminus für die Keulen, mit denen sie Protestanten schlugen. In Agen hießen die Galgen, an denen die Protestanten aufgehängt wurden, »Konsistorium«. In Rouen nannte der katholische Mob die Ermordung von Hugenotten: »es ihnen bequem machen«. Siehe Anm. 106.
In der Größe variierten die Mobs von einer Handvoll bis zu mehreren hundert Leuten (Crespin, Martyrs, Bd. 3:726). Größere und längere Zeit währende Unruhen in den Städten konnten mehrere tausend Menschen auf beiden Seiten auf die Beine bringen, niemals aber die ganze Stadtbevölkerung. Viele schauten bloß zu, wieder andere blieben zu Hause. In einer vor einigen Jahren erschienenen Untersuchung Calvinist Preaching and Iconoclasm in the Netherlands in 1566 [Cambridge University Press, 1978,] erstellt Phyllis Mack Crew eine interessante Analyse der dortigen politischen und religiösen Situation, die diese kleinen Haufen von Bilderstürmern hervorbrachte.
Die interessanteste neue Jugendgruppe, die in dieser Zeit gebildet wurde, waren die Pfeifer (Sifflars) von Poitiers – so genannt nach einem Pfeifchen, das ihre Mitglieder um den Hals trugen. Sie war um 1561 von Studenten gegründet worden und verspottete ursprünglich beide Religionen. Bei der Aufnahme mußten die Kandidaten beim Fleisch, Bauch, Tod und dem »würdigen Doppelkopf, vollgestopft mit Reliquien« sowie bei all der Gottheit in diesem Maß Wein schwören, daß sie treue Pfeifer sein wollten und daß sie statt zum protestantischen Gottesdienst, zur Messe oder zur Vesper zweimal täglich ins Bordell gehen würden etc. Die Gruppe wuchs auf 64 junge Männer an und entwickelte eine besonders feindselige Haltung gegen die Reformierte Kirche, vielleicht weil die Reformierten feindselig gegen sie waren. Ihre Mitglieder begannen bewaffnet herumzuziehen. (Hist. eccl. I, 844–45)
Diese Unterscheidung ist notwendig, wird aber in der Umgangssprache nicht gemacht. Ich folge der Terminologie von T.J. Clark, Image of the People. Gustave Courbet and the Second French Republic, 1848–1851, New York, 1973, 12.
Schätzungen über die Lesefähigkeit, die auf der Fähigkeit, seinen Namen zu schreiben, beruhen, stimmen natürlich nur annähernd. Man kann lesen lernen, ohne schreiben zu lernen und umgekehrt. Dessenungeachtet wurden die beiden Fertigkeiten im sechzehnten Jahrhundert meist gemeinsam gelehrt. Statistiken über die Fähigkeit, mit dem Namen zu unterschreiben, geben uns somit die Größenordnung der Anzahl der Lesekundigen an. Zu einer Diskussion der Techniken, den Alphabetisierungsgrad in der Frühneuzeit zu messen, siehe R.S. Schofield, »The Measurement of Literacy in Pre-Industrial England«, in J.R. Goody, Hrsg., Literacy in Traditional Societies, Cambridge, Engl. 1968, 311–25, und F. Furet und W. Sachs, »La croissance de l’alphabètisation en France, XVIIIe-XIXe siècle«, in: Annales, Economies, Sociétés, Civilisations 29 (1974), 714–37.
Bislang ist für das sechzehnte Jahrhundert in Frankreich noch keine Untersuchung über die Bücher im Besitz ländlicher Curés (= Landgeistliche) angestellt worden. Albert Labarre untersuchte Inventare, die nach dem Tode von 23 Curés von Landgemeinden in der Gegend von Amiens in den Jahren 1522–1561 erstellt worden waren (fünfzehn besaßen Bücher, acht hatten keine), aber er macht darauf aufmerksam, daß alle diese Männer in Amiens lebten. Auch wenn man einmal von den Geistlichen absieht, die eine Schule unterhielten, so würden wir doch erwarten, daß sie etwas mehr als nur ein Brevier, ein Missale und vielleicht ein Buch mit Heiligenlegenden besaßen. In seinen Propos rustiques von 1547 porträtierte Noel du Faïl einen ländlichen Curé aus früheren Jahrzehnten bei einem feiertäglichen Fest, bei dem er nicht laut vorlas, sondern mit Gemeindemitgliedern über den Bibeltext für diesen Tag und mit der alten Hebamme über medizinische Kräuter plauderte. Die Bildung des ländlichen Klerus war natürlich bis weit ins siebzehnte Jahrhundert hinein sehr unregelmäßig. Es kam daher häufiger vor, daß die französischen Bischöfe von den Curés den Besitz bestimmter Bücher verlangten. A. Labarre, (Paris, ), S. –. Noel du Faïl, , Hrsg. A. de la Borderie (Paris, ), S. . T.-J.Schmitt, 16501750195713233La vie religieuse dans les campagnes parisiennes, 1622–1695196218694