
Claude Cueni
Weißer Lärm
Alptraum vom Großen Bruder
FISCHER Digital
Roman

Claude Cueni, 1956 in Basel geboren, ist freischaffender Schriftsteller. 1980 erschien sein erster Roman ›Adacta‹ im Sauerländer Verlag, 1976 im Eigenverlag Quasi ›Satiren‹; im S. Fischer-Theaterverlag die Hörspiele ›Die Klon-Affäre‹, ›Ohne Preis kein Fleiß‹ und ›Das andere Land‹. 1982/83 Gastautor am Stadttheater Bern; 1982 erhielt er den Welti-Preis der Stadt Bern für das Drama ›1982‹.
Gewoben aus Horrorvisionen, aber auch aus Horrorgeschehnissen der Zeitgeschichte, ergibt die tragische Geschichte des letzten Lebensabschnittes des jungen Werbefachmannes Gustav Bender ein düsteres Bild einer vollmechanisierten und voll verwalteten Gesellschaft, in der es keinen Raum mehr gibt für das menschliche Zusammenleben.
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Impressum der Reprint Vorlage
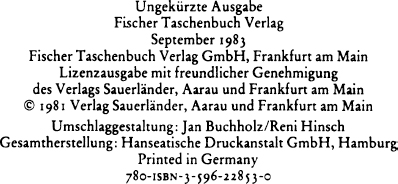
ISBN dieser E-Book-Ausgabe:978-3-10-561709-0
Als Gustav Bender am Morgen des 7. Novembers aufwachte, konnte er seinen rechten Arm nicht mehr richtig bewegen. Das Ellbogengelenk war steif, irgendwie blockiert. Als habe man ihm über Nacht warmen Sand hineingestreut. Es war ein ungewohnter Schmerz, der ausstrahlte bis in die Fingerwurzeln. Und die Schulter klebte steif am Körper. Behutsam rutschte Benders linke Hand zur rechten, über das muffige Leintuch. Er berührte das andere Gelenk, zögernd. Es war nicht geschwollen, fühlte sich auch nicht warm an. Nein, es war kalt. Leblos und hohl. Erschrocken klammerten sich die Finger um die rechte Hand. Da packte ihn der Schmerz am Nacken, wie ein Prankenhieb. Und dann war’s wieder vorbei. Bender hatte Angst. Er lag da und rang nach Atem. Das Gefühl war beklemmend. Und manchmal fühlte er einen glühenden Stich. Wie ein Peitschenhieb aus weiter Ferne. Fern, aber nah genug.
»Sara«, seufzte Bender mit trockenem Mund. Er fühlte sich elend, hatte gestern zu viel getrunken. Wie immer in sich versunken, still in seiner Ecke, ungläubig ins Leere starrend, umhüllt von einer Qualmwolke, einen Brechreiz in der Brust. Wie ein trockenes Stück Brot hatte er seine Gedanken ersäuft, sich hoffnungslos besoffen. Nicht einmal mehr für einen Smalltalk wäre er zu haben gewesen. Irgendwann hatte Bender noch einen Whisky runtergespült, einfach so, um die Brust zu wärmen. Und plötzlich hatte er geglaubt, alles zu verstehen, für kurze Zeit. Er war in die Nacht hinausgegangen, das Happy-End in der Tasche. Doch dann war alles wieder verflogen. Es war sehr kalt gewesen. Und wie ein Stacheldraht hatte sich der Suff in seine Schläfen gebohrt, bis er festsaß im Fleisch. Er hatte sein Innerstes gefühlt, wie es langsam starb, knickte und brach, mit jedem Schritt zersplitterte.
Heute morgen fühlte er sich wie an Bord eines Hochseedampfers. Die naß angelaufenen Fensterscheiben bogen sich, schmiegten sich lieblos um seine kalten Wangen, während es im Magendarmtrakt gluckste und knatterte. Bender kniff die stark geröteten Augen zusammen. Er suchte Sara. Auf dem Fenstersims. Zwischen den abgestorbenen Topfpflanzen.
Draußen war es noch Nacht. Für zwei Stunden vielleicht. Die Tannen im Hinterhof wippten lautlos. Schneekrusten hingen fest an ihren Ästen. Und zu ihren Füßen die Abfälle. Die Bierbüchsen, die man abends vom Balkon hinunterwarf. Und all das, was dazugehörte.
»Sara!« stöhnte Bender und versuchte seine Gedanken zu ordnen. Wie oft hatte er sich doch schon geschworen, mit dem Trinken aufzuhören. In all jenen Nächten. Wenn er irgendwo besoffen flachlag. Doch er schaffte es einfach nicht. Jetzt nicht mehr.
Sara sprang zu ihm aufs Bett hinauf und landete elegant im weichen Kissen. Sie strich um Benders Kopf herum. Schnurrend drückte sie ihr nasses Näslein, ihr warmes, schwarzes Köpfchen unter sein Kinn. Ihre rauhe Zunge roch nach Fisch. Sie leckte das unrasierte Kinn, knabberte liebkosend ins Fleisch. Dann legte sie sich auf Benders Brustkorb nieder und stützte sich mit einer Hinterpfote am Halswirbel ab. Bender liebte es, wenn ihr Schwanz wie ein flauschiger Scheibenwischer über sein Gesicht strich.
Bender überlegte, ob er einen Arzt aufsuchen sollte. Er fühlte sich so ausgedörrt, ausgetrocknet und unbeweglich. Ich könnte mal der Koordinationsstelle für Gesundheitsfragen … ach was, murmelte Bender verärgert. Die untersuchen lieber eine Stunde lang jeden einzelnen, um herauszufinden, ob er dreißig Sekunden vor einem Arzt stehen darf. Bender dachte an seine Schwester. Sie hatte einen Arzt geheiratet, Dr. Habicht. Aber sie hatten sich schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und einfach hingehen, weil er sie brauchte, das wollte er nicht. Bender drehte sich zur Seite und ließ die Beine aus dem Bett hängen. Vorsichtig richtete er sich auf und machte einige sanfte Lockerungsübungen. Was soll’s, dachte Bender, sollen die denken, was sie wollen. Bender hatte Angst und überlegte, ob es ihn freute, sie nötig zu haben, sie aufsuchen zu müssen, ein Alibi zu haben.
Als er in der Küche stand, fühlte er sich schon gelöster. Aber er wußte ganz genau, daß die Schmerzen weder auf eine Grippe noch auf ein offenes Fenster zurückzuführen waren. Er nahm eine Büchse Finuds-Katzenfleisch aus dem Schrank und öffnete sie, so gut es ging. Sara sprang stürmisch an Bender hoch und miaute. Bender sah das herumliegende schmutzige und teilweise sauber geleckte Geschirr, die Wäsche, die man hätte waschen sollen. Doch er konnte sich nicht aufraffen, irgend etwas in Ordnung zu bringen. Später, dachte er immer, und wenn es soweit war: Wozu denn?
Es war ein kahler Novembertag, als Bender auf die Straße hinausging. Dicke, weiße Schneeflocken fielen vom Himmel und lösten sich im grauen Pflatsch der Straßen auf. Bender zog den Kittelkragen hoch. Ihn fror. Eigentlich hätte er sich schon längst einen richtigen Mantel kaufen sollen. Im Winter war er immer schnell erkältet. Doch obwohl er als Werbetexter bei der Adler Werbeagentur AG genug verdiente, wagte er nicht, sich Dinge zu kaufen, die zum Existieren nicht dringend notwendig waren. Das war Benders Spleen. Er war von Visionen geplagt, hatte so seine Vorahnungen. Und die Vergangenheit hatte gezeigt, daß er damit so schlecht nicht gefahren war. Andererseits kannte Bender keinen Menschen, der nicht auch existentielle Ängste gehabt hätte, der nicht auch etwas für alle Fälle auf die hohe Kante legte. Sie hatten alle Angst, Beruf, Geld, Ansehen und Macht einzubüßen. Auch die, die wenig von alldem hatten. Das war so üblich. Jeder verhielt sich so, als sei er überzeugt, schon morgen Arbeit und Gesundheit zu verlieren. Jeder in diesem Staat kannte irgend jemand, dem irgend etwas zugestoßen war. Und das einfach so. Ohne daß etwas Atemberaubendes vorgefallen wäre. Hatte einer einen andern verleumdet? Vielleicht um seine Staatstreue, seine Wachsamkeit zu demonstrieren?
Man wußte es nicht, würde es nie erfahren.
Bender trat in die nächste Telefonkabine. Er steckte seine Personalkarte in den Schlitz und tippte ›Dr. Max Habicht-Bender‹ in die Tastatur. Auf dem kleinen Monitor erschien die Telefonnummer und die genaue Adresse. Bender drückte die Print-Taste und riß den Papierstreifen ab, den der Printer ausspuckte. ›Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag‹, war dann auf dem Monitor zu lesen. Bender war es unangenehm, daß seine Schwester im Zentrum wohnte. Denn bis dorthin hatte er zwei Quartiergrenzen zu passieren. Und die Identitätsüberprüfung war ihm stets unangenehm, auch wenn sie kaum eine Minute in Anspruch nahm. Plötzlich klopfte jemand an die Scheibe der Telefonzelle. Bender zuckte zusammen. Ein Mann, Mitte zwanzig, rotgeflecktes Gesicht, öffnete die Tür. Er fragte Bender, ob er nicht zufälligerweise seine Personalkarte gefunden hätte. Er habe sie irgendwo liegenlassen, vermutlich auf dem Monitor.
»Nein, nein«, stotterte Bender und begann gleich seine Taschen zu leeren. Der Unbekannte beobachtete ihn aufmerksam. Bender war sich bewußt, daß er in diesem Augenblick einen ziemlich gequälten, ja unterwürfigen Eindruck machen mußte. Doch es war ihm egal. Während er hastig und etwas umständlich die Hosentasche herauskehrte, blickte er fragend den Unbekannten an. Die roten Flecken im Gesicht glichen eingebrannten Lippenstiftküssen. Das Gesicht war starr, ohne Erbarmen. Und Bender leerte seine Taschen.
»Nichts«, sagte Bender. Der Unbekannte wollte, daß Bender noch seine linke Faust öffne. Bender öffnete sie. »Nichts«, wiederholte Bender. Der Unbekannte klopfte sich ungeduldig auf die Hüfte. Dann grinste er breit und zog eine Personalkarte aus der Hosentasche hervor. Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn und ging seinen Weg. Fassungslos starrte ihm Bender nach.
Gustav Bender klingelte dreimal kurz. Er stand vor der Glaswand eines Apartmenthauses in einem ruhigen Innenhof. Eine Stimme fragte, wer da sei.
»Bender, Gustav Bender.«
»Moment bitte. – Auf wann sind Sie denn bestellt? Ich finde nichts.«
»Ich bin nicht bestellt.«
»Tut mir leid, Dr. Habicht nimmt keine …«
»Ich bin verwandt mit Dr. Habicht. Seine Schwester ist … meine Schwester ist seine Frau.«
»Moment bitte.«
Nach einem kurzen Surren öffnete sich die Tür.
Ein jüngeres Mädchen in einer weißen Arbeitsschürze kam ihm entgegen.
»Warten Sie bitte hier.«
»Danke.« Bender setzte sich in einen orangen Finuds-Sessel und schaute dem Mädchen nach. Sie verschwand in einem Nebenraum. Bender schaute sich ein wenig um. Er war beeindruckt von der Inneneinrichtung. An der Wand hing ein modernes Gemälde: Blumen, die keine mehr waren. Und darunter saßen zwei kleine Kinder mit ihrer Mutter. Bender wußte gleich, daß die einmal beim Homsersee gewohnt hatten. Denn die Mißbildungen und Narben, die die beiden Kinder hatten, waren typisch für diese Gegend. Nase, Mund, Kiefer und ein Ohr deformiert, verstümmelt, als habe man sie mit einer Zange mutwillig verunstaltet. Dem einen fehlten noch zwei Finger. Die Umweltkrüppel nannte man sie heute. Früher trugen sie noch den Firmennamen der Verantwortlichen. Nett, dachte Bender, daß der Habicht sich ihrer annimmt. Er betrachtete die beiden Kinder aufmerksam. Bender konnte sie gut von solchen unterscheiden, die durch Medikamentenmißbrauch oder verseuchte Lebensmittel geschädigt worden waren. Es gab ja so viele unterdessen. Nicht verwunderlich, dachte Bender, daß der Habicht sich auf diesem Gebiet spezialisiert hat. So verdient er sein Geld. Der weiß, wo die Zukunft liegt!
»Tut mir leid, Herr Bender, Dr. Habicht kann Sie nicht empfangen.« Das Mädchen machte einige Schritte zur Tür, doch Bender blieb sitzen.
»Warum denn?«
»Dr. Habicht ist überlastet.«
»Dann will ich meine Schwester sehen.«
»Bitte, Herr Bender«, sagte das Mädchen und öffnete die Eingangstüre, »Sie machen mir bloß Schwierigkeiten.«
Bender blieb sitzen. Das Mädchen bat ihn nochmals zu gehen.
Nein. Bitte.
»Ich habe doch ein Recht darauf, behandelt zu werden.«
Natürlich. Na also. Aber nicht hier. Warum? Bitte. Nein.
»Sagen Sie Dr. Habicht, es sei ein Notfall, dann will ich gehen.«
Das Mädchen wollte zuerst nein sagen, doch dann ging sie den Gang entlang und betrat das hinterste Zimmer. Bender stand leise auf und folgte ihr. Er wollte wissen, ob sie wirklich zu Dr. Habicht ging. Dann hörte er Stimmen. Er glaubte, die seiner Schwester zu hören und öffnete die Tür. Vor ihm standen, sichtlich aufgeregt, Dr. Habicht und seine Schwester.
»Was willst du hier?« zischten beide im Chor.
»Dreimal dürft ihr raten.« Bender mußte leise lachen, weil er nicht verstehen konnte, warum sich die beiden so seltsam benahmen.
»Gustav, du mußt jetzt wirklich gehen«, sagte die Schwester.
»Nur keine Aufregung, meine Lieben, ich will mich doch bloß untersuchen lassen. Fünf Minuten, und ich bin wieder weg. Und bezahlen kann ich auch.«
»Darum geht es nicht«, sagte Dr. Habicht mit ernster Stimme und knabberte an seinem Stethoskop.
»Worum geht es denn?«
Die Habichts schauten sich hilflos an.
»Was willst du von uns, Gustav?« versuchte es Dr. Habicht nochmals mit fester Stimme.
»Ich will mich untersuchen lassen.«
Benders Schwester zuckte zusammen und hielt den Ärmelzipfel ihres Mannes fest.
»Du bringst uns bloß in Schwierigkeiten, Gustav.«
»Ich? Warum in Schwierigkeiten?«
Benders Schwester fixierte ihren Mann, zupfte ihn und schüttelte kaum merklich den Kopf. Dr. Habicht löste sich von seiner Frau. Mit einer theatralischen Geste legte er das Stethoskop beiseite. Dann lehnte er sich an den Holzmaßstab, der an der Wand montiert war. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Bitte, Gustav, warum versteifst du dich darauf, von mir behandelt zu werden? Geh jetzt bitte.«
»Das habe ich ja bereits aufgegeben.«
»Na also«, haspelte Benders Schwester.
»Jetzt möchte ich nur noch wissen, warum ich euch in Schwierigkeiten bringen könnte, ja?«
»Wir haben Anweisungen, keine unangemeldeten Patienten zu behandeln. Das ist der Grund.«
»Ich komme ja nicht als Patient …«
»Sondern?«
»Das allein kann doch nicht der Grund sein.«
»Aber dieser Grund sollte genügen.«
»Liegt denn etwas gegen mich vor?«
»Das mußt du schon selber wissen.« Dr. Habicht leckte sich mit der Zunge einen Speicheltropfen weg, der ihm beim Aussprechen des ›ss‹ zwischen den Zähnen hervorgespritzt war. Seine Wangenpölsterchen hüpften dabei. Bender empfand Ekel. Dr. Habicht muß das gespürt haben, denn erst jetzt fuhr er fort: »Du mußt selber wissen, was du getan hast, Gustav. Du wolltest es ja immer besser wissen. Ein Dichterleben führen und nichts arbeiten. Die Zeiten haben sich geändert, und du hast den falschen Dampfer gewählt.« »Hör doch auf, Max«, flehte Benders Schwester, »du meinst es ja gar nicht so.«
»Wie meint er es denn?« fragte Bender seine Schwester.
»Was weiß ich denn«, schrie sie laut auf, so daß sich die Stimme überschlug. Sie schnappte nach Luft, schwieg und begann leise zu heulen.
»Zufrieden Gustav?«
»Wir sehen uns noch, Max.«
»Was soll das heißen?« Dr. Habicht berührte seine Frau mit dem Zeigefinger an der Schulter und stieß sie sanft von sich. Sie hielt sich mit beiden Händen den Mund zu und eilte ins Nebenzimmer.
»Du weißt genau, daß ich nicht zu einem anderen Arzt gehen kann. Der gibt dem Arbeitgeber einen Rapport, und der entläßt mich, wenn er auch nur das kleinste Anzeichen für eine Verminderung meiner Arbeitskraft …«
»Wir Ärzte haben schließlich eine Schweigepflicht.«
»Den Patienten gegenüber, sicher.«
»Mit solchen Sprüchen kommst du im Leben nicht weit, Gustav, du wirst dich nie ändern.«
»Du hingegen schon, Max,« Bender wollte die Türe öffnen, doch der Arm streikte und erreichte die Türfalle nur noch mit den Fingerkuppen. Kraftlos ließ er ihn sinken.
Bender fühlte, wie Schweißtropfen seine Stirn befeuchteten.
»Du mußt uns verstehen, Gustav, die Welt hat sich verändert, wir haben uns eine schöne Existenz aufgebaut, wir können das nicht alles aufs Spiel setzen, nur … ich meine, soll ich dir Geld geben? Du hast zwar sicher genug davon, ich habe nie an deinen Fähigkeiten gezweifelt. Wir leben jetzt einfach in zwei ganz verschiedenen Welten.« Und plötzlich fügte Dr. Habicht mit unterdrückter Wut bei: »Und das soll auch so bleiben. Geh jetzt endlich. Du hast schon genug Unheil angerichtet.«
Das junge Mädchen begleitete Bender wortlos in den Innenhof. Bender fror, als er wieder draußen an der frischen Luft war. Sein Hemd klebte am Rücken fest. Bender bereute, die beiden aufgesucht zu haben. Das hätte ich mir ja denken können. Er fragte sich, ob er die Abweisung gesucht habe oder nicht. Doch gleich fand er es lächerlich, sich darüber noch Gedanken zu machen.
Gustav Bender war neunundzwanzig. Er arbeitete seit drei Jahren als Werbetexter bei der Adler Werbeagentur AG. Eigentlich hätte er viel lieber Geschichten geschrieben. Doch die elektronischen Wohnzimmersysteme hatten das Buch vom Markt verdrängt, und die Drehbuch-Aufträge waren fest in den Händen einzelner Autorenfabriken. Natürlich hätte Bender auch einfach so für sich schreiben können, als Therapie, warum auch nicht. Aber dann all die Blätter zu Hause. Das wären Beweise, Geständnisse gewesen, wo man doch keinen Auftrag hätte vorweisen können.
Gustav Bender setzte sich in sein kleines Büro im siebten Stockwerk des Agenturgebäudes. Vom Fenster aus konnte er die Leute beobachten, die die gegenüberliegende Single-Bar betraten. Bender holte sich eine Flasche Finuds-Bier aus der Kühltruhe im Korridor. Die Tür zu Poppens Büro war offen. Lucien Poppen war auch Texter, ungefähr 44. Jetzt lag er zusammengerollt unter seinem Tisch und schnarchte leise. Bender nahm sich einen Stapel Videobänder mit prämierten Werbefilmen und kehrte in sein Büro zurück. Er zündete sich eine Zigarette an und überflog die Pendenzenliste. Da gab’s ein neues Konzept für das Finuds-Katzenfleisch zu entwikkeln, eine Weihnachtsrede für den Bischof zu schreiben, einen Inseratentext für einen Winterpneu und einige Spots für das erste Psychopharmakon, das weder Nieren noch Leber angriff, mit Alkohol genossen werden konnte und in jedem U-Shop erhältlich war.
Um 14.00 Uhr war Kreationssitzung. Adler war persönlich anwesend. Während über Video ein Fistfuckingfilm vom Museum of Modern Art lief und der Whisky die Runde machte, wurden die neueingetroffenen Aufgaben verteilt. Der eine zeigte dem andern seine neusten Schuhe, erzählte von seiner letzten Eroberung und kritisierte seinen Analytiker, und ein anderer rezitierte aus dem Tagebuch seines Penis. Bender war froh, als das ganze Geschwätz endlich zu Ende war. Er fuhr mit dem Lift ins Untergeschoß. Dort waren seine 143 Papageien, die ihn lautstark begrüßten. Bender hatte vor einigen Monaten den Vorschlag gemacht, für einen Finuds-Werbefilm Papageien zu dressieren. Der Papagei sollte das Finuds-Maskottchen für alle Fleischprodukte aus dem Tierfuttersektor werden. Der Name für die neue Büchsenserie war »Miki«. Und so hatte Bender seinen Papageien die Aussprache von »Miki« beizubringen. Es war vorgesehen, die dressierten Papageien nach Abschluß der Dreharbeiten in den größten U-Shop-Automatenanlagen der Finuds-Kette zu integrieren. Und zwar in eigens dafür entworfenen Werbekäfigen, zwischen Katzen-, Hunde- und Vogelfutter. Und jeder Passant müßte das Miki-Gekrächze mitanhören. Bender setzte sich auf seinen Barhocker und beobachtete seine Vögel. Einige hatten sich über Nacht wieder zu Tode gehackt, doch Hugo, der bereits zusammenhängende Sätze sprechen konnte, hatte überlebt, und immerhin glaubte Bender aus dem chaotischen Gekreische das Wort »Miki« herauszuhören. Er hatte nicht mehr viel Zeit für seine Unterrichtsstunden. In den nächsten Wochen begannen bereits die Dreharbeiten. Plastik würde es doch auch tun, dachte Bender, warum müssen es echte Viecher sein? Bender schrie »Miki«, die Papageien flogen immer wilder, neckten sich gegenseitig, ließen im Sturzflug den Kot fallen und verschonten dabei auch nicht ihren Lehrmeister.
Gegen 17.00 Uhr verließ Bender die Agentur. Er strich durch die nächstliegenden Straßen, um keine Quartierkontrolle passieren zu müssen, und kehrte schließlich in einer Single-Bar der Finuds-Kette ein. Und jetzt, als er an der Bar saß, fühlte er sich fehl am Platz und wollte wieder gehen. Lustlos hockten die Gäste herum, gafften sich an, niedergeschlagen bis halb betäubt, traurig ernüchtert bis ganz versoffen. Und jeder von ihnen trug ein paar Ansteckknöpfe mit den unsinnigsten Bekenntnissen. Eine etwa dreißigjährige Frau setzte sich neben Bender und bot ihm ein Psychopharmakon an. Bender winkte ab und zündete sich eine Zigarette an. Er bestellte ein Bier und einen Cheeseburger.
»Cheeseburger sind doch krebserregend«, sprach die Frau wie in Trance und lächelte Bender zu. »Hast du das nicht gewußt?«
Bender grinste: »Ich weiß, I. Lektion von ›Dich werd ich haben‹, eine ganz schön beliebte Sendung.«
Die Frau winkte ab: »Wollen wir mal, ich wohn da drüben.« Ihre Stimme wirkte einschläfernd.
»Hab schon zu viel getrunken«, log Bender, um sie nicht zu kränken. »Schluck doch ein oder zwei ›Steh-Auf‹, dann klappt das schon.«
Bender biß kräftig in seinen Hamburger hinein.
»Bist du kein Single?« fragte die Frau mißtrauisch.
Bender trank ein wenig Bier, um zu spülen: »Bin lieber allein als ein Single.«
Die Frau nahm einen Kugelschreiber hervor und fragte, ohne dabei den Mund richtig zu öffnen: »Welcher Kanal?«
»Ist von mir«, entgegnete Bender und biß erneut in seinen Hamburger hinein.
»Angeber, komm schon. Eine Kassette vom Video-Club?«
»Nein, ist mir wirklich selber eingefallen, soll ja mal vorkommen. Ist doch nichts Besonderes.«
»Stimmt eigentlich, so gut ist der auch wieder nicht. Hast du eigentlich Kummer?«
»Jetzt hast du aber eine Lektion übersprungen.«
»Du mußt aber trotzdem darüber reden. Man muß seinen Kummer verbari … verbali … verbalisieren. Sagt unser Analytiker. Kennst du den da drüben?«
»Nein.«
»Ich versuch’s mal mit dem, ist ja dein Bier, wenn du so leben willst.«
»Stimmt«, murmelte Bender und trank sein Bier.
Bender beobachtete, wie sich die rothaarige Frau dem Jungen näherte. Die beiden tauschten einige Worte und verließen dann die Bar. Bender warf dem Kellner seine Personalkarte zu, wartete ungeduldig auf die Rückgabe und kehrte dann in die Agentur zurück. Dort wurde heute abend gefeiert. Freedom, die filterlose Zigarette, die die Adler Werbeagentur AG betreute, hatte nämlich einen Marktanteil von 68,9 Prozent erreicht. Das war, wenn man den Marktuntersuchungen glauben durfte, eine Verbesserung um 4,8 Prozent. Im Clubroom war ein kaltes Buffet aufgestellt worden. Der Clubroom lag im ersten Untergeschoß, wo auch der Papageienkäfig und der Swimmingpool waren. Tische wurden hinuntergetragen, Kisten mit Bier, Wein und natürlich Whisky. Und nochmals Whisky. Die Tische wurden dann schön garniert, vollgepflastert mit Kuchen, Fleisch- und Gemüseplatten und allerlei Delikatessen. Die meisten aus der Kreation waren bereits betrunken, einige schwammen im Becken, andere stritten sich und wieder andere waren bereits enttäuscht nach Hause gefahren. Zwei Warentaxis brachten gegen halb elf einige Prostituierte, die sich sofort auf das kalte Buffet stürzten. Im Vorführraum lag Adler, nackt. Einsam döste er vor sich hin, während über Video sein neuster Snuff-Porno lief. Neben ihm lag sein Developer, zersplittert, so ein Glaszylinder, dem man mit einem Gebläseball die Luft abziehen konnte. Durch den Unterdruck wurde das Glied darin wieder steif. Das waren quasi Adlers dritte Zähne. Neben ihm kauerte eine Prostituierte und trank Champagner. Die anderen Frauen waren am Service.
Es war bereits viertel nach zwei, als Bender zwischen zwei Sofas wieder zu sich kam. Wie aus einer tiefen Ohnmacht. Er lag im Vorführraum und hatte keine Ahnung, wie er dahin gekommen war. Neben ihm dösten zwei weibliche Alkoholleichen. Bender stand auf und griff nach einem Stück Beinschinken, das herumlag. Ein schmerzhafter Stich im Ellenbogengelenk stoppte die Bewegung. Nervös stand Bender auf und schlenderte zum Schwimmbecken hinüber. Dort jagten gerade Bernie und Poppen eine Prostituierte. Sie rettete sich ins Wasser. Die beiden sprangen ihr nach, spielten Unterseeboot, hechteten wieder an die Oberfläche, brüllten irgend etwas, das nach Miki tönte, tauchten wieder unter. Poppen erbrach und mußte von Bernie zur Eisentreppe gezogen werden. Bender hatte genug. Er wollte nach Hause. Im Vorführraum war ein Telefon. Poppen bat Bender, auch ihm ein Taxi zu bestellen. Wenig später standen sie beide am Straßenrand und rauchten. Es war eine kalte Nacht, von undurchdringlichem Nebel und nieselnder Nässe erfüllt. Eine bitterkalte Nacht. Und hoch oben saß der Mond, ein wenig blaß, wie ein eitriger Embryo.
»Traurig?« grinste Bender, »hast du etwa heute dein Soll nicht erfüllt?« Poppen schwieg. »Vergiß es«, sagte Bender mit schwerer Zunge, »es ist doch immer dasselbe.«
»Ich habe Scheiße gebaut«, murmelte Poppen und schien den Tränen nahe.
»Du zitterst ja wie ein Barmixer«, lachte Bender.
»Du warst auch dabei, du kannst dich nicht drücken.«
Poppen hielt Bender am Kragen fest und zog ihn zu sich heran.
»Du hast es auch gesehen. ›VS-vertraulich, nur für den Dienstgebrauch‹ stand darauf.«
»Wovon sprichst du denn?« fragte Bender leise.
»Stimmt«, flüsterte Poppen, »wir sind zwar besoffen, aber …«
»Was ist denn los?« fragte Bender aufgeregt.
»Nicht so laut«, zischte Poppen und versuchte sich an Benders Kragen auf den Beinen zu halten.
»Wir wollten dem Adler belegte Brötchen in den Tresor werfen, das war deine Idee. Ich wollte hineinpissen. Adler lag hinter dem Sofa. Ich habe den Schlüssel geholt … und wir haben ihn geöffnet.«
»Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern.«
»Nicht so laut. Auf dem Manuskript stand Blaue Zone. Erinnerst du dich denn nicht?«
Bender schüttelte den Kopf: »Ich schwöre es!«
»Verstehe doch endlich, das war explosives Material. Da waren … das waren Sachen …über diese Blaue Zone … verstehe doch endlich … wir müssen verschwinden … abhauen … wir haben’s doch nicht gewollt.« Poppen zog Bender näher zu sich heran. Er vergrub seinen Kopf in Benders Jacke und lallte zusammenhangslose Wortfetzen.
»Ich verstehe kein Wort«, flüsterte Bender.
»Du kommst nicht … du hast es auch gesehen.«
Bender hoffte, Poppen würde plötzlich zu lachen anfangen. Doch Poppen schien die Sache ernst zu sein. Er lachte nicht. Er hatte Angst. Bender packte ihn an den Oberarmen und stieß ihn von sich. »Was ist denn los mit dir?«
»Das war doch nur Zufall«, jammerte Poppen, »ich hab’s wirklich nicht gewollt. Ich hab’s nicht sehen wollen!«
»Was war denn das für ein Manuskript?« Doch sogleich bereute Bender, diese Frage gestellt zu haben. Er wollte nichts davon erfahren.
»Von der Grünen Zone habe ich schon gehört … aber … das kann nicht sein … verstehst du, Bender, die sind verrückt, die sind alle verrückt.«
»Das Taxi«, unterbrach ihn Bender.