

Autoren
RACHEL COHN und DAVID LEVITHAN sind beide renommierte Jugendbuchautoren und seit Langem miteinander befreundet. Sie lebt in New York City, er auf der anderen Seite des Hudson River in Hoboken/New Jersey. Ihre Bestseller-Reihe »Dash & Lily« wird als Netflix-Serie verfilmt.
Von den Autoren sind außerdem bei cbt erschienen:
Dash & Lily – Ein Winterwunder
Naomi & Ely – Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen
Nick & Norah – Soundtrack einer Nacht
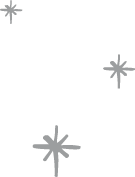
eins
DASH
Twelve Days of Christmas – und eine Birne in einem Wachtelbaum!
Samstag, der 13. Dezember
Ich bin mit Lily jetzt schon fast ein Jahr zusammen und egal, was ich gemacht habe oder wie sehr ich mich angestrengt habe, ich konnte ihren Bruder nicht dazu bringen, dass er mich mochte, mir vertraute oder ihm vielleicht auch nur im Entferntesten der Gedanke kam, dass ich irgendwie gut genug für seine Schwester sein könnte. Deshalb war es ein echter Schock für mich, als er mir mitteilte, dass er mich gern zum Mittagessen treffen wollte, nur wir beide.
Sicher, dass du dich nicht in der Adresse getäuscht hast?, habe ich ihm zurückgeschrieben.
Stell dich nicht so an. Komm einfach, lautete seine Antwort.
Das Unheimliche an der Sache war, auch wenn ich versuchte, es vor mir selbst zu verleugnen: Ich wusste, warum er mich treffen und worüber er mit mir reden wollte.
Mit seiner Meinung über mich hatte er natürlich nicht recht. Aber er hatte recht damit, dass es ein Problem gab.
Es war ein hartes Jahr gewesen.
Nicht am Anfang. Das nicht. Der Anfang war so gewesen, dass ich fast in so banausenhafte und banale Ausrufe wie großartig! und super! ausgebrochen wäre. Denn Weihnachten und das neue Jahr hatten für mich damals etwas anderes als die übliche Konsumrausch- und Post-Konsumrausch-Depression mit sich gebracht. Es war mir Lily geschenkt worden. Die strahlende, an das Gute glaubende Lily. Und das reichte, um ganz vieles zu verändern. Sie bewirkte, dass ich wieder große runde Augen bekam und an einen gutmütigen, dicken Mann mit Rauschebart in einem roten Gewand glaubte, der auf einem Turboschlitten dahersauste. Sie bewirkte, dass ich seit Langem wieder jubilierte und frohlockte, als das gute alte Väterchen Frost einem Neugeborenen die Schlüssel zu seinem Gefährt überreichte: Hier, jetzt bist du dran, mach weiter. Sie bewirkte, dass ich meinen eigenen Zynismus plötzlich eher zynisch betrachtete. Das neue Jahr fing für uns damit an, dass wir im Raum für wertvolle antiquarische Bücher in unserer Lieblingsbuchhandlung Strand miteinander rumknutschten. Mir schien das ein gutes Vorzeichen zu sein. Es würden sich in diesem Jahr noch viele gute Dinge ereignen.
Und so war es auch. Jedenfalls eine Zeit lang.
Sie hat meine Freunde kennengelernt. Es funktionierte erstaunlich gut.
Ich habe zahlreiche Mitglieder ihrer allem Anschein nach unendlich großen Familie kennengelernt. Es funktionierte so halbwegs.
Sie hat meine Eltern und Stiefeltern kennengelernt. Die waren alle sehr erstaunt, dass es ihr düsterer Novembernebel von Sohn fertiggebracht hatte, einen solchen Sonnenschein einzufangen. Aber sie beschwerten sich nicht darüber. Es erfüllte sie sogar mit etwas Ehrfurcht. In einem Maß, wie dies bei New Yorkern sonst allenfalls bei einem perfekten Bagel der Fall ist oder bei einer Taxifahrt über fünfzig Kreuzungen ohne eine einzige rote Ampel. Oder wie sie sie dem Einen-von-fünf-Woody-Allen-Filmen entgegenbringen, der alle wieder entzückt.
Ich habe Lilys heißgeliebten Grandpa kennengelernt. Er mochte meinen Händedruck und sagte, das sei alles, was er von mir zu wissen brauchte, um die Wahl seiner Enkelin zu befürworten. Wir fanden auch noch mehr, was uns verband, denn er war ein Mann, dessen Augen funkelten, wenn er von einem Baseballmatch erzählte, das vor über fünfzig Jahren stattgefunden hatte.
Bei Langston, Lilys Bruder, gestaltete sich meine Überzeugungsarbeit schwieriger. Im Prinzip hat er uns in Ruhe gelassen. Was mich nicht störte. Ich war ja nicht mit Lily zusammen, um mit ihrem Bruder zusammen zu sein. Ich war mit Lily zusammen, um mit Lily zusammen zu sein.
Und ich war mit Lily zusammen. Wir gingen nicht in dieselbe Schule und wohnten auch nicht im selben Viertel, deshalb machten wir Manhattan zu unserer Spielwiese, tollten durch die frosterstarrten Parks, fanden Zuflucht in Think-Coffee-Cafés und vor sämtlichen Kinoleinwänden des IFC Center. Ich zeigte ihr meine Lieblingswinkel in der New York Public Library. Sie zeigte mir, welche süßen Verführungen aus der Levain Bakery sie am meisten liebte … und zwar eigentlich alle.
Manhattan hatte gegen unsere Streifzüge nicht das Geringste einzuwenden.
Aus Januar wurde Februar. Die Kälte begann tief in die Gebeine der Stadt einzusickern. Es wurde schwerer, ein Lächeln geschenkt zu bekommen. Der Schnee, dessen Flocken beim Herabfallen vom Himmel zuerst so verzückten, war immer weniger und weniger willkommen, wenn er dann auch liegen blieb. Wir wanderten dick eingemümmelt umher, unfähig irgendetwas direkt zu fühlen.
Aber Lily … Lily störte das alles nicht. Lily begeisterte sich für Wollfäustlinge und heißen Kakao und Schneeengel, die sich vom Boden erhoben und in der Luft tanzten. Sie sagte, dass sie den Winter liebte, und ich fragte mich irgendwann, ob es überhaupt eine Jahreszeit gab, die sie nicht liebte. Für mich bedeutete es ein hartes Stück Arbeit, ihre Begeisterung zu teilen. Zu begreifen, dass ihr Enthusiasmus aufrichtig und ehrlich war. Mein mentaler Heizkessel war eher auf Selbstverbrennung als auf Wärme angelegt. Ich verstand nicht, wie sie so glücklich sein konnte. Aber meine Verliebtheit war so groß, dass ich beschloss, das alles nicht infrage zu stellen, mich in sie einzuhüllen und in ihr zu leben.
Aber dann.
Zwei Tage vor Lilys Geburtstag, der im Mai ist, war ich schon drauf und dran, meinen besten Freund Boomer um Hilfe zu bitten, weil ich Lily nämlich einen roten Pullover stricken wollte. Und egal, wie viele YouTube-Videos ich mir anschaute, es wurde mir leider bald sonnenklar, dass man einen roten Pulli eigentlich nicht an einem einzigen Nachmittag stricken kann. Mein Handy klingelte und ich hörte es nicht. Dann klingelte das Handy wieder, aber meine Hände waren zu beschäftigt. Erst zwei Stunden danach entdeckte ich, wie viele Nachrichten auf meiner Mailbox eingegangen waren.
Als ich sie abhörte, erfuhr ich, dass ihr geliebter Grandpa einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur einen leichten. Aber dummerweise mit einem besonders schlechten Timing, denn er wurde davon erwischt, als er gerade die Treppe zu ihrer Wohnung hochging. Er stürzte die Treppe hinunter und lag mindestens eine halbe Stunde auf dem Treppenabsatz, halb bewusstlos, bis Lily nach Hause kam und ihn dort fand. Der Krankenwagen brauchte eine gefühlte Ewigkeit. Lily war bei ihm, als ihr Grandpa einen Herzstillstand hatte. Lily war bei ihm, als die Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Rettungssanitäter erfolgten. Lily wartete im Krankenhaus, nicht mehr länger bei ihm, als ihr Grandpa zwischen Leben und Tod schwebte. Bis er es schließlich so grade noch mal zurück auf die Seite des Lebens schaffte.
Ihre Eltern waren im Ausland. Langston hatte eine Vorlesung und es war dort strengstens verboten, aufs Handy zu schauen. Und ich war so beschäftigt damit, ihre Geburtstagsüberraschung zu stricken, dass ich nicht aufs Handy blickte. Lily saß allein im Wartezimmer des New York Presbyterian Hospital und war auf einmal dabei, etwas zu verlieren, wovon sie bisher nicht einmal ansatzweise in Betracht gezogen hatte, dass sie es eines Tages verlieren würde.
Ihr Grandpa lebte. Aber es dauerte lange, bis er wieder der Alte war. Er lebte. Aber die Schritte zurück in die Normalität waren schmerzhaft. Er lebte, weil Lily ihm dabei half, wieder zu leben, und diese Hilfe verlangte ihr sehr viel ab. Sein Tod wäre ein unerträglicher Schmerz gewesen, aber ihn ständig leiden zu sehen, seine ständigen Frustrationen mitzuerleben, war fast genauso schlimm.
Lilys Eltern kehrten zurück. Langston bot an, sich für eine Weile vom College befreien zu lassen. Ich versuchte, so viel wie möglich für sie da zu sein. Aber das hier war ihre Sache. Ihr Grandpa fiel in ihre Verantwortung. So wollte sie es und es durfte nicht anders sein. Und er selbst hatte gar nicht die Kraft, ihr das womöglich auszureden. Ich konnte ihm da auch gar keine Vorwürfe machen – von allen Menschen, die ich kenne, würde ich auch am liebsten mit Lilys Hilfe wieder das Gehen erlernen. Ich würde am liebsten von ihr wieder ins Leben zurückgeführt werden. Selbst wenn das Leben nicht mehr denselben Glanz hätte wie früher. Für Lily schien es sich jedenfalls so anzufühlen. Das Leben hatte nicht mehr denselben Glanz.
Wer immer voller Glauben und Zuversicht war, den trifft es am härtesten, wenn irgendwann ein Unglück hereinbricht. Die Verletzlichkeit ist dann so groß. Lily wollte nicht darüber reden und ich fand nicht die richtigen Worte, um ihr zu einer anderen Sicht auf die Dinge zu verhelfen. Sie wollte, dass ich für sie die Gegenwelt war, ihr Fluchtort, so hat sie es jedenfalls gesagt, und das hat mir geschmeichelt. Ich habe sie unterstützt, wie ich konnte. Aber es war die passive Stütze eines Stuhls oder Pfeilers, nicht die aktive Unterstützung durch einen Menschen, der einem anderen Menschen dabei hilft, seinen eigenen Weg zu gehen. Während ihr Großvater immer wieder ins Krankenhaus musste, weil immer noch eine Operation folgte oder weil auf eine der Operationen Komplikationen folgten, während er immer wieder in physiotherapeutische Behandlung musste, verbrachten Lily und ich immer weniger Zeit miteinander. Wir wanderten nicht mehr so oft gemeinsam durch die Stadt, wir spazierten nicht mehr so selbstverständlich durch die Gedanken des anderen. Die Prüfungszeit war im Nu vorüber – dann kam der Sommer. Lily meldete sich zu Freiwilligenarbeit in der Reha-Tagesklinik, in die ihr Grandpa musste, einfach um mehr Zeit mit ihm verbringen zu können und um sich um andere Menschen zu kümmern, die genauso dringend Hilfe brauchten wie er. Ich hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen, weil ich in derselben Zeit so eine Art Urlaubspendeln zwischen meinen Eltern machte. Mit meiner Mutter war ich in Montreal, was mein Vater natürlich übertrumpfen musste, indem er mich zu einem missglückten Kurztrip nach Paris mitnahm. Ich hätte ihn am liebsten angebrüllt, was ich denn mit ihm in Paris sollte. Dann wurde mir klar, wie unglaublich verzogen sich das angehört hätte. Meinen Vater anzubrüllen, weil er mich zu einer Reise nach Paris einlud. Paris konnte ja nichts dafür. Ich wollte nur einfach nicht mit ihm verreisen und wollte lieber bei Lily bleiben.
Mit dem neuen Schuljahr wurde es etwas besser. Lilys Grandpa war wieder halbwegs auf den Beinen und scheuchte sie zu ihrem eigenen Besten von sich fort. Eigentlich hätte sie da erleichtert sein müssen. Sie tat auch so, als wäre sie erleichtert, aber ich spürte ganz genau, dass sie tief in ihrem Innern weiter verunsichert und ängstlich war. Doch statt mich zu fragen, was eigentlich mit ihr und mit uns los war, habe ich es einfach hingenommen und geglaubt, wenn wir so tun würden, als wäre alles gut, dann käme irgendwann der Moment, wo dieser Zustand sich von einer halben Lüge zu einer mehr als nur halben Wahrheit entwickeln würde – und irgendwann wäre es dann ganz wahr.
Daran zu glauben, alles sei wieder ganz normal, war leicht. Die Schule hielt uns ganz schön auf Trab. Unsere Freunde auch. Wir erlebten viele schöne Momente miteinander, spazierten durch die Stadt und vergaßen gleichzeitig, wo wir waren. Es gab Orte in Lily, zu denen mir der Zugang verwehrt blieb. Aber es gab auch vieles, das sie mir von sich zeigte. Orte in ihr, die ich mit ihr bewohnen durfte. Ihr Lachen, weil Hundebesitzer manchmal genauso wie die Hunde aussehen. Ihre Tränen, wenn in der TV-Serie Restaurant: Impossible ein Lokal und seine Besitzer gerettet wurden. Und in ihrem Zimmer hatte sie immer eine Tüte mit veganen Marshmallows, nur weil ich ihr einmal gesagt hatte, wie gern ich die mochte.
Erst als Weihnachten näher rückte, wurden die Risse sichtbar.
Früher sorgte die Weihnachtszeit regelmäßig dafür, dass mein Herz auf die Größe und nichtssagende Leere eines Geschenkgutscheins zusammenschrumpfte. Ich hasste es, wie die Touristen die Straßen verstopften und wie der normale Rhythmus der Stadt von einem sentimentalen Glöckchengeklingel übertönt wurde. Die meisten Menschen zählten die Tage bis Weihnachten, weil sie noch ihre Weihnachtseinkäufe über die Bühne bringen mussten. Ich zählte sie, weil ich Weihnachten selbst so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte. Damit der trostlose richtige Winter beginnen konnte.
In meinem Zinnsoldatenherz war kein Platz für Lily vorgesehen gewesen. Sie hatte es trotzdem im Sturm erobert. Und mit ihr öffnete es sich auch für Weihnachten.
Versteht mich bitte nicht falsch, es kommt mir immer noch verlogen vor, am Ende des Jahres mit Lippenbekenntnissen zu allgemein größerer Menschlichkeit und zu Edelmut aufzuwarten, nur um wieder in dieselbe Mitmenschlichkeits-Amnesie wie sonst auch immer zu verfallen, sobald sich das Blatt gewendet hat und das neue Jahr beginnt. Wenn Lily diese Weihnachtsbegeisterung gut stand, dann deshalb, weil sie das ganze Jahr über offenherzig und freundlich und gut zu den Menschen um sie herum war. Und seit ich sie kannte, entdeckte ich diese Eigenschaften auf einmal auch bei anderen – während ich jetzt im Le Pain Quotidien auf Langston wartete, zum Beispiel, in der Art und Weise, wie manche Pärchen sich da anschauten, mit so einer immerwährenden Glückseligkeit. Und auch die meisten Eltern (selbst in ihren verzweifelten Momenten) schauen ihre Kinder so an. Ich entdeckte jetzt überall Stücke von Lily. Nur in Lily selbst entdeckte ich sie in letzter Zeit immer weniger.
Da schien ich aber nicht der Einzige zu sein, denn kaum hatte sich Langston hingesetzt, sagte er: »Okay, ich kann mir wahrlich was Schöneres vorstellen, als jetzt hier mit dir das Brot zu brechen, aber wir müssen etwas unternehmen, und zwar sofort.«
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Heute mitgezählt sind es nur noch zwölf Tage bis Weihnachten, richtig?«
Ich zählte nach und nickte. Ja, wir hatten den 13. Dezember.
»Na ja, wenn dem so ist und es nur noch zwölf Tage bis Weihnachten sind, dann haben wir jetzt in unserer Wohnung ein großes gähnendes Loch. Und weißt du, warum?«
»Termiten?«
»Ach, halt die Klappe. Der Grund, weshalb in unserer Wohnung ein großes Loch klafft, ist: Wir haben keinen Weihnachtsbaum. Lily kann es normalerweise kaum erwarten, bis die Überbleibsel von Thanksgiving weggeräumt sind, und läuft dann gleich los, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Sie ist davon überzeugt, dass die guten Bäume hier alle ganz früh weggehen, und je länger man wartet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Baum zu bekommen, der weihnachtsunwürdig ist. Deshalb ist der Baum bei uns meistens schon vor dem 1. Dezember aufgestellt und Lily verbringt dann die nächsten zwei Wochen damit, ihn zu schmücken. Am 14. Dezember feiert unsere Familie dann das große Kerzenanzünden am Weihnachtsbaum. Lily tut immer so, als wäre das eine uralte Familientradition. Aber in Wirklichkeit hat sie sie erfunden, als sie sieben war, und jetzt fühlt es sich für uns alle nur so an, als wäre es eine uralte Familientradition. Bloß in diesem Jahr – auf einmal nichts. Kein Baum. Alle Christbaumkugeln sind noch in ihren Schachteln verstaut. Dabei soll morgen die Lichterfeier stattfinden. Mrs Basil E. hat dafür schon das Catering bestellt – und ich habe keine Ahnung, wie ich ihr beibringen soll, dass es diesmal gar keinen Baum gibt, an dem die Kerzen angezündet werden können.«
Ich konnte seine Ängste verstehen. In dem Augenblick, in dem Langstons und Lilys Großtante – von uns allen Mrs Basil E. genannt – durch die Tür in die Wohnung trat, würde sie sofort riechen, dass es da keinen Baum gab – und würde ihren Unmut über diesen Traditionsbruch keineswegs verbergen.
»Und warum besorgt ihr dann nicht einfach einen Baum?«, fragte ich.
Langston schlug sich verzweifelt an die Stirn, weil ich so schwer von Begriff war. »Weil das Lilys Job ist! Das gehört zu den Dingen, die sie unglaublich gern macht! Und wenn wir ihn ohne sie kaufen, dann ist das so, als würden wir sie mit der Nase darauf stoßen, dass sie es nicht getan hat, und das würde alles nur noch schlimmer machen.«
»Wie wahr, wie wahr«, sagte ich.
Eine Bedienung kam an unseren Tisch und wir bestellten beide ein Pain au chocolat – wohl weil wir beide wussten, dass uns für ein richtiges Mittagessen der Gesprächsstoff fehlte.
Als die Bedienung fort war, fuhr ich fort: »Hast du sie denn deswegen gefragt? Also, ich meine, wegen dem Baum?«
»Ich hab’s versucht«, antwortete Langston. »Ganz direkt. ›Hey, sag mal, warum ziehen wir nicht los und kaufen einen Baum?‹ Und weißt du, was sie darauf geantwortet hat? ›Mir ist im Moment nicht danach.‹«
»Das klingt ganz und gar nicht nach Lily.«
»Genau! Deshalb hab ich dir ja auch die Mail geschickt. Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Maßnahmen.«
»Aber wie kann ich euch da helfen?«
»Hat sie denn mit dir überhaupt darüber geredet?«
Selbst im Zustand unserer gegenwärtigen beiderseitigen Gesprächsbereitschaft wollte ich nicht, dass Langston die ganze Wahrheit erfuhr – dass Lily und ich in den Wochen seit Thanksgiving nicht besonders viel miteinander geredet hatten. Ab und zu waren wir zusammen ins Museum oder irgendwohin was Kleines essen gegangen. Ab und zu hatten wir uns geküsst oder miteinander rumgeknutscht – doch nichts, das auf CBS irgendjemanden vom Hocker werfen würde. Ja, wir waren immer noch zusammen. Aber es fühlte sich nicht so an, wie es sich anfühlen sollte.
Das erzählte ich Langston allerdings nicht, denn es war mir peinlich, dass ich es zwischen Lily und mir so weit hatte kommen lassen. Und ich erzählte es Langston auch deshalb nicht, weil ich Angst hatte, dass es ihn alarmieren würde. Dabei hätten meine eigenen Alarmglocken schon lange läuten müssen.
Statt das Thema anzuschneiden, sagte ich deshalb nur: »Nein, wir haben nicht über den Baum geredet.«
»Und sie hat dich auch nicht zur Lichterzeremonie eingeladen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Davon höre ich jetzt das erste Mal.«
»Dacht ich’s mir doch. Ich glaub, die Einzigen, die kommen werden, sind die Mitglieder unserer Sippe, die jedes Jahr kommen. Normalerweise verteilt Lily an alle möglichen Leute Einladungen. Aber vermutlich war ihr danach dieses Jahr auch nicht.«
»Klarer Fall. Wir müssen etwas tun.«
»Ja, aber was? Für mich ist es wirklich so, als würde ich einen Verrat begehen, wenn ich jetzt losziehen und einen Baum kaufen würde.«
Ich dachte einen Moment nach, dann fiel mir etwas ein. »Könnte sein, dass ich ein Schlupfloch weiß«, sagte ich.
Langston neigte den Kopf und schaute mich an. »Ich höre.«
»Was, wenn ich ihr den Baum besorge? Als Überraschung. Ein Teil meines Weihnachtsgeschenks. Sie hat keine Ahnung, dass ich über eure Familientradition Bescheid weiß. Ich kann einfach bluffen und damit bei euch reinplatzen.«
Langston wollte nicht, dass die Idee ihm gefiel. Weil das bedeutet hätte, mich zu mögen, und sei es auch nur eine Sekunde. Aber wie um seine Skepsis zu widerlegen, leuchteten seine Augen eine Sekunde auf.
»Wir könnten ihr erzählen, dass du ihn ihr zum zwölften Tag vor Weihnachten schenken willst«, sagte er. »Sozusagen als Kick-off der ganzen Weihnachtsfeiern.«
»Aber kommen die zwölf Tage oder genauer die zwölf Nächte nicht nach Weihnachten?«
Langston bürstete den Einwand weg. »Technische Details.«
Ich war mir nicht sicher, dass das so simpel sein würde. Aber einen Versuch war das mit den zwölf Tagen wert.
»Okay«, sagte ich. »Ich werde den Baum mitbringen. Du tust so, als wärst du überrascht. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Richtig?«
»Richtig.« Unsere Pains au chocolat kamen und wir bissen hinein. Ungefähr siebzig Sekunden später waren wir damit fertig. Langston griff nach seinem Geldbeutel. Ich dachte, er wollte die Rechnung bezahlen. Aber dann schob er ein paar Zwanzig-Dollar-Scheine zu mir rüber.
»Ich will deinen schnöden Mammon nicht!«, rief ich. Vermutlich zu laut für ein Café mit so vornehmem französischem Flair.
»Entschuldigung?«
»Lass das mal meine Sache sein!«, übersetzte ich und schob ihm das Geld zurück.
»Aber damit wir uns recht verstehen – es muss ein besonders schöner Baum sein. Der schönste, den es gibt.«
»Keine Sorge«, versicherte ich ihm. Und gebrauchte dann einen Satz, der seit Anbeginn der Zeiten in New York gängige Münze und Währung ist: »Ich kenne da jemanden.«
Für einen New Yorker war es so gut wie unmöglich, zu einem Baum zu kommen, deshalb kamen im Dezember jeden Jahres die Bäume zu den New Yorkern. Kleine Läden, die den Eingang normalerweise mit Schnittblumenkübeln garnierten, erlebten plötzlich eine Invasion an Tannenbäumen. Ganze Haine lehnten sich an die Häuser. Parkplätze wurden mit wurzellosen Bäumen bepflanzt, manche Etablissements waren sogar bis in die frühen Morgenstunden geöffnet, falls jemand um zwei Uhr früh das dringende Bedürfnis verspürte, auf der Stelle seinen Wunsch nach einem Weihnachten mit »Oh, Tannenbaum« zu befriedigen.
Manche dieser Pop-up-Wäldchen wurden von Typen verhökert, die aussahen, als hätten sie sich mal eine Auszeit vom Drogendealen genommen, um eine andere Art des Geschäfts mit Nadeln und Sp(r)itzen auszuprobieren. Andere waren mit Kerlen in Holzfällerhemden bemannt, die den Eindruck erweckten, das allererste Mal in ihrem Leben über die Wälder von New Jersey hinausgekommen zu sein, und, wow!, war echt riesig hier in der Großstadt! Für die Kommunikation mit den Städtern standen ihnen dabei oft Schüler oder Studenten zur Seite, die dankbar für einen dieser regelmäßig wiederkehrenden Gelegenheitsjobs waren. Dieses Jahr war einer dieser Schüler mein bester Freund Boomer.
Natürlich hatte er einiges dazulernen müssen, nachdem er seine Stelle als Aushilfsverkäufer angetreten hatte. Aber die Kurve zeigte nach oben. Weil er als Kind viel zu oft Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten geguckt hatte, war er dem Irrglauben verfallen, dass die dürrsten und eigenwilligsten Gerippe unter den Weihnachtsbäumen auch die begehrtesten waren. Denn einem solchen Baum Obdach zu bieten, entsprach ja viel mehr der Weihnachtsbotschaft, als eine auftrumpfende, stolze Tanne zu beherbergen. Außerdem glaubte er fest daran, dass Christbäume nach Weihnachten wieder draußen im Wald eingepflanzt werden konnten. Es war ein schwieriges Gespräch, das wir da miteinander zu führen hatten.
Zum Glück machte Boomer durch seine Begeisterung und seinen Eifer wett, was ihm an Geschäftssinn fehlte. Weshalb der Stand in der 22nd Street, an dem er arbeitete, durch Mundpropaganda äußerst beliebt geworden war. Boomer war sozusagen der rising star unter den Weihnachtsbaumengeln. Eine Anerkennung, die ihn so freute, dass er es schon allein deswegen nicht bereute, sein exklusives Internat hingeschmissen zu haben, nur um in Manhattan bleiben zu können. Und das im wichtigen Schuljahr vor dem Highschool-Abschluss. Er hatte mir bereits geholfen, den richtigen Baum für die Wohnung meiner Mutter und die Wohnung meines Vaters zu finden. (Wobei meine Mutter natürlich den viel schöneren Baum gekriegt hatte.) Ich war mir sicher, dass er sich auch gern der Herausforderung stellen würde, den passenden Baum für Lily herauszusuchen. Trotzdem wurden meine Schritte immer zögerlicher, je näher ich kam. Nicht wegen Boomer … sondern wegen Sofia.
Außer der Tatsache, dass Boomer es satt hatte, sich noch länger in seinem Internat internieren zu lassen, hatte das neue Schuljahr auch noch ein paar andere Überraschungen mit sich gebracht. Wozu auch zählte, dass die Familie meiner Ex-Freundin Sofia wieder nach New York zurückgezogen war. Obwohl sie Stein und Bein geschworen hatten, Barcelona nie mehr verlassen zu wollen. Keineswegs überraschend dabei war, dass dies zu keinerlei Oh-meine-Exfreundin-ist-zurück-und-das-wird-schwierig-werden-Gefühlen bei mir führte, Sofia und ich hatten nämlich unser Verhältnis bei ihrem letzten New-York-Besuch hinreichend geklärt. Ja, ich freute mich sogar, sie wiederzusehen. Aber es war eine RIESENÜBERRASCHUNG, als sie anfing, mit Boomer herumzuhängen … und dann immer mehr und mehr mit ihm herumzuhängen … und dann noch mehr mit ihm herumzuhängen. Sodass die beiden schließlich eine Einheit bildeten, noch bevor ich mich überhaupt an die Möglichkeit eines solchen Gedankens gewöhnt hatte. Für mein Empfinden war das mit ihnen so, als würde man den teuersten, exquisitesten Käse der Welt nehmen und ihn dann auf einem Burger zerschmelzen lassen. Ich hatte sie beide sehr gern, aber auf ganz unterschiedliche Weise, und dass sie jetzt ein Paar waren, kriegte ich im Kopf nicht zusammen. Das bereitete mir echt Kopfschmerzen.
Weshalb ich auch überhaupt keine Lust darauf hatte, mich umständlich zu Boomers Arbeitsplatz aufzumachen, nur um dann dort womöglich feststellen zu müssen, dass Sofia dieselbe Idee gehabt hatte. Nur weil die beiden ihre Verliebtheitsvibrations unbedingt auch in entlegenere Stadtviertel von New York hinaussenden mussten. Boomer und Sofia waren in ihrer Honeymoon-Phase und das machte es für all diejenigen etwas schwierig, die den Honeymoon bereits hinter sich gelassen hatten und in die Phase ihrer Beziehung eingetreten waren, in der der Mond mal zunahm und mal wieder abnahm.
Darum war ich echt erleichtert, als ich feststellte, dass Boomer gerade nicht mit Sofia beschäftigt war, sondern mit einer sieben-, acht- oder neunköpfigen Familie. Wie viele Kinder es waren, ließ sich schwer sagen, weil sie alle so schnell kreuz und quer herumrannten.
»Das ist der Baum, der für Sie wie geschaffen ist«, erzählte Boomer den Eltern gerade, als wäre er ein wundersamer Bäumeflüsterer und der Tannenbaum hätte ihm gerade verraten, dass das Esszimmer der Familie der Ort war, wohin er immer schon wollte.
»Er ist etwas groß«, sagte die Mutter, die wahrscheinlich bereits überall in ihrer Wohnung Tannennadeln auf dem Boden verstreut liegen sah.
»Ja, er ist ein Baum mit einem großen, weiten Herzen«, antwortete Boomer. »Deswegen ist ja auch diese Verbindung zwischen Ihnen und ihm spürbar.«
»Das ist merkwürdig«, sagte der Vater, »weil ich da nämlich wirklich so was spüre.«
Der Kauf wurde abgeschlossen. Als Boomer mit der Kreditkarte des Vaters herumhantierte, entdeckte er mich und winkte mir zu. Ich wartete, bis die Familie mit dem Baum abgezogen war, vor allem weil ich Angst hatte, aus Versehen auf eines der Kinder zu treten.
»Gut Holz, Alter!«, sagte ich, als ich vor ihm stand. »Die hattest du ja ganz schön im Griff.«
Boomer schaute mich verwirrt an. »Wie meinst du das? Der Baum hat wirklich zu ihnen gepasst.«
Das hat mich echt verblüfft. Dass Boomer eine so naive, verträumte Seite hatte, die ich bisher gar nicht bei ihm vermutete. Was mich umso mehr darüber rätseln ließ, wie die direkte, unverblümte Sofia und er wirklich zusammenpassen wollten.
»Ich brauche einen Baum für Lily. Einen ganz besonderen Baum.«
»Du besorgst für Lily einen Weihnachtsbaum?«
»Ja. Als Vorweihnachtsgeschenk.«
»Wow! Find ich toll! Wo willst du ihn denn besorgen?«
»Ähm, na ja, ich dachte bei dir?«
»Oh ja! Na klar! Gute Idee!«
Er sah sich suchend um und murmelte dabei etwas vor sich hin, das eindeutig wie Oscar Oscar Oscar klang.
»Ist Oscar einer der Mitarbeiter hier?«, fragte ich.
»Weiß nicht, ob man das Arbeit nennen kann, was die Bäume hier so machen. Wahrscheinlich schon. Auf alle Fälle sind wir hier den ganzen Tag beisammen … und führen interessante Gespräche miteinander …«
»Oscar ist einer von den Bäumen?«
»Er ist der perfekte Baum für Lily.«
»Haben alle Bäume hier einen Namen?«
»Nur die natürlich, die ihn mir mitteilen. Du kannst sie ja nicht einfach so danach fragen. Das wäre viel zu aufdringlich.«
Boomer schaufelte mindestens ein Dutzend Bäume beiseite, bis er endlich Oscar ausgegraben hatte. Als er ihn herauszog, sah er – der Baum – für mich wie jeder andere aus.
»Das soll er sein?«, fragte ich.
»Warte einen Moment, warte …«
Boomer zerrte die Tanne von ihren Brüdern und Schwestern fort. Zum Rand des Gehsteigs. Sie war ein paar Kopf größer als Boomer, aber er trug sie in der Hand, als wäre sie nicht schwerer als ein Zauberstab. Mit anrührender Zärtlichkeit stellte er sie in einen Christbaumständer, und sobald der Baum sich darin befand, geschah etwas ganz Merkwürdiges – Oscar breitete im Licht der Straßenlaterne seine Arme aus und winkte mir zu.
Boomer hatte recht. Das war der Baum.
»Ich nehme ihn«, sagte ich.
»Cool«, antwortete Boomer. »Willst du, dass ich ihn einpacke? Weil er ja ein Geschenk ist?«
Ich versicherte ihm, eine rote Schleife wäre genug.
In New York als männlicher Teenager ein Taxi zu bekommen, ist schon schwer genug. Mit einem Weihnachtsbaum im Schlepptau ein Taxi zu bekommen, vollkommen unmöglich. Deshalb habe ich noch ein paar Einkäufe erledigt, bis Boomers Schicht zu Ende war, und danach rollten wir Oscar auf einem Wägelchen gemeinsam zu Lilys Wohnung im East Village.
Dort war ich im vergangenen Jahr nicht allzu oft gewesen. Lily sagte immer, es sei wegen Grandpa, damit er sich nicht gestört fühlte. Aber ich hatte eher das Gefühl, sie wollte nicht, dass ich noch mehr zum Chaos beitrug. Ihre Eltern hielten sich so viel zu Hause und in New York auf wie schon lange nicht mehr – das hätte Lily eigentlich entlasten müssen. Stattdessen wirkte es auf mich so, als gäbe es da jetzt noch zwei Menschen, um die sie sich kümmern musste.
Langston machte auf, und als er Boomer und mich mit dem Baum sah, rief er laut »Oah! Oah! OAAH!«. So laut, dass ich überzeugt war, Lily wäre zu Hause und würde bei diesem Lärm gleich hinter ihm an der Wohnungstür auftauchen. Aber dann teilte Langston mir mit, dass sie Grandpa gerade für einen Check-up zum Arzt begleitete. Die Eltern waren auch nicht zu Hause – welchen Grund hätte es für Menschen mit einem ausgeprägten Sozialleben geben sollen, an einem Samstag zu Hause zu sein? Deshalb waren wir allein in der Wohnung. Nur wir drei … und Oscar.
Während wir Oscar im Wohnzimmer aufstellten, versuchte ich auszublenden, wie trist und glanzlos ringsum alles wirkte. So als hätten die Räume in den vergangenen Monaten ihre Farbigkeit eingebüßt und eine dicke Staubschicht hätte sich über alles gelegt. Ich wusste inzwischen, wie die Rollen innerhalb der Familie verteilt waren, und deshalb war es für mich ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass Grandpa aus dem Verkehr gezogen war und Lily andere Dinge im Kopf hatte. Die beiden waren nämlich bisher die wahren und eigentlichen Hüter des Herdfeuers gewesen.
Als Oscar sich zu voller Pracht entfaltet hatte, holte ich meinen Rucksack und zog die i-Tüpfelchen des Ganzen heraus. Meine Glanztat, die hoffentlich bei meiner Liebsten großen Anklang finden würde.
»Was machst du denn da?«, fragte Langston, als ich lauter Sächelchen auf Oscars Zweigen verteilte.
»Sind das winzige Truthähne?«, mischte Boomer sich ein. »Oder wird das so was Ähnliches wie der Baum, den wir in Plymouth Rock gesehen haben, mit lauter Hühnern drauf, die auch so heißen wie der Ort?«
»Das sind Wachteln«, sagte ich und hielt ein Exemplar der kleinen geschnitzten Vögel mit dem großen Loch in der Mitte hoch. »Genauer gesagt, hölzerne Wachtel-Serviettenringe. Etwas anderes mit Wachteln gab es in dem Laden mit dem unsäglichen Namen nicht.« (Das Geschäft hieß Wichtelweihnacht, was in mir den heftigen Wunsch weckte, bei den Wichteln da drinnen mal so richtig die Glöckchen klingeln zu lassen. Diese Weihnachtswichser. Trotzdem war ich dann reingegangen und hatte mich friedlich verhalten.) »Wenn wir hier schon die zwölf Tage bis Weihnachten feiern, dann richtig. A pear in a partridge tree. Lily kann ihn danach weiterschmücken, wie sie will. Aber die Wachteln im Baum müssen sein. Ein Weihnachtswachtelbaum. Und ganz oben auf die Spitze als Krönung … eine Birne!«
Ich zog die besagte Frucht aus meinem Rucksack und hoffte, dafür Bewunderung zu ernten. Aber die Reaktionen darauf fielen eher in die Kategorie: Eine Birne macht noch keinen Sommer.
»Du kannst doch keine Birne oben auf den Baum setzen«, sagte Langston. »Wie bescheuert schaut das denn aus. Und außerdem ist sie in ein paar Tagen total verfault.«
»Aber es ist eine Birne! In einem Wachtelbaum!«, rief ich.
»Hab’s kapiert«, sagte Langston. Währenddessen brach Boomer in wieherndes Gelächter aus. Er hatte es offensichtlich noch nicht kapiert gehabt.
»Hast du eine bessere Idee?«, fragte ich.
Langston dachte einen Moment nach und sagte dann: »Eine zusätzliche.« Er machte ein paar Schritte und nahm eine Fotografie von der Wand, die dort eingerahmt hing. »Das hier.«
Er hielt mir das Foto vor die Nase. Obwohl es mindestens ein Jahrhundert alt war, erkannte ich darauf sofort Grandpa.
»Ist das neben ihm eure Großmutter?«
»Ja. Die Liebe seines Lebens. Die beiden waren zwei echte Turteltäubchen.« Eine Birne. Zwei Turteltäubchen. Perfekt. Die Birne konnte dann meinetwegen morgen auch wieder verschwinden.
Wir brauchten eine Weile, bis wir alles richtig platziert hatten – Langston und ich probierten für die Birne und die Turteltäubchen verschiedene Zweige aus. Boomer kümmerte sich darum, dass Oscar dabei schön still stand. Schließlich brachten wir die Turteltäubchen knapp unter der Spitze des Tannenbaums an. Die Wachteln waren hübsch über die Zweige verstreut und die Birne hing als schwere Frucht ganz unten.
Fünf Minuten, nachdem wir fertig waren, ging die Wohnungstür auf und Lily kehrte mit Grandpa zurück. Obwohl ich ihn vor seinem Treppensturz nur ein paar Monate gekannt hatte, war ich jedes Mal wieder überrascht, wie klein und schmal Lilys Großvater geworden war – so als hätten die vielen Aufenthalte in Krankenhäusern und Rehakliniken bei ihm ähnlich gewirkt wie ein zu heißer Waschgang in der Waschmaschine. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, kam er mir noch geschrumpfter vor.
Aber der Händedruck, der blieb. Kaum hatte er mich gesehen, da streckte er auch schon die Hand aus und fragte: »Na, Dash? Was macht das Leben denn so?« Und als er meine Hand danach schüttelte, schüttelte er sie kräftig.
Lily fragte mich nicht, was ich hier bei ihr eigentlich wollte, aber die Frage war ihren müden Augen deutlich abzulesen.
»Wie war’s beim Arzt?«, fragte Langston.
»Seine Gesellschaft ist immer noch besser als der Leichenbestatter!«, antwortete Grandpa. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn diesen Witz machen hörte. Was bedeutete, dass Lily ihn bestimmt schon das zweihundertste Mal über sich ergehen lassen musste.
»Warum? Hat der Leichenbestatter Mundgeruch?« Das kam von Boomer, der jetzt ebenfalls aus dem Wohnzimmer kam.
»Boomer!«, rief Lily. Jetzt war sie endgültig verwirrt. »Was machst du denn hier?«
Langston mischte sich ein. »Zu meiner großen Überraschung hat dein Romeo uns allen ein etwas verfrühtes Weihnachtsgeschenk vorbeigebracht.«
»Komm mit«, sagte ich und nahm sie bei der Hand. »Schließ die Augen. Ich zeig es dir.«
Lilys Händedruck war nicht wie der ihres Großvaters. Früher waren unsere Hände wie elektrisiert, wenn sie sich berührten. Jetzt war es eher eine statische Angelegenheit. Angenehm, aber unaufdringlich.
Lily schloss die Augen. Und als wir ins Wohnzimmer kamen und ich zu ihr sagte, sie solle sie jetzt aufmachen, da tat sie es.
»Darf ich dir Oscar vorstellen«, sagte ich. »Er ist mein Geschenk für dich zum ersten Weihnachtstag.«
»Es ist eine Birne im Wachtelbaum«, platzte Boomer heraus. »Und zwei Turteltäubchen.«
Lily ließ den Anblick stumm auf sich wirken. Sie wirkte überrascht. Vielleicht war ihre Reaktion auch nur ein weiteres Zeichen ihrer Erschöpfung. Dann regte sich in ihr etwas und sie lächelte.
»Das musstest du wirklich nicht«, fing sie an.
»Wollte ich aber!«, sagte ich hastig. »Wollte ich unbedingt.«
»Die Birne hab ich schon entdeckt«, sagte Grandpa. »Aber wo sind die Turteltäubchen?« Dann entdeckte er die Fotografie. Seine Augen wurden feucht. »Oh. Da. Das sind ja wir.«
Lily entdeckte die Fotografie auch. Falls ihr Tränen in die Augen schossen, dann flossen sie nach innen. Ich hätte beim besten Willen nicht sagen können, was gerade in ihrem Kopf vorging. Ich warf Langston einen fragenden Blick zu, der sie genauso aufmerksam studierte wie ich. Und auch er schien aus ihr nicht schlau zu werden.
»Frohen ersten Weihnachtstag«, sagte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Der erste Weihnachtstag ist aber doch erst an Weihnachten«, flüsterte sie.
»Nicht dieses Jahr«, sagte ich. »Nicht für uns.«
Langston sagte, dass es an der Zeit sei, den übrigen Christbaumschmuck zu holen und den Baum weiterzuschmücken. Boomer bot sich gleich an, dabei zu helfen, und Grandpa stand sofort auf, um die Schachteln zu holen. Das brachte Lily mit einem Mal wieder in die Wirklichkeit zurück – sie bugsierte ihn hinüber zur Couch und verkündete, er solle lieber von dort aus zuschauen, wie wir den Baum dekorierten. Grandpa mochte es nicht, dass sie ihn so behandelte, das war deutlich zu spüren. Aber auch, dass er wusste, es würde nur Lilys Gefühle verletzen, wenn er jetzt einen Streit mit ihr anfing. Deshalb setzte er sich auf die Couch. Ihr zuliebe.
Als dann die Schachteln hereingetragen wurden, wusste ich, dass es für mich an der Zeit war zu gehen. Gemeinsam den Baum zu schmücken war eine Sache, die man mit der Familie machte. Und wenn ich blieb und so tat, als würde ich zur Familie gehören, würde ich das So-zu-tun-als-ob genauso auf mir lasten fühlen, wie ich auf Lily das Gewicht lasten spürte, so zu tun, als wäre sie glücklich. So zu tun, als hätte sie unheimliche Lust, das zu tun, wozu wir sie gerade ermuntern wollten. Sie tat es für Langston und ihren Grandpa und ihre Eltern, sobald sie zurückkamen. Wenn ich blieb, würde sie es auch für mich tun. Aber ich wollte, dass sie es für sich selbst tun wollte. Ich wollte, dass sie dasselbe Weihnachtswunder in sich spürte wie letztes Jahr um diese Zeit. Dafür war mehr notwendig als ein perfekter Tannenbaum. Dafür war ein echtes Wunder notwendig.
Zwölf Tage.
Wir hatten diese zwölf Tage.
Ich hatte um Weihnachten und das ganze Drumherum mein ganzes Leben lang einen großen Bogen gemacht. Aber dieses Jahr war das anders. Dieses Jahr hatte ich nur einen einzigen Wunsch. Ich wollte, dass Lily wieder glücklich war.