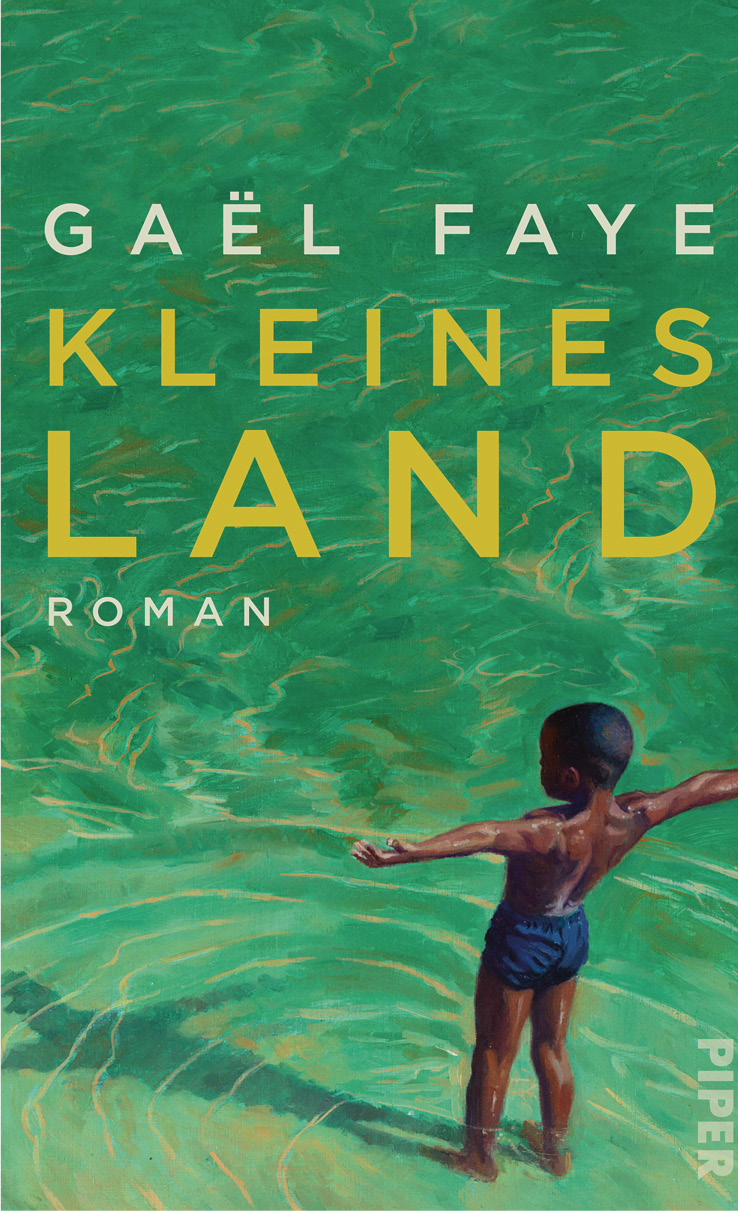
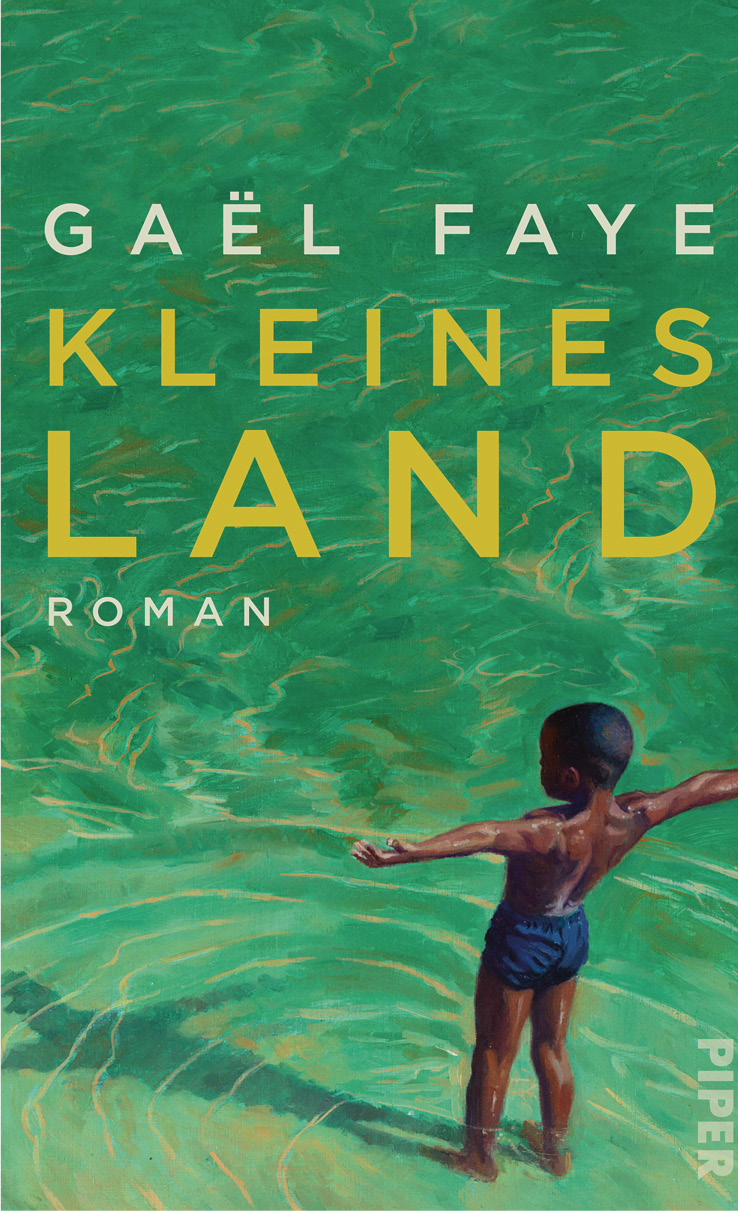
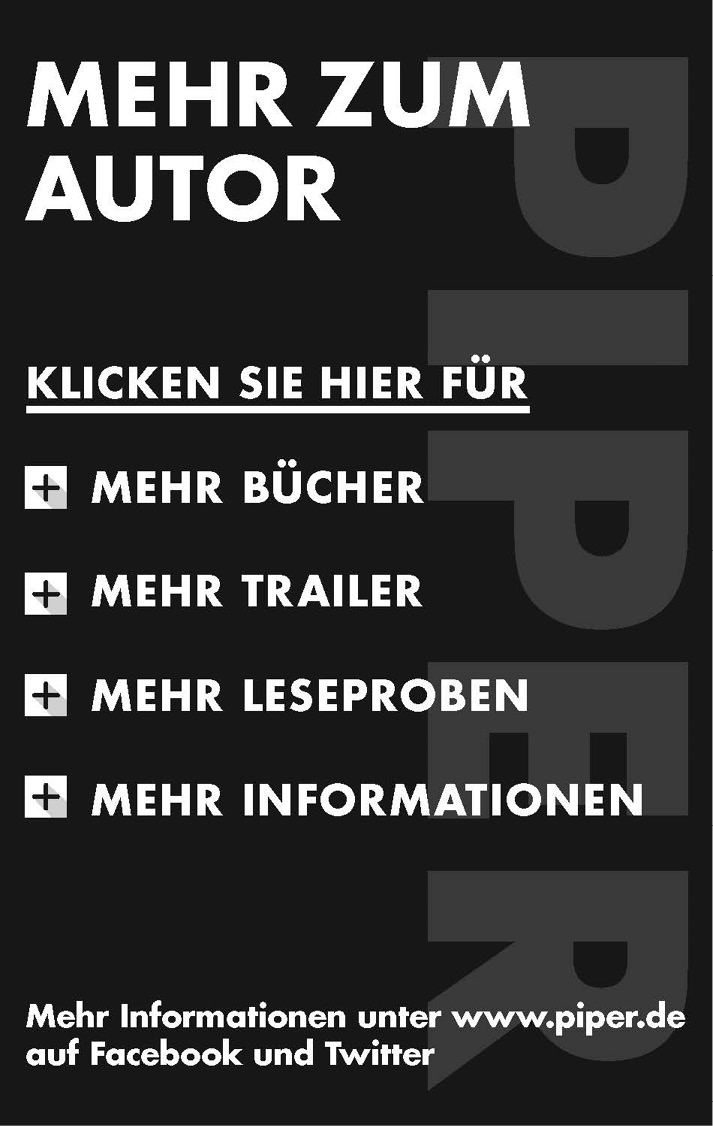
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
Für Jacqueline
Übersetzung aus dem Französischen
von Brigitte Große und Andrea Alvermann
Das Zitat in Kapitel 31 stammt aus: Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée. 1944, Imprimerie de l’État, Port-au-Prince. Übersetzung von Brigitte Große und Andrea Alvermann.
ISBN 978-3-492-97767-8
Oktober 2017
Copyright © Editions Grasset & Fasquelle, 2016
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Me, 2011, (oil on wood), Bootman,
Datenkonvertierung: psb, Berlin
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Ich weiß wirklich nicht, wie die Geschichte angefangen hat.
Dabei hat Papa uns das mal im Pick-up erklärt.
»In Burundi ist es wie in Ruanda, versteht ihr? Da leben drei verschiedene Gruppen, Ethnien heißt das. Hutu gibt es am meisten, die sind klein und haben eine dicke Nase.«
»Wie Donatien?«, habe ich ihn gefragt.
»Nein, der ist Zairer, das ist was anderes. Wie unser Koch Prothé zum Beispiel. Dann gibt es noch Pygmäen, die Twa. Aber das sind so wenige, dass wir sie vernachlässigen können, sagen wir mal, die zählen nicht. Und dann gibt es die Tutsi, wie eure Mama. Die sind viel weniger als die Hutu, groß und dünn und mit schmaler Nase, und man weiß nie, was sie denken. Du zum Beispiel«, hat er gesagt und dabei mit dem Finger auf mich gezeigt, »du bist ein typischer Tutsi, Gabriel, bei dir weiß man auch nie, was dir durch den Kopf geht.«
Da hab ich dann auch nicht mehr gewusst, was ich denke. Und was sollte man auch von dem Ganzen halten? Also habe ich Papa gefragt:
»Kommt der Krieg zwischen Tutsi und Hutu daher, dass sie in verschiedenen Gegenden wohnen?«
»Nein, sie leben ja im selben Land.«
»Dann sprechen sie nicht dieselbe Sprache?«
»Doch, sie sprechen dieselbe Sprache.«
»Vielleicht haben sie nicht denselben Gott?«
»Doch, sie haben denselben Gott.«
»Aber … warum machen sie dann Krieg?«
»Weil sie nicht die gleiche Nase haben.«
Damit war die Diskussion beendet. Trotzdem komisch. Papa hat das, glaub ich, auch nie richtig verstanden. Jedenfalls hab ich ab da immer drauf geachtet, wie groß die Leute sind und was für eine Nase sie haben. Wenn ich mit meiner kleinen Schwester Ana in der Stadt einkaufen war zum Beispiel, haben wir immer geraten, wer Hutu ist und wer Tutsi, und ständig miteinander getuschelt:
»Der mit der weißen Hose ist bestimmt ein Hutu, weil er so klein ist und eine dicke Nase hat.«
»Ja, und der mit dem Hut, der ist so riesig groß und dünn und hat eine ganz schmale Nase, das ist ein Tutsi.«
»Der dort in dem gestreiften Hemd ist auch ein Hutu.«
»Quatsch, schau doch hin, der ist groß und dürr.«
»Ja, aber er hat eine dicke Nase!«
Da sind uns Zweifel gekommen an der Sache mit den Ethnien. Papa wollte sowieso nicht, dass wir darüber reden. Kinder sollen sich nicht in die Politik einmischen, fand er. Aber wir konnten gar nicht anders. Die merkwürdige Atmosphäre wurde von Tag zu Tag schlimmer. Auch in der Schule ist es bald losgegangen mit diesem Du-bist-doch-Hutu-du-bist-doch-Tutsi-Ärger. Sogar bei einer Vorführung von Cyrano de Bergerac hat einer krakeelt: »Das ist doch ein Tutsi – mit der Nase!« Etwas lag in der Luft. Und das konnte man riechen, egal, mit welcher Nase.
Die wahren Gründe für die Trennung meiner Eltern werde ich nie erfahren. Aber anscheinend gab es da von Anfang an ein großes Missverständnis. Einen Konstruktionsfehler in ihrer Begegnung, ein Sternchen, das niemand gesehen hatte oder sehen wollte. In der Zeit davor waren meine Eltern jung und schön, Hoffnung ließ ihre Herzen schwellen wie die Sonne der Unabhängigkeiten. Das musste man sehen! Mein Vater konnte sein Glück nicht fassen, als er ihr am Hochzeitstag den Ring an den Finger steckte. Mit seinen stechenden grünen Augen, seinen blond gesträhnten brünetten Haaren und seiner Wikingerstatur hatte er natürlich einen gewissen Charme und auch was Väterliches. Mama war er trotzdem nicht gewachsen. Nicht mal bis zu den Knöcheln, denn die waren was ganz Besonderes. Nämlich der Ausgangspunkt langer, wohlgeformter Beine, die Frauen von Flinten träumen ließen und Männern von halb offenen Fensterläden. Papa war ein kleiner Franzose aus dem Jura, vom Zivildienst nach Afrika verschlagen, aus einem Kaff in den Bergen, wo die Landschaft der in Burundi zum Verwechseln ähnlich sah, aber dort gab es keine Frauen wie Mama, ranke Schönheiten wie Süßgrasrispen, hochgewachsen wie Wolkenkratzer, mit einer Haut wie Ebenholz und großen Augen wie ein Ankole-Rind. Das musste man hören! Am Hochzeitstag entsprang den schlecht gestimmten Gitarren eine unbekümmerte Rumba, und das Glück pfiff leise einen Cha-Cha-Cha unterm Sternenhimmel. Da gab’s kein Vertun! Blieb nur noch eins: Lieben. Leben. Lachen. Sein. Immer der Nase nach, ohne stehen zu bleiben, bis ans Ende der Straße und weiter.
Nur dass meine Eltern ratlose Jugendliche waren, von denen man auf einmal verlangte, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden. Kaum ihrer Pubertät, den Hormonen und durchzechten Nächten entwachsen, sollten sie die auf ex geleerten Flaschenleichen entsorgen, die Stummel der Joints aus den Aschenbechern kratzen, ihre psychedelischen Rockplatten zurück in die Hüllen stecken und ihre Jeans mit Schlag und die indischen Blusen zusammenfalten. Ihre Stunde hatte geschlagen. Kinder, Steuern, Pflichten, Sorgen – sie kamen zu schnell und zu früh. Und mit ihnen Straßenräuber, Diktatoren und Staatsstreiche, Strukturprogramme, die Verleugnung der Ideale, dazu Tage, an denen es schwerfiel aufzustehen, und eine Sonne, die jeden Morgen ein bisschen länger im Bett lag. Die Wirklichkeit brach in ihr Leben ein. Hart und unbarmherzig. Aus dem leichtfüßigen Anfang wurde ein tyrannischer Rhythmus, unerbittlich wie das Ticken einer Standuhr. Die Natur machte auf Bumerang und flog meinen Eltern um die Ohren, die plötzlich begriffen, dass sie Lust mit Liebe verwechselt und sich die Eigenschaften des anderen entsprechend zusammengezimmert hatten. Sie hatten nur ihre Illusionen geteilt, nicht aber ihre Träume. Die behielten sie egoistisch für sich und waren auch nicht bereit, die Erwartungen des anderen zu erfüllen.
In der Zeit davor, bevor das alles passierte, vor dem, was ich erzählen werde, und dem ganzen Rest, war es das Glück, das Leben, das man nicht erklären muss. Es war, wie es war, wie es immer gewesen war und wie ich mir wünschte, dass es immer bleiben möge. Ein leiser, friedlicher Schlummer, ohne dass dir eine Mücke vor den Ohren herumtanzt, ohne dass ein Hagel von Fragen auf deinen Kopf einprasselt wie Regen auf ein Blechdach. In der Zeit des Glücks antwortete ich auf die Frage »Wie geht’s?« immer mit »Gut!«. Einfach so, zack. Das Glück erspart einem das Überlegen. Erst danach habe ich angefangen, über die Frage nachzudenken. Das Für und Wider abzuwägen. Mich dem zu entziehen und vage zu nicken. So ging es dem ganzen Land. Alle sagten nur noch »Geht so«. Weil nach all dem, was mit uns passiert war, das Leben nicht mehr richtig gut gehen konnte.
Der Anfang vom Ende des Glücks war, glaube ich, dieser Nikolaustag auf Jacques’ großer Terrasse in Bukavu. Einmal im Monat besuchten wir ihn in Zaire, den alten Jacques, das war zu einer Gewohnheit geworden. An diesem Tag kam Mama mit, obwohl sie schon seit Wochen nicht mehr viel mit Papa sprach. Bevor es losging, fuhren wir noch bei der Bank vorbei, um uns Devisen zu holen. »Wir sind Millionäre!«, rief Papa, als er wieder herauskam. Unter Mobutu hatte das Geld in Zaire so an Wert verloren, dass man für ein Glas Trinkwasser mit Fünf-Millionen-Scheinen bezahlte.
Am Grenzposten wechselten wir in eine andere Welt. An die Stelle burundischer Zurückhaltung trat zairisches Tohuwabohu. In dem Riesengewusel trafen sich Leute, schrien durcheinander oder beschimpften sich gegenseitig wie auf einem Viehmarkt. Lärmende, schmutzige Kinder beglotzten die Rückspiegel, die Scheibenwischer und die von Pfützen stehenden Wassers dreckbespritzten Felgen. Für ein paar Schubkarren Geld wurden Ziegen zu Spießen, ledige Mütter liefen Slalom durch die Reihen von Pick-ups und Minibussen, die Stoßstange an Stoßstange in der Schlange standen, und verkauften schwarz harte Eier, die man in grobes Salz tauchen konnte, oder Tütchen mit scharfen Erdnüssen, Bettler mit von der Kinderlähmung verbogenen Beinen wollten ein paar Millionen, um die lästigen Folgen des Berliner Mauerfalls zu überleben, und ein Pastor stand mit einer in Königspythonhaut gebundenen Bibel auf Suaheli in der Hand auf der Motorhaube seines klapprigen Mercedes und verkündete lautstark das baldige Ende der Welt. Ein in dem rostigen Grenzhäuschen vor sich hin dösender Soldat wedelte träge mit einer Fliegenklatsche. Dieselschwaden und heiße Luft hatten die Kehle des Beamten, der seit Ewigkeiten kein Gehalt mehr bekommen hatte, ausgedörrt. Riesige, aus Schlaglöchern entstandene Krater in den Straßen setzten den Autos zu. Das hinderte den Zöllner aber keineswegs daran, die Reifenprofile, den Kühlwasserstand und das ordnungsgemäße Funktionieren der Blinker bei jedem Einzelnen genauestens zu überprüfen. Zeigte das Fahrzeug keinen der erhofften Mängel, verlangte er einen Tauf- oder Erstkommunionschein, damit man ins Land durfte.
Kampfesmüde rückte Papa an diesem Nachmittag endlich das Trinkgeld raus, auf das all diese grotesken Manöver abzielten. Der Schlagbaum hob sich, und wir konnten unseren Weg im Dampf der heißen Quellen fortsetzen, die den Straßenrand säumten.
Zwischen der kleinen Stadt Uvira und Bukavu hielten wir an diversen dubiosen Spelunken, um Bananenbällchen und Tütchen mit frittierten Termiten zu kaufen. Die Lokale trugen wunderliche Namen wie »Au Fouquet’s des Champs-Elysées«, »Snack-bar Giscard d’Estaing« oder »Restaurant fête comme chez vous«. Als Papa die Polaroidkamera zückte, um diese Schilder zu verewigen und die Kreativität der Einheimischen zu feiern, tchipte Mama ihn an und warf ihm vor, einem Exotismus für Weiße zu huldigen.
Nachdem wir eine Vielzahl von Hähnen, Enten und Kindern fast totgefahren hätten, gelangten wir nach Bukavu, einer Art Paradies am Ufer des Kivu-Sees mit Art-déco-Überresten einer einst futuristischen Stadt. Bei Jacques war schon der Tisch für uns gedeckt. Er hatte frische Gambas aus Mombasa kommen lassen.
»Eine schöne Austernplatte wäre besser gewesen«, bemerkte Papa, »aber es tut schon gut, von Zeit zu Zeit was Anständiges zwischen die Zähne zu kriegen!«
»Worüber beklagst du dich, Michel?«, fragte Mama ohne Zärtlichkeit. »Schmeckt dir das Essen bei uns nicht?«
»Nein! Dieser blöde Prothé zwingt mich jeden Mittag, seine afrikanischen Hülsenfrüchte runterzuwürgen. Wenn er doch wenigstens ein Entrecôte braten könnte!«
»Davon kann ich auch ein Lied singen!«, pflichtete Jacques ihm bei. »Mein Küchenmakak brät alles tot, weil das angeblich die Parasiten vernichtet. Ich weiß gar nicht mehr, was ein ordentliches englisches Steak ist. Wäre ich doch nur in Brüssel, um mich einer anständigen Amöbenkur zu unterziehen!«
Allgemeines Gelächter. Nur Ana und ich am Ende des Tisches blieben still. Ich war zehn Jahre alt, sie war sieben. Vielleicht verstanden wir deshalb Jacques’ Humor nicht. Ohnehin war es uns strengstens verboten, etwas zu sagen, es sei denn, wir würden angesprochen. Das war die goldene Regel bei allen Einladungen. Papa konnte es nicht leiden, wenn Kinder sich in die Gespräche der Erwachsenen einmischten. Schon gar nicht bei Jacques, der wie ein zweiter Vater für ihn war, ein Vorbild, von dem er, ohne es zu merken, die Ausdrucksweise, die Mimik und sogar den Tonfall übernahm. »Von ihm habe ich alles über Afrika gelernt!«, sagte er oft zu Mama.
Zum Schutz vor dem Wind beugte sich Jacques unter den Tisch, um sich mit seinem silbernen Zippo mit den zwei eingravierten Hirschen eine Zigarette anzuzünden. Dann kam er wieder hoch, ließ ein paar Rauchkringel aus seiner Nase aufsteigen und schaute eine Weile auf den Kivu-See. Von seiner Terrasse aus konnte man in der Ferne eine verlorene kleine Inselkette entdecken. Jenseits, auf der anderen Seite des Sees, lag die ruandische Stadt Cyangugu. Mamas Blick hing an diesem Jenseits. Bestimmt gingen ihr jedes Mal, wenn wir bei Jacques zum Essen waren, trübselige Gedanken durch den Kopf. Dort drüben, nur wenige Kabellängen entfernt, lag ihre Heimat Ruanda, zum Greifen nah. Sie war nicht mehr dort gewesen, seit sie 1963 als Vierjährige im Schein der Flammen, die das Haus ihrer Familie niederbrannten, in einer Massakernacht von dort geflohen war.
Der Rasen in Jacques’ Garten war tadellos gemäht, von einem alten Gärtner, der seine Machete in weit ausholenden Bewegungen schwang wie einen Swingolf-Schläger. Vor uns saugten metallicgrüne Kolibris Nektar aus dem roten Hibiskus, was ein bemerkenswertes Ballett abgab. Ein Kronenkranichpärchen spazierte durch den Schatten der Zitronenbäume und Guajaven. Jacques’ Garten wimmelte vor Leben, sprühte vor Farben und verströmte einen zarten Zitronengrasduft. Sein Haus, das aus seltenen Hölzern des Nyungwe-Waldes und schwarzem, porösem Stein vom Nyiragongo-Vulkan erbaut war, ähnelte einem Schweizer Chalet.
Als Jacques die Tischglocke läutete, kam der Koch angelaufen. Seine Dienstkleidung mit Mütze und weißer Schürze passte nicht recht zu seinen schrundigen nackten Füßen.
»Stell uns noch drei Primus hin, und räum gefälligst diesen Saustall auf!«, befahl Jacques.
»Wie geht es dir, Évariste?«, fragte Mama den Koch.
»Gott sei Dank ganz gut, Madame!«
»Lass gefälligst Gott aus dem Spiel!«, warf Jacques ein. »Dir geht es nur deshalb gut, weil es noch ein paar Weiße in Zaire gibt, die den Laden am Laufen halten. Ohne mich würdest du betteln gehen, wie alle anderen von deiner Sorte auch!«
»Wenn ich Gott sage, mein ich doch dich, Chef!«, gab der Koch spöttisch zurück.
»Verarsch mich nicht, du Makak!«
Sie mussten beide lachen, und Jacques fuhr fort: »Unglaublich, dass ich es bei keiner Frau geschafft habe, sie länger als drei Tage zu halten, aber mir seit fünfunddreißig Jahren diesen Schimpansen aufhalse!«
»Du hättest mich heiraten sollen, Chef!«
»Funga kimwa! Bring lieber das Bier, statt hier dumm rumzulabern!«, sagte Jacques in einem neuerlichen Lachanfall, gefolgt von einem Räuspern, bei dem mir fast die Gambas wieder hochkamen.
Ein Kirchenlied vor sich hin singend, trollte sich der Koch. Jacques schnäuzte sich laut in ein mit seinen Initialen besticktes Stofftaschentuch, nahm seine Zigarette wieder auf, ließ ein bisschen Asche auf das versiegelte Parkett fallen und sagte zu Papa: »Das letzte Mal in Belgien haben die Ärzte mir gesagt, wenn ich nicht mit dem Rauchen aufhöre, gehe ich über den Jordan. Was ich hier nicht alles mitgemacht habe: Kriege, Plünderungen, Mangelwirtschaft, Bob Denard und Kolwezi, dreißig Jahre schwachsinnige ›Zairisierung‹, und am Ende bringen mich die Zigaretten um! Himmel, Arsch und Zwirn!«
Seine Hände und der kahle Schädel waren voller Altersflecken. Es war das erste Mal, dass ich ihn in Shorts sah. Seine unbehaarten, milchweißen Beine bildeten einen merkwürdigen Gegensatz zur sonnenverbrannten Haut der Unterarme und des zerfurchten Gesichts – als ob sein Körper aus unterschiedlichen Teilen zusammengefügt wäre.
»Vielleicht haben die Ärzte recht, und du solltest mal kürzertreten«, schaltete Mama sich ein. »Drei Päckchen pro Tag sind ganz schön viel, lieber Jacques.«
»Fang du jetzt nicht auch damit an!«, erwiderte Jacques, immer noch an Papa gewandt, als wäre Mama gar nicht da. »Mein Vater hat geraucht wie ein Schlot und ist fünfundneunzig geworden. Und was der sonst noch so alles erlebt hat! Das waren Zeiten, damals im Kongo unter Leopold III.! Ein Teufelskerl, mein Vater! Hat die Eisenbahnstrecke von Kabalo nach Kalemi gebaut. Die natürlich auch schon lange nicht mehr funktioniert, wie alles in diesem Drecksland. Das totale Chaos, kann ich dir sagen!«
»Warum verkaufst du nicht alles und kommst nach Bujumbura?«, rief Papa mit der Begeisterung aus, die ihn gelegentlich befiel, wenn er spontan eine Eingebung hatte. »Das Leben dort ist angenehm. Ich habe jede Menge Baustellen und bekomme Angebote en masse. Da ist gerade einiges zu holen!«
»Verkaufen? Hör mir auf mit dem Scheiß! Meine Schwester bequatscht mich schon ständig am Telefon, dass ich nach Belgien gehen soll. ›Komm nach Hause, Jacques‹, sagt sie immer, ›sonst geht es noch schlecht für dich aus. Bei den Zairern endet es doch immer damit, dass sie die Weißen ausplündern und lynchen.‹ Kannst du dir mich in einer Wohnung in Ixelles vorstellen? Ich hab nie da gelebt, was soll ich dort in meinem Alter? Als ich das erste Mal belgischen Boden betreten habe, war ich fünfundzwanzig und hatte zwei Kugeln im Bauch. Die haben sie mir aus einem Hinterhalt verpasst, als wir die Kommunisten aus Katanga vertrieben haben. In Belgien bin ich unters Messer gekommen, aber kaum war ich wieder zusammengeflickt, bin ich stehenden Fußes zurück. Ich bin mehr Zairer als all diese Neger zusammen! Ich bin hier geboren und werde hier sterben! In Bujumbura würde es mir ein paar Wochen gefallen, ich würde zwei, drei Geschäfte abschließen, ein paar großen bwanas die Hand schütteln, ein paar Garküchen und alte Freunde abklappern und dann wieder heimfahren. Die Burunder sind so gar nicht mein Fall. Bei den Zairern weiß man wenigstens, woran man ist. Matabiche, Bakschisch, Trinkgeld, und alles läuft! Aber die Burunder? Komische Käuze. Kratzen sich mit der rechten Hand am linken Ohr …«
»Genau das sage ich auch immer zu Michel!«, warf Mama ein. »Ich halte das Land nicht mehr aus!«
»Bei dir ist das ganz was anderes, Yvonne«, sagte Papa verärgert. »Du träumst ja davon, in Paris zu leben, das ist deine fixe Idee!«
»Ja, und es wäre gut für uns alle, für dich, für mich und für die Kinder. Was haben wir denn für eine Zukunft in Bujumbura? Kannst du mir das sagen? Doch nur dieses jämmerliche, kleine Leben!«
»Fang nicht schon wieder damit an, Yvonne! Es ist immerhin deine Heimat, von der du sprichst.«
»Nein, nein, nein, nein, nein … Meine Heimat ist Ruanda! Da, gegenüber, vor deinen Augen! Ruanda! Ich bin ein Flüchtling, Michel. Und in den Augen der Burunder bin ich das immer gewesen. Sie haben es mich spüren lassen mit ihren Beleidigungen, ihren Unterstellungen, ihren Ausländerquoten und ihrem Numerus clausus in der Schule. Also lass mich gefälligst von Burundi denken, was ich will!«
»Warte, Schatz!«, sagte Papa in gewollt beruhigendem Tonfall zu Mama. »Schau dich mal um. Diese Berge, diese Seen, diese Landschaft! Wir leben in einem schönen Haus mit Hausangestellten, Platz für die Kinder, das Klima ist gut, und die Geschäfte laufen nicht schlecht. Was willst du mehr? So einen Luxus wirst du in Europa nie haben, das kannst du mir glauben. Europa ist keineswegs das Paradies, das du dir vorstellst. Warum, glaubst du, habe ich mir hier seit zwanzig Jahren ein Leben aufgebaut? Warum, glaubst du, bleibt Jacques lieber in Zaire, statt nach Belgien zu gehen? Hier sind wir privilegiert. Dort sind wir niemand. Warum weigerst du dich, das zu begreifen?«
»Du redest und redest, aber ich weiß um die Schattenseiten. Du bewunderst die lieblichen Hügel, aber ich kenne das Elend derer, die dort hausen. Du schwärmst von der Schönheit der Seen, aber ich rieche das Methan, das unter dem Wasser schlummert. Du bist aus deinem ruhigen Frankreich geflohen, um in Afrika Abenteuer zu erleben. Schön für dich! Aber ich wünsche mir die Sicherheit, die ich nie hatte, den Luxus, meine Kinder in einem Land großzuziehen, in dem man keine Angst haben muss zu krepieren, weil man …«
»Hör auf mit deinen ewigen Ängsten und deinem Verfolgungswahn, Yvonne! Du musst immer gleich alles dramatisieren. Mit deinem französischen Pass hast du doch nichts mehr zu befürchten. Du lebst in einer Villa in Bujumbura, nicht in einem Flüchtlingslager, also mach bitte mal halblang!«
»Ich pfeife auf deinen Pass, das ändert nichts an der Sache, an dieser Bedrohung, die überall lauert. Aber die Geschichte, von der ich spreche, interessiert dich ja nicht, Michel, und sie hat dich auch nie interessiert. Du warst immer nur auf der Suche nach einem neuen Spielplatz, wo du als verwöhntes Kind des Westens deine Träume ausleben kannst …«
»Was redest du denn da? Du gehst mir ganz schön auf die Nerven, ehrlich. Viele Afrikanerinnen würden sich glücklich schätzen, wenn sie an deiner Stelle …«
Mama starrte Papa so streng an, dass er es nicht wagte, den Satz zu beenden. Dann fuhr sie sehr ruhig fort:
»Du merkst ja nicht einmal mehr, was du sagst, mein armer Michel. Ich gebe dir einen guten Rat: Als alter Baba-cool-Hippie solltest du es nicht mit Rassismus versuchen, das steht dir überhaupt nicht. Überlass das lieber Jacques und den anderen echten Kolonialisten.«
Jacques verschluckte sich am Rauch seiner Zigarette. Mama war es egal, sie war aufgestanden, hatte Papa ihre Serviette ins Gesicht geworfen und war gegangen. In dem Moment kam der Koch, ein freches Grinsen auf den Lippen, und brachte das Primus auf einem Plastiktablett.
»Yvonne! Komm sofort zurück!«, brüllte mein Vater, beide Fäuste auf den Tisch gestemmt und den Hintern leicht angehoben. »Du entschuldigst dich auf der Stelle bei Jacques!«
»Lass gut sein, Michel«, sagte der. »Frauen …«