


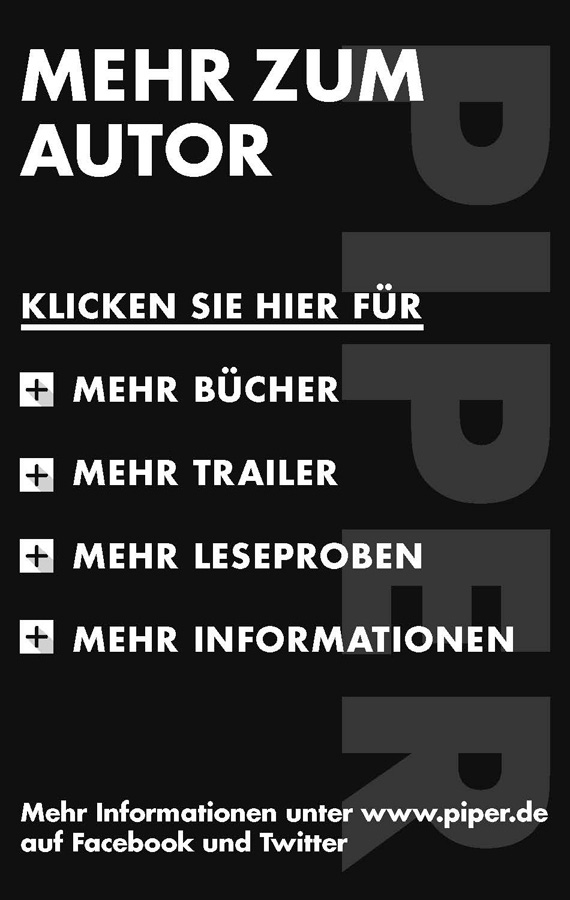
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen
von Rudolf Katzer
ISBN 978-3-492-97596-4
Mai 2017
© Arthur Escroyne 2016
Deutschsprachige Ausgabe:
© Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: U1 Berlin/Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Look and Learn/Valerie Jackson Harris Collection/Bridgeman Images, Private Collection/Bridgeman Images, Purix Verlag Volker Christen/Bridgeman Images und Donald Erickson/Getty Images
Datenkonvertierung: Uhl + Massopust, Aalen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Messer im Rücken
Ich sage es jetzt zum letzten Mal, ein Feuerzeug ist nichts für einen kleinen Jungen. Haben wir uns verstanden?«
Ich habe das rote Wegwerffeuerzeug schon an allen möglichen Plätzen versteckt, aber Philipp John findet es jedes Mal wieder. Wegen seiner leuchtenden Farbe besitzt das Ding einen besonderen Reiz für ihn, vielleicht auch, weil irgendein Superheld darauf abgebildet ist. Obwohl Philipp Johns kleine Finger noch nicht imstande wären, den schwergängigen Mechanismus zu bedienen, ist es undenkbar, dass ein Dreijähriger mit dem Feuer spielen darf. Rosy, meine Frau, sieht das genauso. Nur ist Rosy so gut wie nie zu Hause, wenn Probleme dieser Art auftauchen. Detective Inspector Rosemary Escroyne verlässt Sutherly Castle täglich morgens um sieben Uhr vierzig und trifft um acht Uhr fünfzehn in ihrem Büro in Gloucester ein. Es ist das Büro der leitenden Chefkommissarin der Mordkommission.
So sieht die Einteilung des Lebens aus, seit Rosy und ich ein Kind haben. Seit anderthalb Jahren steht sie wieder an der Spitze des Dezernats für Kapitalverbrechen, einem Job, den niemand besser ausfüllen könnte als Rosy. Sie ist dazu geboren, gegen Mörder zu kämpfen. Bin ich allerdings dazu geboren, das Hausmütterchen zu spielen? Das ist die Frage, die ich an Philipp Johns erstem Geburtstag noch zärtlich mit Ja beantwortet habe, die nach seinem zweiten Geburtstag an Brisanz gewann und die kurz vor seinem dritten Geburtstag wie eine Flammenschrift an der Wand steht. Warum muss ich unseren Sohn allein großziehen, wieso setzt Rosy das voraus? Und weshalb mache ich nicht endlich den Mund auf und proklamiere, dass es so nicht weitergeht?
In erster Linie wegen Philipp John. Er ist ein wunderschöner, lebendiger Knabe mit dem feurigen Temperament seiner Mutter. Er hat blond gelocktes Haar, ein gewinnendes Lächeln, strahlend blaugraue Augen, er ist gesund an Leib und Seele, und seine kleine Besonderheit, der elfte Zeh, stellt keinerlei Behinderung für den Knaben dar.
Er ist gesund an Leib und Seele, nicht aber in seinem Geiste. Philipp Johns Gehirn entwickelt sich langsamer als das anderer Kinder. Rosy und ich haben es sieben Monate nach seiner Geburt festgestellt. In der Folge wurden wir von den Ärzten vorsichtig damit konfrontiert, dass unser Kind besonders sein würde. Mittlerweile läuft Johnny balancesicher, er erklettert bis zu fünf Leitersprossen hintereinander und hüpft von den inneren Zinnen des Schlossturmes auf die Aussichtsplattform, körperlich eine normale Entwicklung. Mit Johnnys Sprache sieht es anders aus. Möglich, dass er die Bedeutung vieler Worte kennt, leider lässt er uns selten daran teilhaben. Seine kurzen Zweiwortsätze, auch die Ausrufe aus seinem Mund scheinen einer geheimen Urwaldsprache zu entstammen, grelle, gutturale Laute, Ausdruck der Freude oder des Ärgers. Zärtlich nennen wir ihn manchmal unseren Mogli, weil seine Ausdrucksweise anmutet, als ob er unter Wölfen aufwachsen würde. Wir bemühen uns, seiner Entwicklung mit Humor und Liebe zu begegnen, und können doch nicht verhindern, dass sein Zustand uns mitunter besorgt, ja traurig macht. Wenn ich Philipp John zusehe, wie er mit dem Löffel isst, bin ich zuversichtlich. Wenn er sein Porridge plötzlich über den Tisch verteilt und die Schüssel gegen die Wand wirft, wird aus Zuversicht Ratlosigkeit. Wenn solche Dinge passieren, bin ich fast immer mit ihm allein. Tagsüber ist Rosy auf Mörderjagd, und wenn sie heimkommt, schläft Johnny bereits.
Wir konnten ihn in keiner Kita für normale Kinder unterbringen, und in eine Tagesstätte für Behinderte will ich ihn nicht geben. Die einzige Konsequenz war daher, dass ich mich selbst um ihn kümmere. Ich bin der 36. Earl von Sutherly, mein Sohn wird eines Tages der 37. Earl sein, unsere Familie blickt auf einen neunhundertjährigen Stammbaum zurück. Die Escroynes kämpften an der Seite vieler britischer Könige, vertrieben die Waliser aus England und zwangen gemeinsam mit anderen Fürsten König John I., die Magna Carta zu unterzeichnen. Unsere Familientradition ist ehrwürdig und jahrhundertealt. Das bedeutet allerdings auch, dass die Gene der Escroynes nicht mehr die frischesten sind. Ich schreibe die Ursache für Philipp Johns Zustand daher keinem anderen zu als mir selbst. Rosy behauptet das Gegenteil. Sie meint, sie sei damals schon zu alt für die Mutterschaft gewesen. Ihre Krankheit während der Schwangerschaft und die extrem frühe Entbindung hätten zu Johnnys Besonderheit geführt. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Nachdem das Feuerzeugverbot von Philipp mit knurrendem Missfallen aufgenommen wurde, verzieht er sich in seinen Winkel und spielt mit den Dutzenden Superhelden, die während des letzten Jahres Dauergäste auf Sutherly Castle geworden sind. Wegen seiner Baufälligkeit sind auf dem Schloss nur noch drei Räume bewohnbar, daher konnten wir für ihn kein Kinderzimmer einrichten. Er muss sich mit der fensterseitigen Hälfte unseres Schlafzimmers begnügen.
Nach meiner geglückten Erziehungsmaßnahme atme ich zur Beruhigung tief durch und setze Wasser auf. Tee ist ein gutes Getränk, er gibt Kraft und hält einen alleinerziehenden Vater am Laufen. Bevor der kleine Urwaldmensch wieder meine volle Aufmerksamkeit beanspruchen wird, winkt mir eine kurze Auszeit, ein paar ruhige Minuten, um eine Tasse Darjeeling zu trinken.
»Ich habe keine Zeit. Am besten, Sie lassen sich einen Termin geben.« Rosy wirft die Lederjacke über die Schulter. Eigentlich ist es zu warm für das schwere Ding, das ich ihr vor Jahren geschenkt habe, als ich mein Motorrad verkaufte, doch ob Hitzewelle, Schneesturm oder Dauerregen, Rosy trennt sich von dieser Jacke so gut wie nie.
Der kräftige Kerl mit dem rötlichen Haar stellt sich der Chefkommissarin in den Weg. »Ein Termin wird nicht nötig sein.«
»Hören Sie, ich muss an einen Tatort.«
»Mord in den Docks«, erwidert er unbeeindruckt.
Rosy mustert den Eindringling genauer. Er ist mindestens sieben Fuß groß, Schultern wie Herkules, sein Brustkorb sprengt den irischen Schurwollpulli beinahe. Der Hals ist so breit, dass er übergangslos in den kreisrunden Schädel übergeht. Dazu ein rötlicher Dreitagesbart und braune Kulleraugen, die Rosy so drollig ansehen, dass sie schmunzelt. »Woher wissen Sie das?«
»Weil ich Sie gleich dorthin begleiten werde.« Der Hüne schüttelt Rosys Hand. Meine Frau hat kräftige, arbeitsame Hände, aber in den Pranken des Großen wirken sie wie die zierlichen Finger eines Handcreme-Models.
»Sind Sie der neue Polizeifotograf?«
»Ich bin Ihr neuer Assistent, Mrs Escroyne.«
»Die Aushilfe aus Cornwall?« Vor Überraschung vergisst Rosy ihre Hand zurückzuziehen. »Dann müssen Sie Sergeant Stinton sein.«
»Stanton, Larry Stanton. Und ich ziehe es vor, mich nicht als Aushilfe zu sehen.«
»Sie sind mir nur so lange zugeteilt, bis Sergeant Bellamy aus dem Krankenhaus entlassen wird.«
»Ist mir bekannt.« Stanton setzt ein Lächeln auf, wie man es aus Piratenfilmen kennt. Der Sergeant hat eine Menge Zähne im Mund, und jeder einzelne davon ist perlweiß.
»Wenn Sie wollen, können wir im Wagen weiterreden«, bietet er der Kommissarin an.
Rosy schätzt praktisch veranlagte Menschen, Stanton holt sich mit dieser Bemerkung einen Pluspunkt. »Wann sind Sie angekommen?« Im Gleichschritt verlassen die Detectives das Großraumbüro.
»Vor fünf Minuten.« Stanton hat die richtige Eingebung, dass Rosy nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe benutzen wird.
»Aus Cornwall?«
»Aus Cornwall.«
»Wie lange fährt man da, vier Stunden?«
»Wenn man sich an die Verkehrsregeln hält. Ich war spät dran und habe die Strecke in zweieinhalb gemacht.«
Sollte mein Aushilfsassistent ein Angeber sein?, überlegt Rosy. »Haben Sie schon eine Bleibe?«
»Die suche ich mir nachher.«
Sie treten ins Freie.
»Ich kenne Cornwall ein bisschen. Wo kommen Sie her?«
»Porthleven.«
»Nie gehört.«
»Sie kennen den schönsten Hafen im Vereinigten Königreich nicht? Die südlichste Bastion unserer Insel?«
Er ist ein Angeber, denkt Rosy und läuft auf den Dienstwagen zu.
»Was erwartet uns in den Docks?« Mit zwei kräftigen Schritten hat er sie eingeholt.
»Die Leiche von Mr Gordon Urquardt, der mit einer Stichwunde im Rücken noch zweihundert Yards weit gelaufen ist, bevor er am Pier zusammenbrach und starb.«
»Woher wissen wir, dass der Mann nach seiner Verletzung noch so weit kam?«
»Weil es in diesem Teil der Docks nur einen einzigen Pub gibt, wo Urquardt seinen Mantel hat hängen lassen.«
»Er könnte auch auf der Straße angegriffen worden sein.«
»Könnte er nicht. Einer unserer Constables sah Urquardt auf dem gegenüberliegenden Pier dahintaumeln.«
»Wieso hat der Polizist nicht eingegriffen?«
»Weil er dazu schwimmen hätte müssen. Die Hafenmündung liegt dazwischen.«
Als Rosy die Autotür öffnet, hält sie inne. »Was ist denn das für ein Monstrum?« Ihr Finger deutet auf einen prähistorischen VW-Bus auf dem Polizeiparkplatz, der bis unter das Dach vollgepackt ist.
»Mein Auto, meinen Sie?«, erwidert Stanton arglos.
»Wollen Sie für immer nach Gloucester übersiedeln?«
Er zeigt die Zähne. »Wissen Sie, ich habe meine wichtigsten Sachen immer gern um mich.«
Zehn Minuten später erreichen die Kommissarin und ihr Neuer die Docks von Gloucester. An den Ausmaßen der Hafenanlage erkennt man ihre einstige Bedeutung. Durch seine Verbindung zum Sharpness Kanal und damit zur Schifffahrt auf dem Fluss Severn war Gloucester bis ins zwanzigste Jahrhundert ein wichtiger Umschlagplatz. Nach dem Ersten Weltkrieg schwand die Bedeutung des Hafens, die Lagerhäuser und Speicher verfielen, bis gegen Ende der Achtzigerjahre die Renovierung des Stadtteils neues Leben in das Viertel brachte. Rosy hält im ältesten Teil der Docks, der noch nicht durch Apartments und Shopmeilen dem Stil der Zeit angepasst wurde.
Ein junger Constable schildert ihr, wie er auf seinem Rundgang durch die Hafengegend einen Mann beobachtete, den er zunächst für betrunken hielt, der aber plötzlich auf die Knie sank, sein Handy aus der Sakkotasche nahm, eine Nummer tippte und auf dem Pflaster telefonierte.
»Das Hafenbecken ist zweihundert Yards breit, und es war bereits Nacht«, entgegnet Rosy. »Trotzdem wollen Sie das so genau beobachtet haben?«
»Der Mann kniete dort unter der Laterne«, erklärt der Constable.
Rosy wendet sich an das Duo der Spurensicherung. »Wurde Urquardts Handy gefunden?«
Innerhalb der Mordkommission heißen die beiden Gentlemen der Onkel und der Neffe.
»Fehlanzeige bis jetzt«, antwortet der kahlköpfige Onkel.
»Fehlanzeige«, echot der schlaksige Neffe.
»Hatte der Tote sein Sakko noch an?«, fragt Rosy Jock, den unverwüstlichen Polizeiarzt, der von Gesetzes wegen längst im Ruhestand sein müsste, doch gute Forensiker sind Mangelware.
Jock nickt. »Der Messerstich ging durch das Sakko hindurch. Nicht aber durch seinen Mantel, denn der hing ja im Pub.«
»Heißt das, er könnte im Pub erstochen worden sein und rettete sich danach ins Freie?«
»Möglich.«
Eine Windbö bläst Rosy das Haar ins Gesicht. »Wenn er seine Jacke noch anhatte, wo ist dann Urquardts Handy abgeblieben?«
»Ich habe …«, will der junge Constable einwerfen.
»Leider kein Handy.« Der Onkel schüttelt den Kopf. »Weder bei der Leiche noch in der unmittelbaren Umgebung.«
»Kein Handy«, gibt auch der Neffe zu.
»Ich kann das erklären«, versucht es der Constable ein zweites Mal. »Ich habe beobachtet, wie der kniende Mann sein Telefon nach dem Gespräch ins Wasser geworfen hat.«
»Das sagen Sie erst jetzt?«, blafft Rosy ihn an.
»Da werden wir Taucher brauchen«, lässt sich der Sergeant vernehmen.
»Immer langsam.« Ein irritierter Blick von Rosy. »Zunächst vernehmen wir die Leute im Pub. Haben Sie dafür gesorgt, dass keiner das Lokal verlässt?«
»Ich habe vier Mann Verstärkung angefordert«, nickt der Constable. »Da geht keiner raus oder rein.«
»Was wollen die vielen Leute vor der Kneipe?« Rosy macht die ersten Schritte auf das Lokal zu.
»Schaulustige.«
Die Kommissarin gibt dem Onkel ein Zeichen. »Mach Fotos von den Leuten.«
»Wozu?«
»Weil der Mörder dort noch herumstehen könnte.«
»Prima Idee, Rosy.« Der Onkel zückt die Kamera.

Wasserfall
Da haut einer ab!« Gerade hat der Onkel zu knipsen begonnen, als ein junger Mann in der Menge seine Mütze in die Stirn zieht, sich zwischen den Umstehenden hindurchdrängt und die Beine in die Hand nimmt. Er rennt in die Richtung, wo die Gewässer der Hafenanlage dem Fluss zugeführt werden, der nach zahllosen Mäandern in die Severn Beach, von dort in den Bristol Channel mündet und sich schließlich in die Irische See ergießt.
So weit kommt der Flüchtende allerdings nicht. Eine unerwartete sportliche Leistung macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Nachdem Sergeant Stanton hinter Rosy zurückgeblieben war, um seinen Schnürsenkel zu binden, setzt er unvermittelt zu einem Sprint an, den man dem schweren Mann nicht zutrauen würde. Mit mächtigen Sprüngen rennt Stanton hinter dem zierlichen Kerl her, der schon einen ordentlichen Vorsprung hat. Der Mann aus Cornwall und der Kleine rennen dicht am Wasser entlang. Rosy, der Rest ihrer Crew und die Schaulustigen werden Zeugen des Wettlaufs.
Die Distanz zwischen beiden verkleinert sich, der Flüchtende bemerkt den Verfolger und schlägt einen Haken zu den Anlegestegen der privaten Bootsbesitzer. Zwischen Ausflugsbooten, kleinen Jachten und Fischkuttern führt die Jagd über den Mittelsteg dahin. Sollte der Fliehende das andere Ende erreichen, könnte er dahinter in den verwinkelten Gassen entkommen.
Das begreift auch der Sergeant und forciert das Tempo. Den Oberkörper vorgeneigt, gehen seine Arme wie geölte Kolben hin und her, während die Beine weit ausgreifen.
»Wer ist denn dieser Olympionike?«, fragt der Polizeiarzt, während er neben Rosy tritt.
»Das ist Sergeant Stanton.«
»Und was will der bei uns?«
»Mir bei der Arbeit helfen.«
»So einen hatten wir hier noch nicht«, meint Jock versonnen. Im selben Augenblick setzt Stanton auf dem Steg zum Sprung an.
»Ja, so einen hatten wir noch nicht.« Mit großen Augen beobachtet Rosy, wie ihr neuer Assistent sich von hinten auf den kleinen Mann stürzt, der das Gleichgewicht verliert, wie beide zur Kante des Steges taumeln, den Schwung des Sturzes nicht bremsen können und ineinander verkeilt ins brackige Wasser des Hafenbeckens stürzen.
»Erstklassiges Tackling«, bemerkt der Onkel und macht trotz der Entfernung einen Schnappschuss von der Szene.
»Erstklassig«, bestätigt der Neffe.
»Bewegung, Leute, holt sie da raus!« Rosy schickt die Constables los. »Hast du Decken im Auto?«, fragt sie den Polizeiarzt.
Wenig später sitzen die Kontrahenten des Wettlaufs friedlich im Dragon und trinken Tee mit Whisky. Larry Stanton ist aus eigener Kraft aus dem Hafenbecken geklettert, dem jungen Mann musste geholfen werden. Darauf brachte man ihn zu Detective Inspector Rosemary Escroyne. Als die Kommissarin ihm eine Decke um die Schultern legte, erlebte sie eine Überraschung. Der Jüngling war falsch.
»Das ist eine Frau«, sagt der Onkel mit bestechender Logik.
»’ne Lady«, variiert der Neffe verblüfft.
»Natürlich bin ich eine Frau«, erwidert die durchnässte Person.
»Das war ein erstaunlicher Sprint, Sergeant.« Rosy gibt Stanton eine dampfende Tasse.
»Zu Hause renne ich täglich zehn Meilen über den Coastal Path.« In nassem Zustand wirkt Stantons rötliches Haar dunkler, dem schweren Wollpulli ist das Bad nicht bekommen, er hängt ihm bis tief über die Hüften.
Rosemary setzt sich der jungen Frau gegenüber. »Können Sie sich ausweisen?«
Beim Sturz ins Wasser hat sie ihre Mütze verloren. Ihr Haar ist dunkel und kurz geschnitten, sie hat einen zierlichen Hals. Wortlos zieht sie den Ausweis aus der Tasche.
»Erin Byrne«, liest Rosy vor. »Sie stammen nicht von hier.«
»Ich bin in Kenmare Neidin geboren.«
»Irland?« Die andere nickt. »Was wollten Sie vor dem Pub, und weshalb sind Sie weggelaufen?«
»Wegen Gordon.«
»Gordon Urquardt? Sie kannten Mr Urquardt?«
»Er ist mein Onkel.«
Die Kommissarin und der Sergeant tauschen einen Blick aus. »Sie wissen, was mit Ihrem Onkel geschah?«
»Er ist tot.«
»Haben Sie gesehen, wie er starb?«
»Nein.« Für einen Moment hebt Miss Byrne den Kopf und mustert Rosy, den durchnässten Sergeant und im Hintergrund einen jungen Mann mit schwarzem Vollbart, den Wirt des Dragon. »Ich kam erst her, als Alec mich angerufen hat.«
»Alec?« Rosy dreht sich um. »Das sind Sie, nicht wahr?«
»Alec Henderson«, bestätigt der Wirt. »Als die Polizei reinkam und sagte, da draußen liegt ein Toter am Pier, bin ich hinausgelaufen und sah, dass es Mr Urquardt war. Darauf habe ich Erin verständigt.«
»Wieso haben Sie das getan? Ich meine, wie gut kannten Sie Mr Urquardt?«
»Gordon war häufig hier.« Henderson wischt mit dem Lappen über den Tresen. »Meistens in Gesellschaft von Erin.«
»Und Sie kannten auch Miss Byrne so gut, dass Sie ihre Telefonnummer gleich zur Hand hatten?«
»Ist das verboten?«
Erin Byrne kommt dem Wirt zu Hilfe. »Ich habe ihm meine Nummer gegeben.«
»Weshalb?«
»Onkel Gordon ging es in letzter Zeit nicht besonders. Wenn er nachts loszog, um sich zu besaufen, wollte ich wissen, wo er ist.«
»Stammt Ihr Onkel auch aus Irland?«
»Unsere ganze Familie kommt aus Kenmare Neidin. Gordon ist allerdings vor Jahren nach England gezogen und hat hier geheiratet.«
»Standen Sie in engem Kontakt zu ihm?«
»Wir haben lange nichts voneinander gehört. Erst vor einem Jahr hat er mich angerufen.«
»Weshalb?«
»Weil er am Ende war.«
»In welcher Beziehung?«
»In jeder Beziehung. Besonders, was seine Beziehung betraf.«
Rosy wendet sich an Jock. »Hat schon jemand die Ehefrau verständigt?«
»Das habe ich gemacht«, meldet sich der Wirt zu Wort.
»Schon wieder Sie, Mr Henderson? Sie scheinen die wichtigste Kontaktperson zur Familie Urquardt zu sein.«
»Man kennt sich eben.«
»Sie kennen also auch Mrs Urquardt? Ist sie ebenfalls öfter im Pub?«
»Sicher«, antwortet der Wirt nach kurzem Bedenken.
»Da kann es um die Ehe der Urquardts ja nicht so schlecht bestellt gewesen sein«, wirft Sergeant Stanton ein, »wenn sie noch zusammen ausgingen.«
Darauf schweigen sowohl Miss Byrne als auch Mr Henderson.
»Was machen Sie beruflich, Miss Byrne? Ich meine, wieso können Sie aus Irland wochenlang wegbleiben?«
»Ich bin Pharmazeutin, habe derzeit aber keine Anstellung.«
»Weshalb sind Sie vorhin weggelaufen?«
»Weil ich mit dem Mord nichts zu tun habe.«
»Das hätte Ihnen auch niemand vorgeworfen. Woher wussten Sie überhaupt, dass es Mord war? Das lag nicht auf der Hand. Die Spurensicherung ist gerade erst eingetroffen.«
»Dort, wo Gordon lag, war Blut auf dem Pflaster.«
»Bitte beantworten Sie meine Frage. Warum sind Sie abgehauen?«
Die junge Frau beginnt übergangslos zu weinen. Sie macht keine dramatische Szene daraus, aus ihren Augen fließen einfach die Tränen. »Ich wollte Gordon nicht so sehen. Ich fand es grauenhaft und schrecklich. Deshalb bin ich fortgerannt.«
»Was fanden Sie denn so schrecklich, Miss Byrne?«
»Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Was ich auch versucht habe, ich konnte Gordon nicht helfen. Es hat mich traurig gemacht, dass er diese dunkle Straße hinunterging, von der es kein Zurück mehr gibt.«
»Die dunkle Straße? Das hört sich an, als ob Ihr Onkel Selbstmord begangen hätte. In Wirklichkeit ist er hinterrücks erstochen worden.«
»In seinem Fall war es das Gleiche«, flüstert Erin Byrne.
Auf diesen erstaunlichen Satz hin schweigen zunächst alle im Lokal.
»Wollen Sie behaupten, Mr Urquardt wollte mit dem Leben abschließen?«
Erin hebt den Kopf. »Das habe ich nicht gesagt.«
»In gewisser Weise haben Sie das gerade getan.«
»Ich weiß nicht, wer Gordon umgebracht hat.« Erin wischt sich die Tränen ab.
»Aber irgendetwas wissen Sie, Miss Byrne.«
»Eines weiß ich«, gibt sie offenherzig zu. »Wenn das Unglück einen Menschen mit Macht überfällt, wie es bei Gordon geschah, dann höhlt das Unglück diesen Menschen nach und nach aus. So lange, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Wer auch immer zugestochen hat, wer immer das Messer gegen Gordon gezückt hat, der hat es in einen leeren Körper hineingestoßen. Denn von Gordon Urquardt ist schon lange nichts mehr übrig gewesen.«

Kein Kuss
Sergeant Stanton zuckt die Schultern. »Wenn Miss Byrne die Wahrheit sagt, wurde Urquardt von seiner Frau betrogen. Das kommt in den besten Familien vor. Ist das ein Grund, sich derart fallen zu lassen?«
»Bei manchen Menschen ist das Grund genug.« Rosy schmunzelt über Stantons Aufzug. Da er das Innenleben seines vollgeräumten Wagens nicht durcheinanderbringen wollte, hat er das Erstbeste an trockenen Kleidern hervorgeholt, das er finden konnte: eine Latzhose, ein T-Shirt und eine ärmellose Weste, wie die Fischer sie tragen.
»Sie sehen aus wie Huckleberry Finn«, witzelt Rosy.
»’tschuldigung, Chef, es ist schließlich mein erster Tag. Morgen komme ich in vorschriftsmäßiger Dienstkleidung aufs Revier.«
»Sie haben sich an Ihrem ersten Tag erstklassig geschlagen.« Rosy sinkt in den Sessel hinter ihrem Schreibtisch. »Solange Mrs Urquardt nirgends zu erreichen ist, müssen wir uns an die Leute halten, die im Pub waren, bevor der Mord geschah.« Sie wirft einen Blick durch die Scheibe des Großraumbüros. Zwei ältere Frauen starren im grellen Kunstlicht trübe vor sich hin. »Ich bezweifle allerdings, ob da draußen unsere Mörderinnen sitzen.«
Rosy schlägt die noch reichlich dünne Akte auf. »Angeblich kam Urquardt um sieben Uhr abends in den Dragon und trank Whisky. Gegen halb neun wurde er von jemandem angerufen. Er wollte das Telefonat scheinbar lieber ohne Zeugen führen und ging nach draußen. Danach wurde er lebend nur noch von unserem Constable gesehen. Zehn Minuten nachdem Urquardt das Dragon verlassen hatte, war er tot.«
Stanton nimmt Rosy gegenüber Platz. Der Stuhl knackt, als er sein Gewicht darauf sinken lässt. »Wenn die Tat im Freien geschah, muss sie verübt worden sein, nachdem Urquardt das Lokal verlassen hatte, aber noch bevor der Constable den verletzten Urquardt gesehen hat.«
»Ich habe die infrage kommenden Messer aus dem Pub einsammeln lassen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass wir darunter die Tatwaffe finden.«
»Die liegt vermutlich auf dem Grund des Hafenbeckens, genau wie Urquardts Handy.«
»Mit den Tauchern hatten Sie übrigens die richtige Idee.« Rosy trommelt auf die Tischplatte. »Bloß müssen wir bis morgen warten, bevor wir da jemanden runterschicken.«
»Und was haben wir heute Nacht noch weiter vor?«, fragt Stanton mit Blick zur Wanduhr.
»Gar nichts. Ich werde heimfahren und meinem schlafenden Jungen einen Kuss geben. Und Sie suchen sich eine Bleibe. Ich habe Ihnen eine Liste zusammenstellen lassen, wer in der Gegend Zimmer vermietet.«
»Danke, Mrs Escroyne.«
»Haben Sie auch Kinder?«
»Ich hatte einmal … Nein, ich habe keine.«
Sie steht auf und zieht ihre Jacke an. »Das mit Mrs Escroyne lassen wir besser gleich. Ich heiße Rosy. Und ich werde Sie Larry nennen.«
»Einverstanden, Rosy. Was fehlt Ihrem Assistenten? Warum kommt er so lange nicht zum Dienst?«
»Das erzähle ich Ihnen morgen, Larry.« Rosy verlässt das Büro und gibt dem Wachhabenden Anweisung, die beiden Zeuginnen nach Hause zu schicken.
Sergeant Ralph Bellamy, Rosys langjähriger, petersilienhafter Assistent, liegt wegen einer Rückenmarkserkrankung im Hospital, wo man herauszukriegen versucht, ob es etwas Ernsthaftes ist. Nach allem, was ich darüber weiß, hege ich den Verdacht, dass Ralphs Knochen deshalb zusammengeklappt sind, weil seine Frau Doris ihn nach zweiundzwanzigjähriger Ehe verlassen hat. Der sanfte, positive Ralph konnte das einfach nicht verkraften. Doris war der andere Teil seines Lebens, trotzdem sagte sie ihm nach zweiundzwanzig Jahren: Ich brauche einen neuen Impuls, packte die Koffer, verzichtete auf die Hälfte des Hauses, gab den beiden halbwüchsigen Kindern ihre Telefonnummer und verließ die Grafschaft, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Ralphs Zusammenbruch passierte wenig später.
Als Rosy nach Hause kommt, schläft Philipp John natürlich, während ich wach liege und über Ralphs Schicksal nachdenke. Lernen wir daraus, dass es im Leben meistens launisch und ungerecht zugeht und dass man nichts in diesem Dasein festhalten kann? Ich schaue zum Halbmond empor, der unverfroren durch das Fenster unseres Turmes scheint, den wir zum Schlaf- und Kinderzimmer erkoren haben. Gäbe es irgendeinen Umstand, der imstande wäre, Rosy und mich auseinanderzubringen? Ich liebe Rosemary, sie ist das größte Glück, das einem trüben Adelsspross wie mir begegnen konnte. Diese lebensbejahende, kraftvolle Frau ist der Pfeffer und das Salz in der dünnen Lebenssuppe eines Escroyne. Im ersten Jahr nach Philipp Johns Geburt habe ich uns felsenfest für das glücklichste Paar in Gloucestershire gehalten. Zwei weitere Jahre sind inzwischen vergangen; wie sieht es heute mit meiner Bestandsaufnahme aus? Ich bin ausgelaugt, missmutig und erschöpft – tatsächlich ist Erschöpfung das derzeit vorherrschende Gefühl in unserer Beziehung.
Ich sehe Rosy kaum noch. Nicht nur, weil sie wieder berufstätig ist, sondern weil sie sich verändert hat. Ich gönne ihr die wiedergewonnene Freude an ihrem Job, doch mittlerweile geht sie vollkommen darin auf. Für unsere Partnerschaft bedeutet das, dass meine vor Energie strotzende Frau das Leben täglich aus den Angeln hebt, während ihr Mann sich um die Alltagsprobleme eines kleinen behinderten Jungen kümmert.
Während solcher zweiflerischer Gedanken höre ich Rosy draußen die einhundertsechs Stufen zur Pforte von Sutherly Castle hochsteigen, aufschließen, die schweren Schuhe abstreifen, die Jacke aufhängen und zu mir ins Schlafzimmer schleichen.
»Schläft er?«, fragt sie, obwohl Johnnys gleichmäßige Atemzüge ihr die Antwort geben. Sie beugt sich zu ihm, küsst den Jungen zärtlich und deckt ihn zu.
»War heute Abend alles okay bei euch?« Ohne meine Antwort abzuwarten, schlüpft sie ins Bad.
Rosy hat mich nicht geküsst! Sie hat mich heute den dritten Abend in Folge nicht geküsst. Das mag noch kein Alarmsignal sein, aber ich kann es auch nicht länger übersehen.
»Rosy, wir müssen reden«, sage ich, als sie im Nachthemd aus dem Bad kommt und sich auf die andere Bettseite fallen lässt.
»Lieber morgen, Arthur. Heute bin ich so wahnsinnig müde, dass ich nur noch schlafen möchte.«
Ich beuge mich zu ihr und küsse sie sanft. »Natürlich.« Ich erwarte, zurückgeküsst zu werden, bekomme aber nur einen flüchtigen Schmatz auf die Wange.
Rosys Wecker ist auf 06:45 eingestellt, was eigentlich überflüssig ist, da Philipp John um 06:00 Uhr aufwacht. Rosy kuschelt dann noch ein wenig mit ihm und macht Frühstück. Sie selbst trinkt nur schwarzen Kaffee. Voll Tatendrang läuft sie aus dem Haus. Ich dagegen werde mich als Erstes mit Johnnys Morgenwindel beschäftigen. Ich betrachte Rosy neben mir. Meine Schwertlilie, der Glanz meines Lebens ist eingeschlafen. Ihr Atem bewegt eine Haarlocke vor ihrer Nase.
Am nächsten Morgen habe ich vor, Entscheidendes an unseren Gewohnheiten zu ändern. Ich stehe um 05:46 auf, hole Johnny, der ein fröhliches Morgenkind ist, aus dem Bett und mache ihn frisch. Während er mit seinen Superhelden spielt und einen aus der Plastiktruppe der Giganten kurzerhand aus dem Fenster wirft, tische ich ein reichliches Frühstück mit Ziegenkäse, Honig, Trauben und Corned Beef auf. Nachdem Rosys Morgengeräusche im Bad verklungen sind, erscheint sie, überrascht über uns Frühaufsteher, und setzt sich an den Tisch.
»Wie schön das aussieht.« Rosy kann sich schwer entscheiden, womit sie beginnen soll.
»Hast du einen neuen Fall?«, beginne ich.
»Ein Ire, der nach England zog, hier aber nicht glücklich wurde, ist erstochen worden. Was wir bis jetzt haben, ist ein zwielichtiger Pub und eine aufopfernde Nichte.«
»Pub, Pab, Papp«, bringt sich Philipp John in das Gespräch ein.
Ich schiebe Rosy den Ziegenkäse hin.
»Der ist neu. Woher hast du den?«
»Den gab es gestern auf dem Markt.«
Rosy kaut und genießt. »Ja, richtig, gestern ist die Aushilfe für Ralph aus Cornwall eingetroffen.«
»Das stelle ich mir hart vor, in Ralphs Fußstapfen zu treten. Wirst du mit dem Neuen klarkommen?«
»Ich habe den Verdacht, dass er ein Angeber ist. Aber er hat was drauf. Rennen kann er zum Beispiel wie ein Olympionike.«
»Das Wort hast du noch nie verwendet«, erwidere ich überrascht. »In unserer achtjährigen Beziehung ist das Wort Olympionike noch nie gefallen. Ein Grund zu feiern.«
Wir stoßen mit den Kaffeetassen an. Im Anschluss schenkt mir Rosy das, worauf ich so sehnlich gewartet habe, ihr Schwertlilienlächeln. Ich habe es mehrmals erwähnt und tue es gern noch einmal. Rosemary ist die Schwertlilie meines Lebens. Die scharf gezähnten Blütenblätter dieser Blume beschreiben Rosys brillanten Verstand, blauviolett wie die Lilie sind ihre Augen. Ihr Blick dringt tief. Sie sieht vieles, was für andere verborgen bleibt. Rosy ist die stolzeste Blume meines Gartens.
»Ich werde heute im Garten arbeiten«, kündige ich an.
»Du hast vielleicht ein prima Leben.« Krachend beißt sie in das getoastete Hörnchen.
»Und Johnny hilft mir dabei. Stimmt’s?«
Als Antwort kommt ein Dschungelruf.
»Wie gern würde ich euch Gesellschaft leisten.« Rosy schaut auf die Küchenuhr.
»Lügnerin. Du freust dich doch, in diesen zwielichtigen Pub zu fahren und gemeinsam mit dem Olympioniken die aufopfernde Nichte zu vernehmen.«
»Es kommt noch besser«, erwidert sie schlagfertig. »Heute werde ich Männern in hautengen Gummianzügen Befehle erteilen. Ich habe die Taucherstaffel in die Docks beordert.«
»Was sollen die Männer in den hautengen Anzügen denn dort finden?«
»Möglicherweise eine Tatwaffe und hoffentlich ein Handy.«
So mag ich das. So muss ein Morgen zwischen Rosy und mir beginnen. Weil ich das hingekriegt habe, gibt es zum Abschied einen kräftigen, innigen Kuss zwischen den Eheleuten Escroyne. Nicht als alleinerziehender Vater stehe ich schließlich am Burgtor und winke der scheidenden Kommissarin nach, sondern als 36. Earl, Schlossherr von Sutherly. Als der designierte 37. Earl Anstalten macht, hinter seiner Mutter herzulaufen, hebe ich ihn kurzerhand über meinen Kopf und setze ihn auf die Schultern.
»Jetzt gehen wir in den Garten, junger Mann.«
»Bäume abhacken?«
»Das lassen wir schön bleiben.«
Ich bringe das Kunststück fertig, mit Johnny auf dem Rücken in meine Gummistiefel zu schlüpfen. »Weil wir froh sind, dass hier oben überhaupt Bäume wachsen. Die werden nicht abgehackt.«
Als ich die Tür zum Garten aufstoße, fallen alle trüben Zweifel von mir ab. Da liegt meine ganze Freude vor mir, der Ausdruck meiner Seele. Nichts auf Erden kann schöner sein als der Schlossgarten von Sutherly Castle im Frühling.