

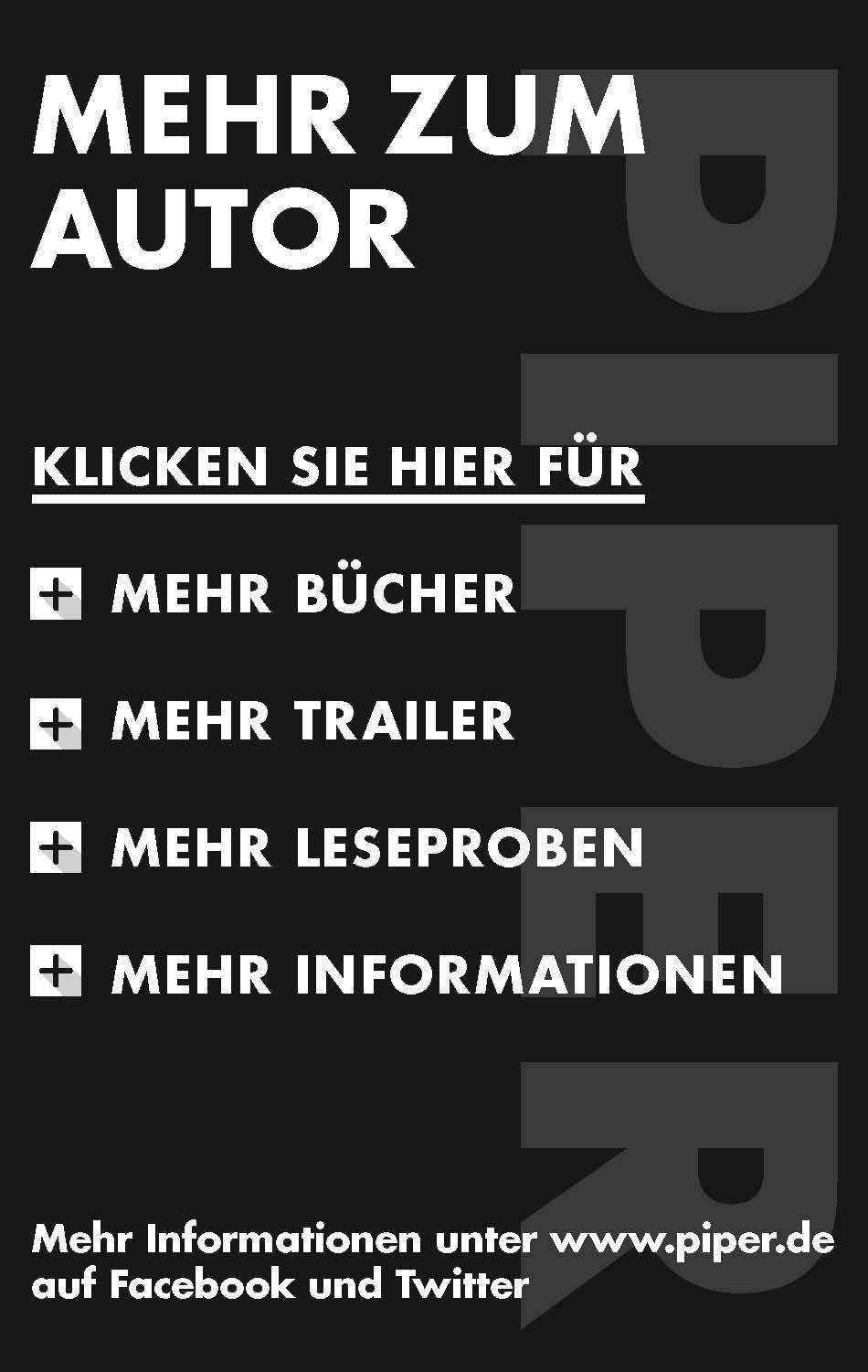
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Ingrid
und Nathan
Übersetzung aus Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge, Kollektiv Druck-Reif
ISBN 978-3-492-96588-0
Mai 2017
© XO Éditions, Paris 2016
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: gettyimages/LT Photo und gettyimages/Jordan Siemens
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Auf und davon ...
Antibes,
Mittwoch, 31. August 2016
Drei Wochen vor unserer Hochzeit kündigte sich dieses lange Wochenende wie ein kostbares Intermezzo an – ein Moment der Intimität unter der Spätsommersonne der Côte d’Azur.
Der Abend hatte wunderbar begonnen: Spaziergang auf der Befestigungsmauer der Altstadt, ein Glas Merlot auf einer Terrasse und ein Teller Spaghetti mit Venusmuscheln unter dem steinernen Gewölbe des Michelangelo. Wir hatten über deinen Beruf gesprochen und über meinen und auch über die bevorstehende Zeremonie, die im kleinsten Rahmen geplant war. Zwei Freunde als Trauzeugen und mein Sohn Theo zum Beifallklatschen.
Auf dem Rückweg fuhr ich mit unserem gemieteten Cabrio langsam über die kurvenreiche Küstenstraße, damit du die Aussicht auf die kleinen Buchten des Kaps genießen konntest. Ich erinnere mich genau an diesen Augenblick: an deine klaren smaragdgrünen Augen, deinen unkonventionellen Haarknoten, deinen kurzen Rock, deine dünne Lederjacke, die du offen über einem kräftig gelben T-Shirt mit dem Slogan »Power to the people« trugst. Wenn ich in den Kurven schalten musste, betrachtete ich deine gebräunten Beine, wir tauschten ein Lächeln aus, du trällertest einen alten Hit von Aretha Franklin. Alles war gut. Die Luft war mild und erfrischend. Ich erinnere mich genau an diesen Moment: an das Funkeln in deinen Augen, dein strahlendes Gesicht, deine Haarsträhnen, die im Wind flatterten, deine Finger, die auf dem Armaturenbrett den Takt klopften.
Die Villa, die wir gemietet hatten, lag in der Domaine des Pêcheurs de Perles, einer geschmackvollen Wohnanlage mit einem Dutzend Häuser oberhalb des Meers. Während wir die Kiesallee durch den duftenden Pinienwald hinauffuhren, hast du beim Anblick des spektakulären Panoramas vor Begeisterung die Augen aufgerissen.
Ich erinnere mich genau an diesen Moment: Es war das letzte Mal, dass wir glücklich waren.
—
Das Zirpen der Grillen. Das Wiegenlied der Brandung. Die leichte Brise, die seidige feuchte Luft.
Auf der Terrasse, die sich zum Felsrand hin erstreckte, hattest du Duftkerzen und Windlichter angezündet, die die Mücken vertreiben sollten, ich hatte eine CD von Charlie Haden aufgelegt. Wie in einem Roman von F. Scott Fitzgerald hatte ich mich hinter die Theke der Freiluftbar begeben, wo ich uns einen Cocktail mixte. Deinen Lieblingscocktail: einen Long Island Iced Tea mit viel Eis und einer Limettenscheibe.
Selten hatte ich dich so heiter gesehen. Wir hätten einen schönen Abend verbringen können. Wir hätten einen schönen Abend verbringen müssen. Stattdessen war ich von einem Gedanken wie besessen, der mir seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Kopf ging, den ich bislang jedoch unterdrückt hatte: »Weißt du, Anna, wir dürfen keine Geheimnisse voreinander haben.«
Warum stieg diese Angst, dich nicht wirklich zu kennen, ausgerechnet an diesem Abend wieder in mir hoch? War es die kurz bevorstehende Hochzeit? Die Angst vor diesem Schritt? Das Tempo, in dem wir beschlossen hatten, uns zu binden? Sicher eine Mischung aus allem, wobei meine eigene Geschichte noch hinzukam, die durch den Verrat von Menschen geprägt war, die ich zu kennen geglaubt hatte.
Ich reichte dir dein Glas und nahm dir gegenüber Platz.
»Ich meine es ernst, Anna. Ich will nicht mit einer Lüge leben.«
»Das trifft sich gut, ich nämlich auch nicht. Aber nicht mit einer Lüge zu leben, das bedeutet nicht, keine Geheimnisse zu haben.«
»Du gibst es also zu: Du hast welche!«
»Aber alle haben doch Geheimnisse, Raphaël! Und das ist auch gut so. Unsere Geheimnisse prägen uns. Sie sind ein Teil unserer Identität, unserer Geschichte, unserer Rätselhaftigkeit.«
»Ich habe keine Geheimnisse vor dir.«
»Ach, das solltest du aber!«
Du warst enttäuscht und wütend. Und ich war es auch. Die ganze Freude und gute Laune vom Beginn dieses Abends waren verflogen.Wir hätten das Gespräch an dieser Stelle abbrechen müssen, aber ich ließ nicht locker, wobei ich sämtliche Argumente aufbot, um zu der Frage zu kommen, die mich nicht losließ.
»Warum weichst du mir immer aus, wenn ich etwas über deine Vergangenheit wissen möchte?«
»Weil die Vergangenheit definitionsgemäß vergangen ist. Man kann sie nicht mehr rückgängig machen.«
Ich reagierte gereizt.
»Du weißt genauso gut wie ich, dass die Vergangenheit Aufschluss über die Gegenwart gibt. Was, um Himmels willen, versuchst du vor mir zu verbergen?«
»Nichts, was unserer Beziehung gefährlich werden könnte. Vertrau mir! Vertrau uns!«
»Hör auf mit diesen Floskeln!«
Ich hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen, woraufhin du zusammengezuckt warst. Dein schönes Gesicht veränderte sich und zeigte jetzt einen Ausdruck von Hilflosigkeit und Angst.
Ich war wütend, weil ich unbedingt beruhigt werden wollte. Ich kannte dich erst seit sechs Monaten, und seit unserer ersten Begegnung hatte ich alles an dir geliebt. Aber ein Teil dessen, was mich anfangs betört hatte – deine Rätselhaftigkeit, deine Reserviertheit, deine Diskretion, deine Zurückhaltung –, waren jetzt Anlass zu einer Angst geworden, die mich fest im Griff hatte.
»Warum willst du unbedingt alles verderben?«, fragtest du, und in deiner Stimme lag Überdruss.
»Du kennst mein Leben. Ich habe mich schon ein Mal getäuscht und kann mir keinen Irrtum mehr erlauben.«
Ich wusste, wie sehr ich dir wehtat, aber ich hatte das Gefühl, ich würde alles hören können, würde aus Liebe zu dir alles ertragen. Solltest du mir etwas Schmerzliches zu gestehen haben, würde ich die Last mit dir teilen und sie damit für dich erleichtern.
Ich hätte den Rückzug antreten und aufhören sollen, aber die Diskussion ging weiter. Und ich habe dir nichts erspart. Denn ich spürte, dass du mir dieses Mal etwas anvertrauen würdest. Also habe ich meine Pfeile systematisch platziert, um dich so zu erschöpfen, dass du dich nicht mehr verteidigen würdest.
»Ich suche nur die Wahrheit, Anna.«
»Die Wahrheit! Die Wahrheit! Du führst dieses Wort im Mund, aber hast du dich jemals gefragt, ob du in der Lage wärst, die Wahrheit auch zu ertragen?«
Dieses Wortgefecht säte Zweifel in mir. Ich erkannte dich nicht wieder. Dein Eyeliner war verlaufen, und in deinen Augen brannte ein Feuer, das ich bisher noch nicht gesehen hatte.
»Du willst wissen, ob ich ein Geheimnis habe, Raphaël? Die Antwort lautet: Ja! Du willst wissen, warum ich nicht mit dir darüber sprechen will: Weil du, sobald du es kennst, nicht nur aufhören wirst, mich zu lieben, sondern mich sogar verabscheuen wirst.«
»Das stimmt nicht, du kannst mir alles sagen.«
Zumindest war ich in diesem Moment felsenfest davon überzeugt, dass nichts, was du mir enthüllen würdest, mich erschüttern könnte.
»Nein, Raphaël, das sind nur leere Worte! Worte, wie du sie in deinen Romanen schreibst, aber die Wirklichkeit ist stärker als Worte.«
Irgendetwas hatte sich verändert. Ein Damm war gebrochen. Jetzt begriff ich, dass auch du dich fragtest, wie viel Mut ich tatsächlich hatte. Auch du wolltest es jetzt wissen. Ob du mich immer lieben würdest, ob ich dich genügend liebte. Ob unsere Beziehung der Granate, die du zünden würdest, standhielte. Dann hast du in deiner Handtasche gewühlt und dein Tablet herausgeholt. Du hast ein Passwort eingegeben und die Foto-App geöffnet. Langsam hast du dich durch die Bilder gescrollt, um ein bestimmtes Foto zu finden. Du hast mir fest in die Augen geblickt, einige Worte gemurmelt und mir das Tablet gereicht. Und ich sah das Geheimnis vor mir, dessen Enthüllung ich dir abgerungen hatte.
»Das habe ich getan«, wiederholtest du mehrmals.
Wie vor den Kopf geschlagen, starrte ich mit leicht zusammengekniffenen Augen auf das Display, bis es mir den Magen umdrehte und ich mich abwenden musste. Ein Frösteln durchlief meinen Körper. Meine Hände zitterten, das Blut pochte mir in den Schläfen. Mit allem hatte ich gerechnet. Ich glaubte, alles im Voraus bedacht zu haben. Aber niemals wäre ich auf diesen Gedanken gekommen.
Mit weichen Knien stand ich auf. Von Schwindel ergriffen, schwankte ich, aber ich zwang mich, mit festem Schritt das Wohnzimmer zu verlassen.
Meine Reisetasche stand noch im Eingang. Ohne dich auch nur anzusehen, nahm ich sie und verließ das Haus.
—
Fassungslosigkeit. Gänsehaut. Aufsteigende Übelkeit. Schweißtropfen, die meinen Blick trübten.
Ich schlug die Tür des Cabrios zu und fuhr wie ferngesteuert durch die Nacht. Wut und Verbitterung tobten in mir. In meinem Kopf drehte sich alles: die Brutalität des Fotos, Verständnislosigkeit, das Gefühl, dass mein Leben in Scherben vor mir lag.
Nach einigen Kilometern bemerkte ich die gedrungene Silhouette des Fort Carré, auf einem Hügel hinter dem Hafen erbaut, um die Stadt zu verteidigen.
Nein. So konnte ich nicht gehen. Ich bedauerte mein Verhalten bereits. Unter dem Schock hatte ich die Fassung verloren, aber ich konnte nicht verschwinden, ohne mir deine Erklärungen anzuhören.
Ich trat auf die Bremse und wendete mitten auf der Straße, wobei ich auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und beinahe mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen wäre, der in der Gegenrichtung fuhr.
Ich musste dich dabei unterstützen, diesen Albtraum aus deinem Leben zu verjagen. Ich musste mich so verhalten, wie ich es versprochen hatte, musste deinen Schmerz verstehen, ihn mit dir teilen und dir helfen, ihn zu überwinden. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr ich die Straße zurück: Boulevard du Cap, Plage des Ondes, Port de l’Olivette, Batterie du Graillon, dann die schmale Straße entlang, die zu dem Privatgrundstück führte.
Ich parkte das Auto unter den Pinien und eilte zum Haus, dessen Eingangstür halb offen stand.
»Anna!«, rief ich, während ich in den Vorraum stürzte.
Im Wohnzimmer war niemand. Der Boden war von Glasscherben übersät. Ein mit Nippes vollgestelltes Regal war umgestürzt und hatte den niedrigen Glastisch zerbrochen, der in tausend Stücke zersprungen war. Mitten in diesem Chaos lag der Schlüsselbund mit dem Anhänger, den ich dir wenige Wochen zuvor geschenkt hatte.
»Anna!«
Die große, von Vorhängen gerahmte Glasfront stand offen. Ich schob die im Wind flatternden Stoffbahnen zur Seite und trat auf die Terrasse. Wieder rief ich deinen Namen. Ich wählte deine Handynummer, aber mein Anruf wurde nicht angenommen.
Ich sank auf die Knie. Wo warst du? Was war in den zwanzig Minuten meiner Abwesenheit geschehen? Welche Büchse der Pandora hatte ich geöffnet, als ich die Vergangenheit heraufbeschwor?
Ich schloss die Augen und sah Bruchstücke unseres gemeinsamen Lebens vorüberziehen. Sechs Monate des Glücks, die sich, wie ich erahnte, soeben für immer in Luft aufgelöst hatten. Verheißungen einer Zukunft, einer Familie, eines Babys, die nie Wirklichkeit werden würden.
Ich machte mir Vorwürfe.
Was nützte die Behauptung, jemanden zu lieben, wenn man nicht in der Lage war, diesen Menschen zu beschützen?
Erster Tag
Verwischte Spuren
1. Der Papiermensch
Sobald ich kein Buch mehr unter der Feder habe
oder davon träume, eins zu schreiben,
fühle ich eine Langeweile, dass ich weinen könnte.
Das Leben erscheint mir wirklich nur erträglich,
wenn man es beiseiteschiebt.
Gustave Flaubert, Briefe an George Sand1
1.
Donnerstag, 1. September 2016
»Meine Frau schläft jede Nacht mit Ihnen ein, zum Glück bin ich nicht eifersüchtig!«
Entzückt über seinen Geistesblitz, zwinkerte mir der Pariser Taxifahrer im Rückspiegel zu. Er verlangsamte das Tempo und setzte den Blinker, um auf den Autobahnzubringer des Flughafens Orly Richtung Innenstadt zu gelangen.
»Man muss wirklich sagen, dass sie beinahe süchtig nach Ihnen ist. Ich habe auch zwei oder drei Ihrer Bücher gelesen«, fuhr er fort, während er sich über seinen Schnurrbart strich. »Das ist alles sehr spannend, aber mir ist das wirklich zu hart. Diese Morde ... diese Gewalt ... Bei allem Respekt, Monsieur Barthélémy, ich finde, Sie haben eine ungesunde Meinung von der Menschheit. Würde man im echten Leben so vielen Gestörten begegnen wie in Ihren Romanen, sähe es schlecht für uns aus.«
Die Augen auf das Display meines Handys gerichtet, tat ich so, als hätte ich ihn nicht gehört. Das Letzte, worauf ich an diesem Vormittag Lust hatte, war, über Literatur oder über den Zustand der Welt zu diskutieren.
Es war 8:10 Uhr, ich hatte das erste Flugzeug genommen, um schnellstens nach Paris zurückzukehren. Annas Handy leitete die Anrufe direkt auf die Mailbox weiter. Ich hatte ihr Dutzende von Nachrichten hinterlassen, hatte sie mit Entschuldigungen überschüttet, ihr meine Unruhe mitgeteilt und sie angefleht zurückzurufen.
Ich war ratlos. Noch nie zuvor hatten wir uns ernsthaft gestritten.
In der Nacht hatte ich kein Auge zugetan, sondern die ganze Zeit über nach ihr gesucht. Zuerst war ich zum Wachdienst des Anwesens gegangen, wo mir der Zuständige mitteilte, dass während meiner Abwesenheit mehrere Wagen auf das Gelände gefahren seien, darunter auch die Limousine eines privaten Chauffeurdienstes.
»Der Fahrer sagte mir, Madame Anna Becker, wohnhaft in der Villa Les Ondes, habe ihn bestellt. Ich rief die Mieterin über das Haustelefon an, und sie bestätigte mir dies.«
»Wie können Sie sicher sein, dass es sich um einen privaten Chauffeurdienst gehandelt hat?«, fragte ich ihn.
»Er hatte auf der Windschutzscheibe den vorgeschriebenen Aufkleber.«
»Und Sie haben keine Ahnung, wohin er sie gefahren haben könnte?«
»Woher soll ich das wissen?«
Der Chauffeur hatte Anna zum Flughafen gebracht. Diese Schlussfolgerung zog ich zumindest, als ich mich einige Stunden später auf der Internetseite von Air France einloggte. Als ich unsere Flugdaten eingab – unsere Tickets hatte ich gekauft –, entdeckte ich, dass die Passagierin Anna Becker ihr Rückflugticket umgebucht hatte auf die letzte Maschine Nizza–Paris dieses Tages. Der für 21:20 Uhr vorgesehene Abflug hatte aus zwei Gründen erst um 23:45 Uhr starten können: wegen der üblichen Verspätungen des Urlauberrückreiseverkehrs und wegen einer EDV-Panne, die jeglichen Start unmöglich gemacht hatte.
Diese Entdeckung hatte mich ein wenig beruhigt. Anna war zwar wütend genug auf mich, um einen Couchtisch zu zertrümmern und vorzeitig nach Paris zurückzufliegen, aber sie war zumindest gesund und wohlbehalten.
Das Taxi verließ die Autobahn mit ihren tristen, Graffiti besprühten Tunneln, um auf den Périphérique zu fahren. Der bereits dichte Verkehr kam bei der Porte d’Orléans noch weiter ins Stocken und dann beinahe ganz zum Erliegen. Die Autos fuhren Stoßstange an Stoßstange, gefangen im bläulichen Abgasdunst der Lastwagen und Busse. Ich schloss mein Fenster. Stickoxid, krebserregender Feinstaub, Hupkonzert, Schimpftiraden. PARIS ...
Ich hatte den Taxifahrer aus alter Gewohnheit gebeten, mich nach Montrouge zu bringen. Obgleich wir in den letzten Wochen zusammengezogen waren, hatte Anna ihr Appartement behalten, eine Zweizimmerwohnung in einem modernen Wohnhaus in der Avenue Aristide-Briand. Sie hing an dieser Wohnung und hatte die meisten ihrer Sachen noch dort gelassen. Ich hegte die große Hoffnung, dass sie in ihrer Wut auf mich dorthin zurückgekehrt war. Wir drehten eine endlose Schlaufe im Kreisverkehr Vache-Noire, bevor wir in der richtigen Richtung weiterfahren konnten.
»Da wären wir, Monsieur Schriftsteller«, verkündete mein Chauffeur und hielt vor einem modernen, aber reizlosen Gebäude am Straßenrand.
Er hatte eine rundliche, gedrungene Figur, einen kahlen Schädel, einen bedächtigen Blick, schmale Lippen und eine Stimme wie Raoul Volfoni in dem Film Mein Onkel, der Gangster.
»Können Sie kurz auf mich warten?«, fragte ich.
»Kein Problem. Ich lasse das Taxameter weiterlaufen.«
Ich warf die Tür zu und nutzte die Tatsache, dass ein Junge mit Schulranzen auf dem Rücken das Haus verließ, um rasch hineinzuschlüpfen. Der Aufzug war, wie so oft, defekt. Ich stieg die zwölf Stockwerke ohne Pause zu Fuß hinauf, bevor ich außer Atem und erschöpft an Annas Wohnungstür klopfte. Niemand antwortete. Ich spitzte die Ohren, nahm jedoch kein Geräusch wahr.
Anna hatte den Schlüssel zu meiner Wohnung zurückgelassen. Wenn sie nicht zu Hause war, wo hatte sie dann die Nacht verbracht?
Ich klingelte an sämtlichen Türen auf dieser Etage. Der einzige Nachbar, der mir öffnete, war keine Hilfe. Nichts gesehen, nichts gehört: die übliche Devise, die das Gemeinschaftsleben in großen Wohnblocks regelt.
Bitter enttäuscht lief ich wieder hinunter auf die Straße und gab Raoul meine Adresse in Montparnasse.
»Wie lange ist es her seit Ihrem letzten Roman, Monsieur Barthélémy?«
»Drei Jahre«, antwortete ich mit einem Seufzer.
»Ist ein neuer in Vorbereitung?«
Ich schüttelte den Kopf.
»In den kommenden Monaten nicht.«
»Da wird meine Frau aber enttäuscht sein.«
In dem Wunsch, die Unterhaltung zu beenden, bat ich ihn, das Radio lauter zu stellen, um die Nachrichten zu hören. In dem populären Sender kamen gerade die die Neun-Uhr-Kurznachrichten. An diesem Donnerstag, dem 1. September, machten sich zwölf Millionen Schüler wieder auf den Weg in die Schule, François Hollande verlieh seiner Freude über einen leichten Anstieg des Wirtschaftswachstums Ausdruck, wenige Stunden vor dem Ende der Wechselperiode hatte der Fußballverein Paris Saint-Germain sich einen neuen Mittelstürmer geleistet, während sich die Republikaner in den USA darauf vorbereiteten, ihren Kandidaten für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu nominieren ...
»Ich verstehe das nicht so recht«, beharrte der Taxifahrer. »Haben Sie beschlossen, sich einen schönen Lenz zu machen, oder leiden Sie unter einer Schreibblockade?«
»Das ist alles etwas komplizierter«, antwortete ich und blickte aus dem Fenster.
2.
Die Wahrheit war, dass ich seit drei Jahren keine einzige Zeile mehr zu Papier gebracht habe, weil das Leben mich eingeholt hatte.
Ich litt weder unter einer Schreibblockade, noch mangelte es mir an Ideen. Ich erzählte mir im Kopf Geschichten, seit ich sechs Jahre alt war, und in meiner Jugend hatte sich mir das Schreiben als Mittelpunkt meines Lebens aufgedrängt, als geeigneter Weg, meine überbordende Fantasie zu kanalisieren. Die Fiktion war eine Ausflucht. Das billigste Flugticket, um dem trübsinnigen Alltag zu entfliehen. Viele Jahre lang hatte das Schreiben meine gesamte Zeit und all meine Gedanken eingenommen. Mit meinem Notizblock oder Laptop wie verwachsen, hatte ich immer und überall geschrieben: auf Parkbänken oder im Café sitzend, in der Metro stehend. Und wenn ich einmal nicht schrieb, dachte ich an meine Figuren, an ihre Qualen, ihre Lieben. Alles andere zählte nicht wirklich. Die Unzulänglichkeiten der realen Welt hatten wenig Einfluss auf mich. Immer zurückgezogen und durch eine Kluft von der Wirklichkeit getrennt, bewegte ich mich in einer Fantasiewelt, deren einziger Schöpfer ich selbst war.
Seit 2003 – dem Jahr, in dem mein erster Roman erschien – hatte ich alle zwölf Monate ein Buch veröffentlicht. Hauptsächlich Krimis und Thriller. In Interviews hatte ich mir die Behauptung angewöhnt, ich würde jeden Tag arbeiten, außer an Weihnachten und an meinem Geburtstag – diese Antwort hatte ich von Stephen King übernommen. Aber es war, genau wie bei ihm, eine Lüge: Ich arbeitete auch an Weihnachten und sah keinen stichhaltigen Grund, warum ich am Erinnerungstag an meine Geburt nicht hätte arbeiten sollen.
Denn ich hatte nur selten etwas Besseres zu tun, als mich vor meinen Bildschirm zu setzen, um Neues von meinen Figuren zu erfahren.
Ich liebte meinen »Beruf« abgöttisch und fühlte mich wohl in diesem Universum der Spannung, der Morde und der Gewalt. Genau wie Kinder – denken Sie nur an den Menschenfresser in Der gestiefelte Kater, an die verbrecherischen Eltern in Der kleine Däumling, an den Unhold Blaubart oder den Wolf in Rotkäppchen – lieben es auch die Erwachsenen, mit der Angst zu spielen. Auch sie brauchen Geschichten, um ihre Ängste zu vertreiben.
Die Vorliebe der Leser für Krimis hatte mir zehn märchenhafte Lebensjahre beschert, in denen ich in die Bruderschaft der begrenzten Anzahl von Autoren eingetreten war, die vom Schreiben leben konnten. Jeden Morgen, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setzte, war ich mir des Glücks bewusst, dass überall in der Welt Menschen auf das Erscheinen meines nächsten Romans warteten.
Aber dieser magische Kreis aus Erfolg und Schaffen war seit drei Jahren wegen einer Frau unterbrochen. Auf einer Lesereise nach London hatte mir mein Presseattaché Natalie Curtis vorgestellt, eine junge englische Wissenschaftlerin, die für Biologie ebenso begabt war wie für Geschäftliches. Sie war an einem medizinischen Start-up-Unternehmen beteiligt, das »intelligente« Kontaktlinsen entwickelte, die verschiedene Krankheiten anhand des Glukosegehalts in der Augenflüssigkeit erkennen konnten.
Natalie arbeitete achtzehn Stunden am Tag. Mit einer verwirrenden Mühelosigkeit jonglierte sie zwischen Softwareprogrammierung, der Überwachung klinischer Studien, der Entwicklung von Geschäftsplänen und verschiedenen Zeitzonen, die sie in alle Welt führten, wo sie weit entfernten Finanzpartnern Rechenschaft ablegte.
Wir bewegten uns in zwei konträren Universen. Ich war ein Papiermensch, sie war ein Wesen der digitalen Welt. Ich verdiente meinen Lebensunterhalt mit dem Erfinden von Geschichten, sie verdiente ihren mit der Entwicklung von Mikroprozessoren, die so fein waren wie die Haare eines Säuglings. Ich war der Typ Mann, der im Gymnasium Griechisch gelernt hatte, Gedichte von Aragon liebte und Liebesbriefe mit dem Füllfederhalter schrieb. Sie war der Typ ultravernetzte junge Frau, die sich in der kalten und grenzenlosen Welt der Flughafen-Drehkreuze zu Hause fühlte.
Nicht einmal mit dem heutigen Abstand zu ihr gelang es mir, zu verstehen, woher unsere Zuneigung füreinander rührte. Was hatte uns zu diesem Zeitpunkt unseres Lebens glauben lassen, unsere unpassende Geschichte könnte eine Zukunft haben?
»Man liebt, was man nicht ist«, schrieb Albert Cohen.2 Vielleicht verliebt man sich aus diesem Grund gelegentlich in Personen, mit denen man nichts teilt. Vielleicht lässt uns der Wunsch nach gegenseitiger Ergänzung eine Wandlung, eine Metamorphose erhoffen. Als würde der Kontakt zu dem anderen aus uns ein vollständigeres, reicheres, offeneres Wesen machen. Auf dem Papier ist das ein schöner Gedanke, aber in der Wirklichkeit ist es selten der Fall.
Die Illusion unserer Liebe hätte sich rasch verflüchtigt, wäre Natalie nicht schwanger geworden. Die Aussicht, eine Familie zu gründen, hatte dem Trugbild längeren Bestand gegeben. Zumindest was mich betraf. Ich hatte Frankreich verlassen, um in die Wohnung einzuziehen, die sie in London im Stadtviertel Belgravia gemietet hatte, und sie während der Schwangerschaft begleitet, so gut ich konnte.
»Welche Ihrer Romane sind Ihnen die liebsten?« Bei jeder neuen Lesereise tauchte die Frage aus dem Mund von Journalisten wieder auf. Jahrelang war ich ihr eher ausgewichen und hatte mich mit einer lakonischen Antwort begnügt: »Das kann ich unmöglich sagen. Meine Romane sind für mich alle wie Kinder, wissen Sie.«
Aber Bücher sind keine Kinder. Ich war bei der Geburt unseres Sohnes mit im Kreißsaal. Als mir die Hebamme den kleinen Theo in den Arm legte, wurde mir innerhalb einer Sekunde bewusst, was für eine Lüge diese wiederholte Behauptung in verschiedenen Interviews war.
Bücher sind keine Kinder.
Bücher haben eine Besonderheit, die an Zauberei grenzt: Sie sind der Reisepass an einen anderen Ort, bieten die Möglichkeit zu einer großartigen Flucht aus der Wirklichkeit. Bei den Prüfungen des Lebens, denen man sich stellen muss, können sie als Wegzehrung dienen. Wie Paul Auster behauptet, sind sie »der einzige Ort auf der Welt, an dem zwei Fremde sich auf intime Weise begegnen können«.3
Aber sie sind keine Kinder. Nichts lässt sich mit einem Kind vergleichen.
3.
Zu meiner großen Überraschung nahm Natalie zehn Tage nach der Entbindung ihre Arbeit wieder auf. Ihr ausufernder Terminplan und ihre zahlreichen Reisen erlaubten es ihr kaum, die ersten – ebenso zauberhaften wie erschreckenden – Wochen voll auszukosten, die auf eine Geburt folgen. Es schien ihr nicht sonderlich nahezugehen. Den Grund dafür begriff ich, als sie mir eines Abends, während sie sich in dem begehbaren Kleiderschrank auszog, der an unser Schlafzimmer grenzte, mit tonloser Stimme verkündete:
»Wir haben ein Angebot von Google angenommen. Sie werden die Mehrheitsanteile des Firmenkapitals übernehmen.«
Ich war so verblüfft, dass ich einige Sekunden brauchte, bevor ich erwidern konnte:
»Ist das dein Ernst?«
Mit abwesendem Blick zog sie ihre Schuhe aus und massierte sich einen schmerzenden Knöchel, bevor sie mir den Schlag versetzte.
»Absolut. Ich werde schon ab Montag mit meinem Team in Kalifornien arbeiten.«
Verstört starrte ich sie an. Sie hatte gerade zwölf Flugstunden hinter sich, aber ich war derjenige, der sich fühlte, als hätte er einen Jetlag.
»Das ist doch nicht allein deine Entscheidung, Natalie! Darüber müssen wir sprechen!«
Sie setzte sich niedergeschlagen auf die Bettkante.
»Ich weiß sehr wohl, dass ich dich nicht bitten kann, mitzukommen.«
Ich verlor völlig die Fassung.
»Aber ich bin gezwungen, mitzukommen! Darf ich dich daran erinnern, dass wir ein drei Wochen altes Baby haben!«
»Schrei mich nicht an! Ich bin davon am stärksten betroffen, aber ich kann es einfach nicht, Raphaël.«
»Was kannst du nicht?«
Sie brach in Tränen aus.
»Eine gute Mutter für Theo sein.«
Ich versuchte, ihr zu widersprechen, aber sie wiederholte mehrfach diesen schrecklichen Satz, der verriet, was in ihrem Herzen vorging: »Ich bin dafür nicht geschaffen. Es tut mir unendlich leid.«
Als ich sie fragte, wie sie sich unsere Zukunft konkret vorstellte, warf sie mir einen undefinierbaren Blick zu, bevor sie den Trumpf ausspielte, den sie seit dem Beginn dieses Gesprächs im Ärmel hatte.
»Wenn du Theo in Paris aufziehen möchtest, allein, sehe ich darin keinen Nachteil. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass das die beste Lösung für uns alle ist.«
Ich nickte schweigend, schockiert von der ungeheuren Erleichterung, die ich auf ihrem Gesicht las. Dem Gesicht der Mutter meines Sohnes. Dann breitete sich eine bleierne Stille in unserem Schlafzimmer aus, und Natalie nahm ein Schlafmittel, bevor sie sich im Dunkeln hinlegte.
Bereits am übernächsten Tag kehrte ich nach Frankreich zurück in meine Wohnung in Montparnasse. Ich hätte eine Tagesmutter engagieren können, aber ich tat nichts dergleichen. Ich war fest entschlossen, meinen Sohn aufwachsen zu sehen. Vor allem lebte ich in der ständigen Angst, ihn zu verlieren.
Mehrere Monate lang rechnete ich bei jedem Klingeln des Telefons damit, Natalies Anwalt am Apparat zu haben, der mir ankündigen würde, seine Mandantin habe ihre Meinung geändert und beanspruche das alleinige Sorgerecht für Theo. Aber dieser albtraumhafte Anruf kam nie. Zwanzig Monate verstrichen, ohne dass ich von Natalie irgendetwas gehört hätte. Zwanzig Monate, die wie im Flug vergingen. Mein Tagesablauf, früher vom Schreiben bestimmt, verlief nun im Rhythmus von Fläschchengeben, Breifüttern, Windelwechsel, Spaziergängen im Park, Baden bei 37 Grad Celsius und häufigem Wäschewaschen. Daneben zehrten der Schlafmangel, die Sorge beim geringsten Fieber meines Sohnes und die Furcht, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein, an mir.
Doch ich hätte diese Erfahrung gegen nichts auf der Welt eintauschen wollen. Wie die fünftausend Fotos bezeugten, die auf meinem Handy gespeichert waren, hatten mich die ersten Lebensmonate meines Sohnes in ein faszinierendes Abenteuer geführt, in dem ich eher die Rolle des Schauspielers als die des Regisseurs innehatte.
4.
Auf der Avenue du Général-Leclerc lief der Verkehr wieder flüssiger. Das Taxi beschleunigte und steuerte auf den hohen Turm von Saint-Pierre-de-Montrouge zu. An der Place d’Alésia bog der Wagen auf die Avenue du Maine ab. Zwischen den Bäumen brach das Sonnenlicht hindurch. Fassaden mit weißen Quadersteinen, unzählige kleine Geschäfte, preiswerte Hotels.
Obwohl ich geplant hatte, Paris vier Tage fernzubleiben, war ich bereits wenige Stunden nach meiner Abreise wieder zurück. Um meine überstürzte Rückkehr anzukündigen, schrieb ich eine SMS an Marc Caradec, den einzigen Mann, auf den ich genügend zählen konnte, um ihm meinen Sohn anzuvertrauen. Die Vaterrolle hatte mich paranoid gemacht, als könnten die Mord- und Entführungsgeschichten, die ich in meinen Krimis inszenierte, mein Familienleben infizieren. Seit Theos Geburt hatte ich nur zwei Menschen erlaubt, sich um ihn zu kümmern: Amalia, der Concierge in meinem Haus, die ich seit beinahe zehn Jahren kannte, und Marc Caradec, meinem Nachbarn und Freund, einem ehemaligen Polizisten der BRB, einer Spezialeinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Er beantwortete meine Nachricht umgehend:
Keine Sorge. Goldlöckchen schläft noch. Ich warte Gewehr bei Fuß, dass er aufwacht: Der Fläschchenwärmer ist eingeschaltet, das Kompottgläschen aus dem Kühlschrank genommen und das Hochstühlchen auf die richtige Höhe eingestellt.Erzähl mir später, was passiert ist.
Bis gleich.
Erleichtert versuchte ich erneut, Anna anzurufen, aber ich erreichte wieder nur ihre Mailbox. Handy ausgeschaltet? Akku leer?
Ich legte auf und rieb mir die Augen, noch immer niedergeschlagen von der Geschwindigkeit, in der meine Gewissheiten zusammengebrochen waren. In meinem Kopf ließ ich den Film des Vorabends noch einmal ablaufen und wusste nicht mehr, was ich davon zu halten hatte. War unser Glück nur eine Luftblase gewesen, die nun zerplatzt war und eine alles andere als glänzende Realität zum Vorschein brachte? Musste ich mir um Anna Sorgen machen oder mich vor ihr hüten? Die letzte Frage bescherte mir Gänsehaut. Es war schwierig, jetzt auf diese Art an sie zu denken, obwohl ich wenige Stunden zuvor noch davon überzeugt gewesen war, die Frau fürs Leben gefunden zu haben: die Frau, auf die ich seit Jahren gewartet hatte und mit der ich weitere Kinder haben wollte.
Ich hatte Anna vor sechs Monaten kennengelernt, in einer Februarnacht in der Kindernotaufnahme des Hôpital Pompidou, wo ich um ein Uhr morgens angekommen war. Theo hatte anhaltend hohes Fieber. Er krümmte sich und verweigerte jede Nahrung. Ich hatte der absurden Versuchung nachgegeben, die Liste seiner Symptome in eine Suchmaschine einzugeben. Beim Durchsehen der Internetseiten war ich zu der Überzeugung gelangt, dass er an einer akuten Meningitis litt. Als ich den überfüllten Wartesaal betrat, starb ich fast vor Sorge. Angesichts der Wartezeit beschwerte ich mich am Empfang: Ich brauchte Gewissheit, ich wollte, dass man meinen Sohn sofort behandelte. Er würde vielleicht sterben, er ...
»Beruhigen Sie sich, Monsieur.«
Eine junge Ärztin war wie durch Zauberhand aufgetaucht. Ich folgte ihr in das Untersuchungszimmer, wo sie Theo sorgfältig abhörte.
»Ihr Baby hat geschwollene Lymphknoten«, stellte sie fest, als sie seinen kleinen Hals abtastete. »Der Kleine leidet an einer Mandelentzündung.«
»Es ist eine einfache Angina?«
»Ja. Die Schluckbeschwerden erklären, warum er die Nahrung verweigert.«
»Es vergeht also mit einem Antibiotikum?«
»Nein, es handelt sich um eine Virusinfektion. Geben Sie ihm weiter Paracetamol, und er wird in wenigen Tagen wieder gesund sein.«
»Sind Sie sicher, dass es keine Meningitis ist?«, insistierte ich, während ich, völlig groggy, Theo wieder in seiner Babyschale festschnallte.
Sie hatte gelächelt.
»Sie sollten aufhören, im Internet auf medizinischen Seiten zu surfen. Das schürt nur Ängste.«
Sie hatte uns in die große Eingangshalle zurückbegleitet. Als es Zeit war, mich von ihr zu verabschieden, deutete ich, beruhigt durch die Gewissheit, dass mein Sohn wieder gesund würde, auf den Getränkeautomaten und schlug vor:
»Darf ich Ihnen einen Kaffee ausgeben?«
Nach kurzem Zögern hatte sie ihrer Kollegin gesagt, sie würde eine kleine Pause machen, und wir hatten uns eine Viertelstunde lang angeregt unterhalten.
Sie hieß Anna Becker, war fünfundzwanzig Jahre alt und absolvierte das zweite Jahr ihrer Assistenzarztzeit in der Pädiatrie. Ihren weißen Kittel trug sie wie einen Burberry-Regenmantel. Alles an ihr war elegant, ohne spröde zu wirken: die selbstsichere Haltung, ihre unglaublich feinen Gesichtszüge, der sanfte und warmherzige Klang ihrer Stimme.
Die Krankenhaushalle, im steten Wechsel zwischen ruhigen Momenten und großer Hektik, badete in einem unwirklichen Licht. Mein Sohn war in seiner Babyschale eingeschlafen. Ich sah Annas Wimpernschlag. Schon lange glaubte ich nicht mehr daran, dass sich hinter einem Engelsgesicht unbedingt eine schöne Seele verbergen musste, aber dennoch ließ ich mich von ihren langen gebogenen Wimpern, ihrer Haut von der Farbe eines Edelholzes und von ihrem glatten Haar betören, das auf beiden Seiten ihres Gesichts symmetrisch herabfiel.
»Ich muss wieder an die Arbeit«, sagte sie und deutete auf die Wanduhr.
Trotz der fortgeschrittenen Zeit hatte sie darauf bestanden, uns zum Taxistand zu begleiten, der etwa dreißig Meter vom Ausgang entfernt war. Es war mitten in der Nacht, mitten in einem eiskalten Winter. Einige flauschige Flocken schwebten vom Himmel, der mehr Schnee verhieß. Als ich Anna neben mir spürte, empfand ich uns in einem merkwürdigen Gedankenblitz bereits als Paar. Ja, sogar als Familie. So als würde die Sternenformation am Himmel uns genau dies ankündigen. Als würden wir drei nun nach Hause fahren.
Ich schnallte den Babysitz auf der Rückbank fest und wandte mich anschließend zu Anna um. Das Licht der Straßenlaternen verlieh ihrem durch die Kälte sichtbaren Atem eine bläuliche Färbung. Ich suchte nach einer Bemerkung, die sie zum Lachen bringen würde, aber stattdessen fragte ich sie, wann ihr Dienst endete.
»Bald, um acht Uhr.«
»Wenn Sie zum Frühstück kommen möchten ... Der Bäcker an meiner Straßenecke macht fantastische Croissants ...«
Ich gab ihr meine Adresse, und sie lächelte. Mein Vorschlag hing einen Augenblick in der eiskalten Luft, ohne dass ich eine Antwort bekommen hätte. Dann fuhr das Taxi los, und ich fragte mich auf der Heimfahrt, ob wir beide soeben dasselbe erlebt hatten.
Ich schlief schlecht, aber am nächsten Morgen klingelte Anna genau in dem Moment an meiner Tür, als mein Sohn sein Fläschchen ausgetrunken hatte. Es ging Theo schon besser. Ich zog ihm ein Mützchen und einen Schneeanzug an, und um Wort zu halten, machten wir alle drei uns auf den Weg, um fürs Frühstück einzukaufen. Es war Sonntagmorgen. Paris ächzte unter dem Schnee. Von einem metallisch blauen Himmel beschien die Wintersonne die noch makellosen Bürgersteige.
Wir hatten uns gefunden und seit diesem ersten magischen Morgen nicht mehr verlassen. Sechs idyllische Monate waren verstrichen, die eine wundervolle Zukunft verhießen: die glücklichste Zeit meines Lebens.
Ich schrieb nicht mehr, aber ich lebte. Das Erziehen eines Kindes und das Verliebtsein hatten mich im realen Leben verankert und mir klargemacht, dass die Fiktion viel zu lange mein Leben bestimmt hatte. Durch das Schreiben war ich in die Haut vieler verschiedener Figuren geschlüpft. Wie ein eingeschleuster Agent hatte ich Hunderte von Erfahrungen sammeln können. Aber diese verschiedenen kommissarischen Leben hatten mich vergessen lassen, das einzige und einmalige Dasein zu leben, das wirklich existierte: mein eigenes.