 {7}in welchem sich ein dicker König einen Sohn wünscht und ein Prinz namens Jan geboren wird
{7}in welchem sich ein dicker König einen Sohn wünscht und ein Prinz namens Jan geboren wird{5}Für Seraina,
der ich die Geschichte zum ersten Mal erzählte
 {7}in welchem sich ein dicker König einen Sohn wünscht und ein Prinz namens Jan geboren wird
{7}in welchem sich ein dicker König einen Sohn wünscht und ein Prinz namens Jan geboren wirdEs war einmal ein dicker König, der hieß Ferdinand und fürchtete sich vor allem und jedem. Dass er so furchtsam war, gab er natürlich nicht zu, im Gegenteil: Meistens redete er mit lauter Stimme und tat so, als habe er überhaupt keine Angst. Nur seine Frau, Königin Isabella, wusste Bescheid. Wenn sie nachts im Bett lagen, rüttelte manchmal der Wind an den Fensterläden. Da steckte Ferdinand den Kopf unter das Kissen und murmelte: »Ich will gar nichts mehr hören! Gar nichts!« Aber Isabella zog ihm das Kissen wieder weg und sagte: »Mann, willst du ersticken? Es ist ja nur der Wind.«
König Ferdinand war zwar dick und aß große {8}Mengen von Zwetschgenkompott, doch er herrschte nur über ein winziges Reich. Die mächtigen Nachbarn ließen Zipfelland seit Jahrhunderten in Ruhe, und Ferdinand hütete sich davor, sie zu erzürnen. Obgleich also Zipfelland keine Feinde hatte, wollte Ferdinand nicht auf seine Armee verzichten. Sie bestand aus zwölf Soldaten und wurde von Hauptmann Roderick befehligt, der als Einziger die verrostete Kanone anfassen durfte.
Das Schloss, in dem das Königspaar lebte, stand auf einem Hügel über dem Dorf. Es war im Lauf der Zeit baufällig geworden. Die Umfassungsmauer zerbröckelte; der Wassergraben trocknete aus; das Dach war undicht. Bei jedem Windstoß musste Ferdinand fürchten, dass ihm ein Ziegel oder ein Stück Verputz auf den Kopf fallen könnte. Er war zwar ein launischer Herrscher, aber er hatte nicht das Herz, die Steuern hinaufzusetzen, und so fehlte ihm das Geld für Reparaturen.
Der größte und ungemütlichste Raum im Schloss war der Thronsaal. Jeden Donnerstagmorgen setzte sich Ferdinand auf den Thron, um ein paar Stunden lang zu regieren. Er tat es ungern; die Krone drückte ihn, und er starrte verdrossen auf die gegenüberliegende Wand, wo die lange Reihe der Gesetzbücher stand, die er seit Jahren nicht mehr aufgeschlagen hatte.
{9}Zwei alte Diener, Stanislaus und Raimund, schauten im Schloss nach dem Rechten. Ferdinand war unter ihrer Obhut aufgewachsen; er hatte sich an sie gewöhnt, und obgleich sie ihre Arbeit immer schlechter taten, weigerte er sich, sie zu entlassen. Das war einer der Gründe für die Streitereien zwischen dem König und der Königin. Ein anderer war, dass sie kein Kind hatten.
»Ich will ein Kind«, sagte Ferdinand. »Ich will einen Sohn. Wer soll sonst mein Nachfolger werden? Streng dich endlich an, Isabella, du bist einfach zu gleichgültig.«
»Das wäre ja noch schöner, wenn wir Kinder herbeibefehlen könnten wie ein zahmes Hündchen. Wofür hältst du mich eigentlich?« Sie verstummte, denn Raimund und Stanislaus kamen herein, um das Geschirr abzutragen, und in ihren Augen schickte es sich nicht, vor den Dienern zu streiten.
Nachdem sie gegangen waren, sagte Ferdinand: »Ich weiß auch schon, wie unser Kind heißen wird: Ottokar!«
»Um Gottes willen!«, rief Isabella. »So heißen Kater oder Laubfrösche.«
»Ottokar ist ein stolzer und strammer Name«, widersprach Ferdinand.
»Wir werden sehen«, sagte Isabella. Das war eine {10}ihrer häufigsten Antworten, und sie bedeutete, dass ihr die Lust am Streiten vergangen war.
Aber eines Abends, als das Königspaar im Bett lag, deutete Isabella auf ihren Bauch und sagte: »Mann, ich bin schwanger.«
»Wie? Woher weißt du das?«
»Das fühlen wir. Es rührt sich schon da drin.«
»Das ist sehr gefährlich! Ich werde sogleich den Leibarzt benachrichtigen. Und den Hofapotheker. Und die Hebamme. Und …«
»Beruhige dich, Mann. Überlass das mir.«
»Aber wenn du dir alles nur einbildest? Stell dir vor, diese Blamage!«
Die Königin nahm Ferdinands Hand und legte sie auf ihren Bauch. Nachdem sie eine Weile dort geruht hatte, spürte er plötzlich ein Zucken, dann einen kleinen Buckel, der unter der Hand wegglitt. »Tatsächlich … da ist was …«, sagte der König. »Wie winzig muss dieses Kerlchen sein!«
»Es wächst noch. Und es wird weiterwachsen, bis es so groß ist wie wir.«
»Aber wie lange das noch dauert! Und wie viel kann bis dahin passieren! Sieh dich bloß vor. Und denk daran, dass du bei jedem Schritt straucheln könntest! Ach, ich darf mir das gar nicht ausmalen.«
{11}Mit Besorgnis sah der König in den folgenden Wochen, wie Isabellas Bauch immer mehr anschwoll. Sie wurde dicker als er selber; ohnehin begann er vor lauter Sorgen abzumagern. »Der Junge findet kaum noch Platz da drin«, sagte er. »Das muss ihn doch überall drücken, und wer weiß, vielleicht schadet so viel Druck dem Gehirn.«
»Erstens kann’s auch ein Mädchen sein«, erwiderte Isabella. »Und zweitens ist gerade so viel Platz da, wie es braucht, nicht zu viel und nicht zu wenig.«
Der König glaubte ihr nur halb, und überhaupt: Bis zur Geburt konnten noch tausend Dinge dazwischenkommen.
Doch in einer Septembernacht gebar die Königin ein gesundes Baby. Ferdinand näherte sich auf Zehenspitzen dem Kind und betrachtete es von nahem. Aber gleich fuhr er wieder zurück.
»Herrje«, rief er, »sein Kopf sieht ganz zerdrückt aus. Und dieser Schleim, dieses Blut überall! Ist es denn krank?«
»Majestät«, sagte der Leibarzt, »so sehen Neugeborene eben aus.«
»Wir werden es gleich waschen«, sagte die Hebamme, die sich über die männliche Dummheit längst nicht mehr wunderte.
{12}»Waschen?« Ferdinand sah die Hebamme entsetzt an. »Was fällt dir ein? Schau doch, wie winzig und zart es ist. Willst du’s ertränken?«
Davon verstehst du nichts, hätte sie jedem anderen Mann gesagt; aber weil es der König war, schluckte sie ihre Antwort hinunter und warf dem Leibarzt einen vielsagenden Blick zu.
Der Leibarzt fürchtete den Zorn des Königs. »Es ist üblich«, sagte er zögernd, »Neugeborene zu waschen. Wenn Ihre Majestät allerdings geruhen …«
»Halt«, unterbrach ihn der König. »Wieso hat mir eigentlich noch niemand gesagt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist?«
»Hast du denn keine Augen im Kopf«, sagte die Königin mit schwacher Stimme.
»Ach Gott«, sagte der König, »es ist schon ganz blau vor Kälte. Und ich seh ja nur den Rücken, das Rücklein … und diese Beinchen, die reinsten Hühnerbeinchen … Wie soll ich da …«
»Es ist ein Junge«, sagte die Hebamme und legte eine Decke über Mutter und Kind.
»Wie? Was?«, schrie der König, außer sich vor Freude. »Ein Junge! Ein Junge! Hab ich’s nicht gesagt?« Er hüpfte auf einem Bein im Schlafzimmer herum und klatschte in die Hände. »Beflaggt das Schloss! Einundzwanzig Böllerschüsse als Salut für den Thronfolger!« Plötzlich verstummte er, trat {13}wieder zum Bett und betrachtete das flaumige Köpfchen, das an der Brust der Königin lag. »Ottokar …«, sagte er mit fragendem Unterton. »Ottokar …« Er schüttelte verwirrt den Kopf. »Nein, das geht nicht für etwas so Kleines.«
»Er heißt Jan«, sagte die Königin.
»Jan?«
»Jan ist ein guter Name.«
Noch am selben Vormittag wurden die einundzwanzig Kanonenschüsse abgefeuert. Die einzige Kanone, die zum Schloss gehörte, war seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden, und die ersten Schüsse erzeugten so viel Rauch, dass das ganze Schloss von einer schwarzen Wolke verhüllt wurde. Nach dem ersten Schuss liefen die Leute auf den Straßen zusammen und zählten laut mit. Bei einer kurzen Unterbrechung nach dem dritten Schuss nickten sie einander zu.
»Ein Mädchen also«, sagte Otto, der königliche Zwetschgenkompottlieferant, und legte den Arm um seine Frau, die ebenfalls schwanger war. Als aber die Schüsse wieder einsetzten und erst beim einundzwanzigsten endeten, sagte er: »Ein Junge. Auch gut.«
»Aber wir werden ein Mädchen haben«, sagte Gerda, seine Frau.
{14}»Das werden wir«, sagte Otto, »und es wird Sophie heißen.«
»Darüber reden wir noch«, entgegnete Gerda.
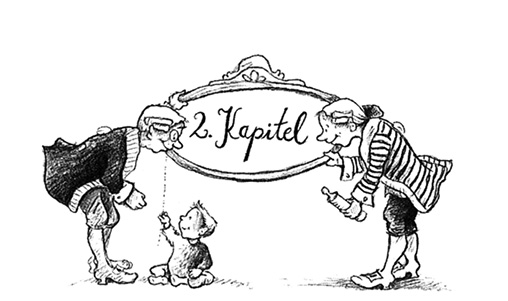 {15}in welchem der kleine Prinz Brei essen muss und mit zwei Nebenhergehern Bekanntschaft schließt
{15}in welchem der kleine Prinz Brei essen muss und mit zwei Nebenhergehern Bekanntschaft schließtDas Kind wuchs von Tag zu Tag. Es wurde gewaschen, gewickelt, gefüttert, gewogen. Es schlief, es trank, es rülpste, es machte die Windeln nass.
Isabella blieb dabei gelassen; Ferdinand aber kam kaum mehr zur Ruhe. Täglich entdeckte er neue Gefahren, die sein Söhnchen bedrohten.
»Du sorgst dich zu sehr, Mann«, pflegte die Königin zu sagen.
»Nein, noch viel zu wenig«, entgegnete der König.
Als Erstes verbot er, das Kind weiterhin in die Wiege zu legen.
{16}»Sie schwankt zu sehr«, erklärte er. »Der Prinz könnte herausfallen und sich das Genick brechen.« Er ließ vom königlichen Schreiner einen Bettkasten mit abgerundeten Kanten und gepolsterten Wänden anfertigen, der so tief war, dass das Kind nicht herausfallen konnte.
»So was Unnützes«, sagte Isabella. »Aber gut, wenn’s dich beruhigt.«
Als Nächstes ordnete Ferdinand an, dass niemand den kleinen Jan in die Arme nehmen und herumtragen dürfe außer der Königin und der Kinderfrau. Bei jedem Gang wurde die Kinderfrau außerdem von zwei Soldaten begleitet, die links und rechts von ihr und immer einen halben Schritt voraus ein Netz zwischen sich ausgespannt hatten, so dass das Kind, hätte die Kinderfrau es fallen gelassen, darin aufgefangen worden wäre.
»Soll er doch seinen Willen haben«, sagte die Königin, als die Kinderfrau sich bei ihr über diese Verrücktheit beschwerte.
Doch eines Morgens entdeckte der König, dass Jans linke Wange von drei Mückenstichen geschwollen war. »Mücken!«, schrie er. »Diese niederträchtigen Biester! Sieh nur, Isabella, sie könnten ihn glatt totstechen!« Wie um ihn anzuspornen, verzog Jan sein Gesicht und begann zu wimmern.
{17}»Ach, Ferdinand«, sagte Isabella. »Du übertreibst wie immer. So schlimm ist das gar nicht. Wir tragen ein wenig Salbe auf, und dann schwillt es wieder ab.« Sie nahm das Kind in die Arme und gab ihm die Brust.
»Majestät«, sagte Raimund, der zugehört hatte, »Sie müssten vielleicht befehlen, sämtliche Fenster im Schloss zu schließen.«
Der König stutzte. »Eine ausgezeichnete Idee! Von wo kommen die Mücken? Von draußen! Wir schließen die Fenster nicht nur, wir vernageln sie, dann zieht es auch nicht mehr. Ich habe bisher viel zu wenig daran gedacht, wie sehr Zugwind meinem Kind schaden könnte.«
Isabella wehrte sich gegen diese neue Maßnahme. Doch Ferdinand ließ sich nicht beirren. Er rief den königlichen Schreiner und befahl ihm, sämtliche Fenster zuzunageln. Das dauerte ein paar Tage, gleichzeitig gingen Stanislaus und Raimund auf Mückenjagd. Sie forschten nach schwarzen Punkten an Wänden und Decken; sie schlugen mit ihren Klatschen auch Spinnen, Wanzen und Schaben tot, von denen es im Schlosskeller wimmelte. Der König war entsetzt, als er all die Insektenleichen sah, die ihm die Diener vorwiesen. »In Ohren und Nase könnten sie dem Kind kriechen! Oder es könnte sich an einer fetten Fliege verschlucken!« Und er {18}beschloss, eine neue Stelle zu schaffen: die eines königlichen Insektenjägers, der alles, was sechs Beine hatte, aufspüren und vernichten musste.
»Wie willst du ihn bezahlen?«, fragte Isabella. »Wir haben sowieso kein Geld. Und für eine solche Dummheit schon gar nicht.«
»Für unser Kind darf uns nichts zu teuer sein«, sagte Ferdinand mit finsterem Blick. »Im Notfall erhöhe ich die Steuern.«
Der König ließ durch seinen nebenamtlichen Herold ausrufen, dass er einen fähigen Insektenjäger suche. Es meldeten sich ein paar Burschen, und Ferdinand wählte den flinksten aus. Er hieß Karol. Von morgens früh bis abends spät hallte sein Klatschen durchs Schloss. Die Mauerritzen und das undichte Dach sorgten dafür, dass ihm die Arbeit nicht ausging; im Gegenteil, je größer seine Beute war, desto unverschämter schienen sich die Insekten zu vermehren, und am Abend war er jeweils zu Tode erschöpft.
Als Jan die ersten Zähne bekam, hatte der König einen weiteren Grund, sich zu sorgen. Das Kind hatte bisher Muttermilch getrunken und Brei gegessen; jetzt griff es nach Brotkanten und kaute auf ihnen herum.
»Um Gottes willen!«, rief Ferdinand, als er dies {19}zum ersten Mal sah. »Die Rinde ist doch viel zu hart.«
»Kinder müssen kauen lernen«, entgegnete die Königin. »Das ist nun einmal so.«
»Aber Jan hat einen so zarten Gaumen. Er könnte sich verletzen, die Wunde könnte zu eitern beginnen. Schrecklich!«
Isabella schüttelte den Kopf. »Ach Mann, du mit deinen ewigen Ängsten. Lass unseren Jan doch groß werden wie andere Kinder.«
Im selben Augenblick verschluckte sich das Kind, es hustete, sein Gesicht lief rot an, und Isabella legte es bäuchlings über die Knie und klopfte ihm auf den Rücken, bis es das Brotstück wieder ausspuckte.
»Siehst du?«, sagte sie. »Jetzt hast du beinahe einen Unfall herbeigeredet.«
Starr vor Schrecken hatte Ferdinand die Szene verfolgt. Allmählich kam er wieder zu sich. »Ich werde anordnen«, sagte er, »dass Jan von heute an nur noch Brei zu essen bekommt, Gemüsebrei, Fleischbrei, Früchtebrei, verstehst du? Alles, was der Kleine isst, wird in der Küche vorher zermanscht und zerstoßen, jedes Knöchelchen, jeder Apfelkern wird entfernt.«
»Mann, du bist verrückt. Das ist gegen die Natur, das erlaube ich nicht.«
{20}»Du wirst tun, was ich befehle.«
»O nein!«
»O doch! Die Königskrone trage ich, du bist nur meine Frau!«
»Ich bin Jans Mutter!«
Sie starrten einander erbost an. Aber auch diesmal setzte Ferdinand seinen Willen durch. Er rief den Ministerrat zusammen, der aus drei nebenamtlichen Ministern bestand; und nachdem sie einen Tag lang im Thronsaal eingesperrt gewesen waren, entschieden sie, der König habe immer recht und in Angelegenheiten seines Sohnes noch mehr als sonst.
Ein paar Monate vergingen. Jan lernte krabbeln; er griff nach allem, was er sah, und versuchte, es in den Mund zu stecken.
»Schrecklich!«, rief der König. Und er befahl, sämtliche Gegenstände, die sich in Jans Nähe befanden, wegzuräumen. Keine Rassel durfte er berühren, kein Holzpferd, keinen Kreisel: alles viel zu gefährlich! Der Ausrufer verkündete in ganz Zipfelland, der König benötige einen Wegfreiräumer, der dem Prinzen die kleinsten Steinchen aus dem Weg räume.
»Sicher ist sicher«, sagte sich der König, nachdem er aus der Reihe der Bewerber den Tüchtigsten ausgewählt hatte.
{21}Rupert, der königliche Wegfreiräumer, tänzelte nun tagsüber vor dem Kind her, versuchte, dessen gewundenen Weg vorauszuahnen, und krähte: »Aus dem Weg! Aus dem Weg!« Wann immer es ging, mussten Raimund und Stanislaus ihm beistehen und alle Möbel, die Jan im Weg standen, zur Seite rücken. Besonders das königliche Sofa war ein schweres Stück, und sie mussten es, den Launen des Kindes folgend, an einem einzigen Tag bis zu dreißigmal verschieben.
Der Zufall wollte es, dass Ferdinand gerade dabei war, als sein Sohn sich zum ersten Mal von allein aufrichtete. Isabella hatte sich dem Kind gegenüber auf den leergeräumten Boden gekauert und klatschte in die Hände. »Komm«, lockte sie, »versuch’s doch mal!«
Fassungslos sah der König, wie das Kind die Ärmchen ausstreckte und schwankend einen Fuß vor den andern setzte. »Halt!«, schrie er, bleich vor Angst. Jan erschrak, schwankte noch stärker, und er wäre auf den Hintern geplumpst, wenn nicht der König mit einem Sprung bei ihm gewesen wäre und ihn aufgefangen hätte. Jan begann zu weinen, entwand sich den Händen des Vaters und krabbelte verängstigt zu Isabella hin, die ihm tröstend durchs Haar fuhr.
{22}»Willst du das Kind umbringen?«, schimpfte der König. »Beinahe wäre es gestürzt und hätte sich ein Bein oder einen Arm gebrochen!«
»Jan lernt gehen«, sagte Isabella und zwang sich zur Ruhe. »Da wird er noch einige Male auf den Hintern fallen. Das ist eben so bei kleinen Kindern.«
»Aber nicht bei Jan.«
»Was denn sonst? Soll er sein Leben lang auf allen vieren krabbeln?«
»Nein. Aber wenn er stolpert oder schwankt, darf ihm nichts passieren.« Ferdinand dachte angestrengt nach.
»Ich hab’s!«, rief er plötzlich. »Ich ernenne einen ersten und einen zweiten Nebenhergeher. Der erste geht zur Rechten und der zweite zur Linken des Prinzen. Und dann ernenne ich einen Hinterhergeher und einen Vorausgeher, und alle vier müssen den Prinzen auf allen seinen Gängen begleiten und ihn auffangen, wenn er in ihre Richtung fallen sollte.«
Isabella verschlug es die Sprache; aber die Kinderfrau räusperte sich und sagte: »Mit Verlaub, Majestät, wie stellen Sie sich das vor, wenn das Kind durch eine schmale Tür geht? Sollen sie sich zu dritt hindurchquetschen?«

Ferdinand runzelte die Stirn. »Im Schloss gibt’s {24}keine schmalen Türen. Und wenn’s dennoch eine gibt, werde ich sie erweitern lassen.«
»Mann«, sagte die Königin, »mit dir ist’s ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Nochmals vier Bedienstete? So was Dummes! Denk doch ein bisschen nach. Was nützt ein Vorausgeher? Der sieht ja gar nicht, was hinter seinem Rücken passiert.«
»Dann geht der Vorausgeher eben rückwärts«, sagte der König, »so kann er den Prinzen im Auge behalten.«
Wieder versuchte Isabella, ihren Mann daran zu hindern, seinen unvernünftigen Plan auszuführen; aber wieder hatte sie die Minister gegen sich, die gehorsam nachplapperten, was der König sagte. Ein paar Tage lang stritt sie sich bei jeder Mahlzeit mit Ferdinand; dann gab sie klein bei. Wenn Jan erst richtig sprechen kann, dachte sie, wird er sich schon selber wehren.
Um die Bewacher zu bezahlen, brauchte der König nochmals mehr Geld, und jetzt blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als die Steuern zu erhöhen. Die Leute murrten. Doch der Ausrufer wurde begleitet von der königlichen Armee, und das schüchterte die Untertanen derart ein, dass sie ablieferten, was der König verlangte.
»Dreißig Gläser extra!«, sagte Otto, der {25}königliche Zwetschgenkompottlieferant, zu seiner Frau. »Ohne dass er mehr bezahlt! Und alles nur wegen dieses verwöhnten Balges!«
»Reg dich nicht auf, Otto«, sagte Gerda, seine Frau. Sie badete gerade ihre Tochter Sophie draußen im Bottich. »Der Prinz kann ja nichts dafür. Stell dir vor, er ist nur wenig älter als unsere Sophie.« Sie hob das Mädchen aus dem Bottich und rieb es mit einem Tuch trocken. Sophie quietschte vor Vergnügen. Sie riss sich los und rannte zum Vater. Der hob sie lachend auf die Schultern, wieherte wie ein Pferd, rannte mit ihr quer durch den Garten und im Zickzack wieder zurück.
»Otto«, warnte seine Frau, »du lässt sie fallen.«
»Wir sind hier nicht im Schloss«, entgegnete der Vater und setzte mit einem verwegenen Sprung über ein Gartenbeet.
 {26}in welchem König Ferdinand das große E verbietet und einen Buchstabenwegschneider anstellt
{26}in welchem König Ferdinand das große E verbietet und einen Buchstabenwegschneider anstelltDer Prinz wuchs zu einem blassen und ängstlichen Jungen heran, der ständig von Bewachern umgeben war. Spielen durfte er nur mit einem kleinen Ball. Der war rund und glatt, und Jan ließ ihn immer wieder fallen. Mit der Zeit begnügte er sich damit, den Ball auf dem Boden zu seinen Bewachern zu rollen, und diese rollten ihn sanft zurück.
Außer dem Insektenjäger, dem Wegfreiräumer, den beiden Nebenhergehern, dem Hinterher- und dem Vorausgeher stellte der König noch zwei Treppenhochträger, einen Lebertranverwalter und einen Kleidervorwärmer an. Nochmals wurden die {27}Steuern heraufgesetzt; aber da der König gleichzeitig die Armee um drei Soldaten verstärkte, wagte niemand aufzumucken.
Isabella versuchte, sich ins Unvermeidliche zu fügen.
»Der Junge wird ja trotzdem groß«, sagte sie sich. »Er soll halt lernen, seinen Kopf anzustrengen.«
Schon früh lernte Jan lesen und schreiben. Er durfte jedoch nur dünne Bücher in die Hände nehmen; allzu dicke hätten ihm auf die Zehen fallen können. Ferdinand wollte zuerst, dass sein Sohn nur die Buchstaben ohne Ecken lerne; wenn Jan sich an eckige Buchstaben gewöhne, so sagte er, werde er bestimmt die Gefahren übersehen, die mit ihnen zusammenhingen. Also brachte Stanislaus dem Prinzen lediglich die Buchstaben C, I, O, Q, S und U bei. Er schrieb sie mit Kreide auf eine Schiefertafel, und Jan, der ihm aufmerksam zusah, setzte die Buchstaben im Kopf zusammen zu OI, UI, SIC und so fort. Doch nach ein paar Wochen sah selbst der König ein, dass sich daraus keine sinnvollen Wörter bilden ließen. Außerdem merkte er, dass C, I, Q, S und U in gefährliche Spitzen ausliefen und eigentlich nur das große O übriggeblieben wäre. Doch was ließ sich schon mit einem O ausdrücken? Widerstrebend erlaubte Ferdinand seinem Sohn, {28}das ganze Alphabet zu erlernen – mit Ausnahme des großen E. Das große E, so sagte der König, gleiche aufs Haar einer Gabel, und es schaudere ihn beim Gedanken, dass sein Kind sich an einem solchen Mordinstrument aufspießen könne. Und so stellte Ferdinand einen königlichen Buchstabenwegschneider ein. Der hieß Maximilian; er war vorher Schneider gewesen und daran gewöhnt, feine Stiche zu nähen. Jetzt musste er dafür sorgen, dass in den Büchern des Prinzen keine großen E mehr enthalten waren; mit seinem Scherchen schnitt er sie rasch und sauber aus.
Sobald Jan buchstabieren konnte, verlangte er nach Geschichten; denn sie erzählten von Dingen, die er nicht kannte, vom Himmel, vom Wald, von anderen Kindern, und je mehr er las, desto mehr hatte der Buchstabenwegschneider zu tun. Von früh bis spät saß er, ein aufgeschlagenes Buch vor sich, in einer Kammer, von der Jan nichts wissen durfte, und die E, die er herausschnitt, bedeckten den Boden wie Schneeflöckchen. So hatten die Bücher, die Jan bekam, auf jeder Seite ein paar Fensterchen, die einen hübschen Durchblick auf die nächste Seite gewährten. War das vielleicht ein unsichtbarer Laut, den man sich denken musste? Mit der Zeit gewöhnte sich Jan so sehr daran, dass er die {29}großen E auch beim Sprechen wegließ. Für ihn gab es im Sommer manchmal rdbeeren (natürlich zermanschte); er fürchtete sich vor scharfen cken; er aß morgens ein i (das heißt nur das Gelbe davon); er dachte, ein gutes Kind müsse seine ltern lieben.
Eines Tages bemerkte Ferdinand, dass sich die Sprechweise seines Sohns verändert hatte. Als ihm der Zusammenhang aufging, erschrak er ein weiteres Mal. »Schlimm, schlimm«, sagte er zur Dienerschaft, die er wie jeden Abend um sich versammelt hatte. »Wenn wir so reden, wie wir bisher geredet haben, kann der Prinz das E ja hören! Jan ist ein kluges Kind, und vielleicht entdeckt er schon bald, dass da etwas nicht stimmt. Und dann wird er alles daran setzen, das Geheimnis aufzuklären. Schrecklich! Ich befehle, dass ab heute im Umgang mit dem Prinzen kein großes E mehr ausgesprochen werden darf. Kein …«, er räusperte sich, »kein Dingsda mehr auf dem Papier, keines mehr beim Reden. Alles klar?«
Die Diener – Raimund und Stanislaus, der Insektenjäger, die beiden Nebenhergeher, der Hinterher- und der Vorausgeher, die Treppenhochträger, der Kleidervorwärmer, der Lebertranverwalter und der Buchstabenwegschneider – sahen einander betreten an.
{30}»Mit Verlaub«, sagte der Hinterhergeher. »Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin ja nicht viel gescheiter als ein Esel …«
»Sel, Sel!«, schrie der König, und alle Diener zuckten zusammen. »Es heißt Sel, du Einfaltspinsel …« Der König erstarrte und horchte dem Klang seiner eigenen Wörter nach; dann verbesserte er sich: »Ah … ich meine natürlich Infaltspinsel, du bist ein Infaltspinsel, und trotzdem wirst du lernen, so zu sprechen, wie ich’s befehle.«
»Wie Sie wünschen, Majestät«, sagte der Hinterhergeher.
Die neue Sprechweise bürgerte sich rasch ein, und nicht nur im Schloss. Die Leute ärgerten sich zwar über die höheren Steuern, und sie schimpften auf den verzärtelten Prinzen, dessen Schutz so viel kostete; aber es gehörte für einige Zeit zum guten Ton, beim Sprechen das große E wegzulassen, und als der König sogar ein paar Monate lang die kleinen Anfangs-e wegließ, ahmten sie ihn auch darin nach.
Für Isabella allerdings war das E-Verbot einer der Gründe, weshalb sie sich wieder häufiger mit ihrem Mann zankte.
»Das ist doch dummes Zeug«, sagte sie. »Was kann ein E dem Kind schon antun?«
Ferdinand hielt sich die Ohren zu. »Bitte, {31}Isabella«, sagte er mit gequälter Miene. »Bitte, rwähne dieses … Dingsda nicht. Wenn ich’s höre, geht’s mir durch Mark und Bein. Und was muss rst das Kind rdulden!«
»Ach Gott«, sagte die Königin, »wenn’s dir so wichtig ist, dann versprech ich dir’s halt.« Sie zögerte einen Augenblick; beinahe erschrak sie selber über den Gedanken, der ihr gekommen war.
»Aber du schuldest mir eine Gegenleistung«, sagte sie.
»Ine Gegenleistung? Was denn?«