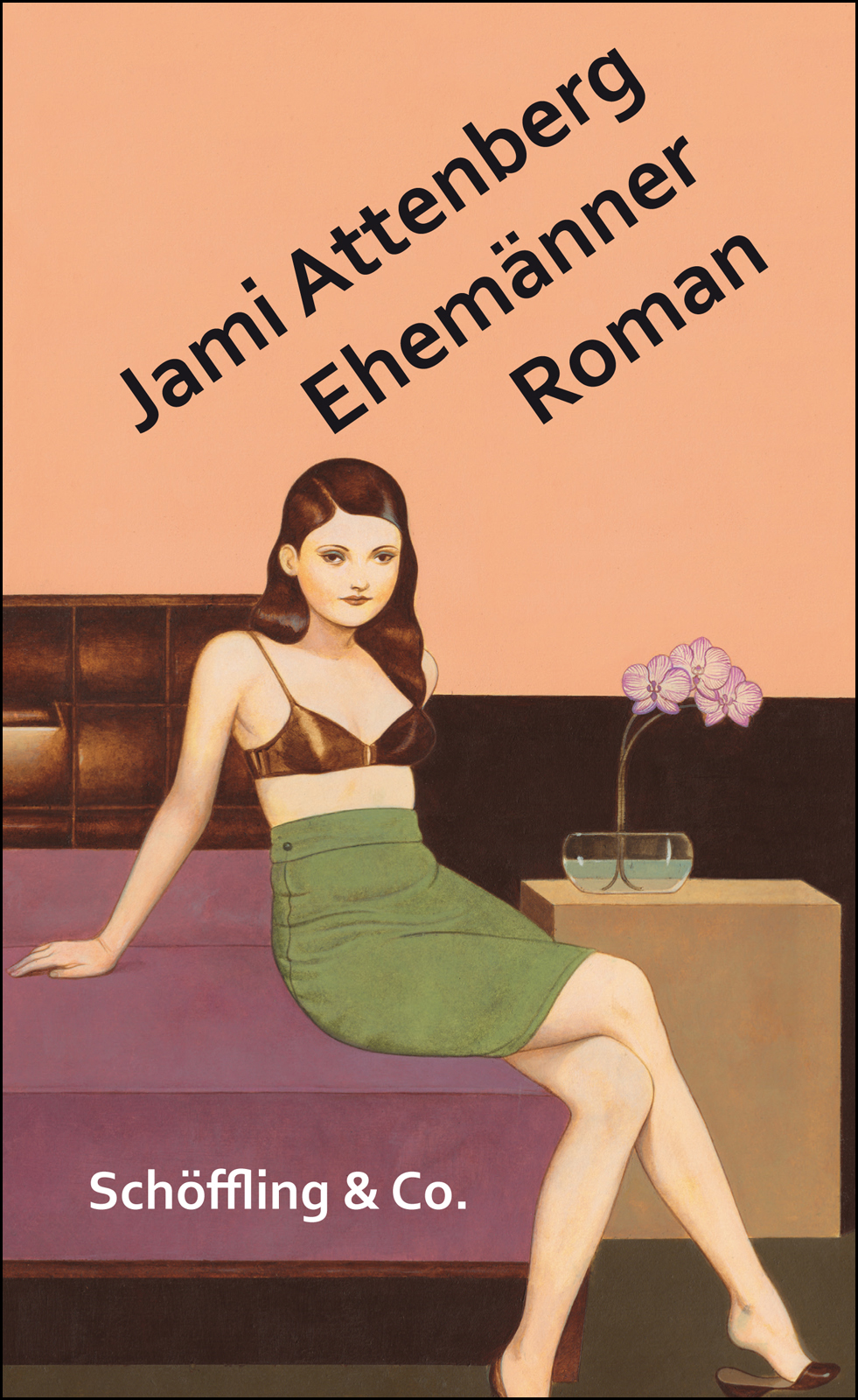
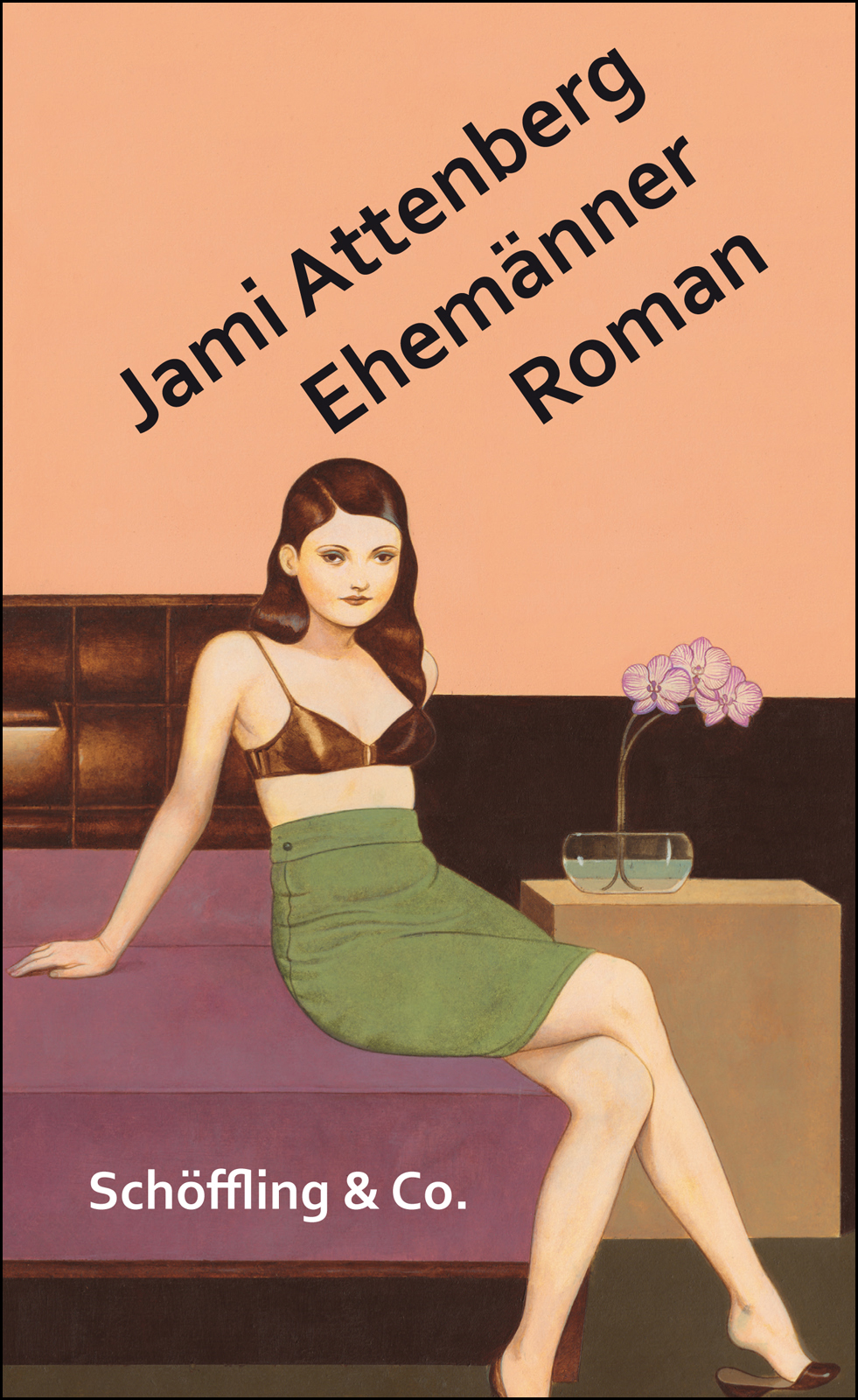
Inhalt
[Cover]
Titel
Prolog
ERSTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
ZWEITER TEIL
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
DRITTER TEIL
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
EPILOG
Danksagung
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
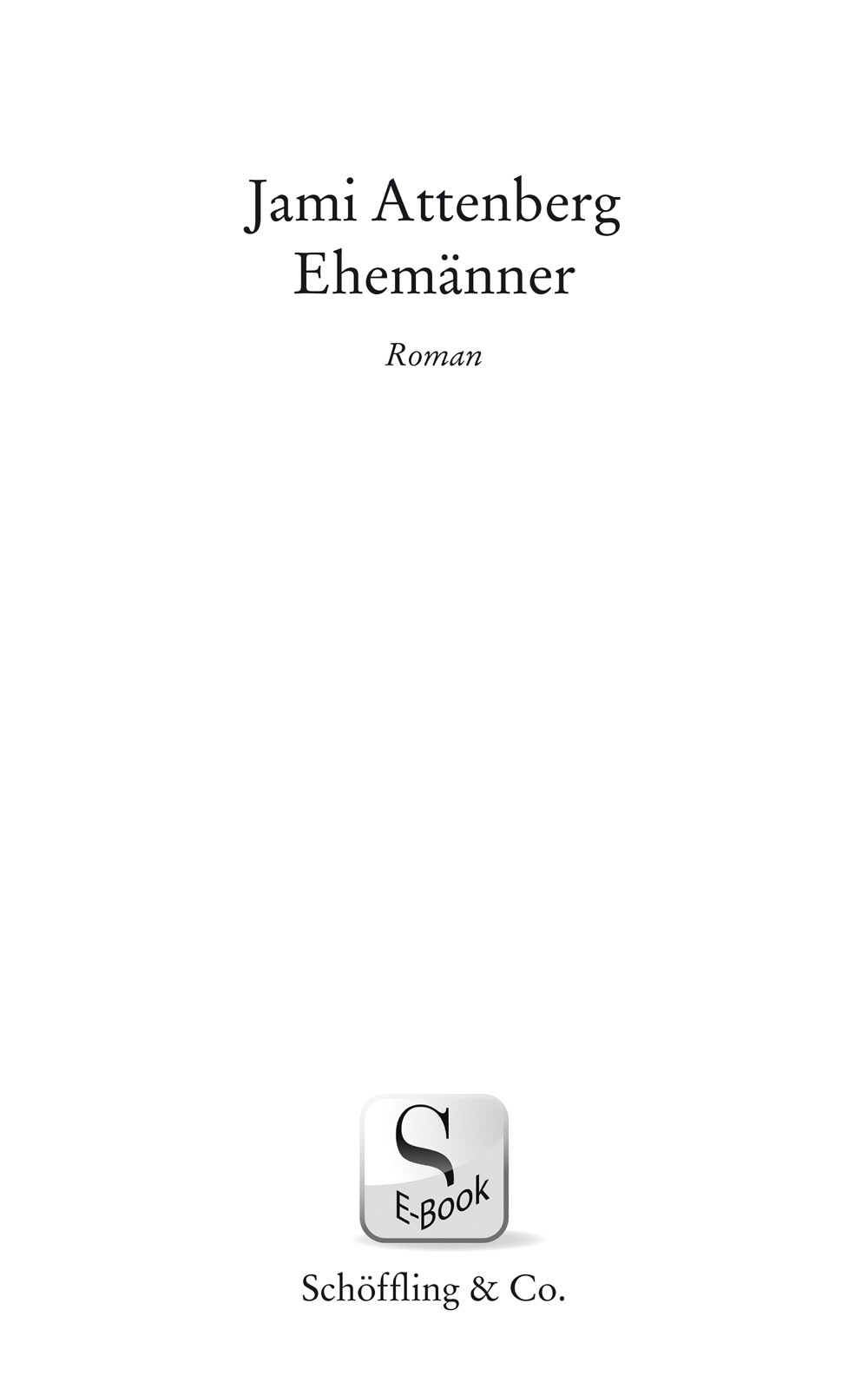
Ehemänner
Prolog
Ich warte auf den Tod meines Mannes, sechs Jahre schon. Martin liegt im Koma, seit er sich in seinem Atelier den Kopf angeschlagen hat – schlimm natürlich, er hat sich nicht einfach nur ein bisschen gestoßen und ist deswegen (fast) für immer gegangen. Zuerst entstand ein Aneurysma, so eine Art Explosion im Kopf, und dann stürzte er von der Leiter, auf der er gerade stand, aus fünf Metern Höhe, schlug mit dem Kopf auf ein Bild, auf das gleich daneben und auf die Kante einer Staffelei, um schließlich auf einer Farbdose zu landen, klarblaue Ölfarbe, die umkippte und auslief und sich mit dem Blut vermischte, das aus seinem Kopf zu rieseln begann, sodass ich, als ich ihn fand – o ja, ich habe ihn gefunden, als ich zurückkam von meinem Morgenspaziergang am Wasser, ungefähr eine Stunde nach dem Sturz, aber keine Sorge, wenn ich früher nach Hause gekommen wäre, hätte das auch nichts genutzt, haben die Ärzte gesagt, er war durch den Aufprall nämlich schon längst hinüber –, sodass ich zunächst dachte, er würde bloß schlafen in diesem Meer aus Farbe, dieser misslungenen Mischung. (Lila? Er hasste Lila.) Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er auf dem Boden im Atelier ein Nickerchen hielt. Manchmal verbrachte er dort auch die ganze Nacht, statt durch die Tür und dann durch noch eine zu gehen, in unser Bett.
Aber dann sah ich die Staffelei und dass das zweite Bild – eine beeindruckende Arbeit, das Konterfei einer Frau, die starke Ähnlichkeit mit seiner Mutter in jüngeren Jahren aufwies; die Frau hält ein Kreuz aus grellroten Glühbirnen wie an der Bühnenrampe eines Striplokals und hat denselben friedlichen, unheimlichen Ausdruck, so was Glasiges in Lächeln und Blick, und diese Grauschattierungen an unvorteilhaften Stellen, die charakteristisch für Martins Bilder sind –, dass dieses zweite Bild umgekippt war und mit der Rückseite auf dem Boden lag. So nachlässig war Martin nicht. Sein gesamtes Werk stand sauber nach Jahr und dann nach Sujet und dann nach Titel geordnet da, als könnte es jederzeit irgendwer katalogisieren wollen, wie es in der Tat öfter vorkommt, seit Martin ins Koma gefallen ist – gefallen, wie in eine Grube, man kann es nicht anders sagen, eine Grube, aus der man nie wieder herauskommt.
Ich kniete mich hin in meinem Sommerrock, gelb, das weiß ich noch, wie ein saures Zitronenbonbon, meine bloßen Knie drückten ihren Umriss in die Farbe neben ihm, ich fasste seinen Kopf an, ich versuchte, ihn umzudrehen, aber er war so schwer, ich sagte: »Martin«, er sagte nichts, und dann sagte ich seinen Namen noch mal, nur lauter, aber immer noch nichts, dann gab ich ihm einen Klaps, er rührte sich nicht, und dann rief ich: »Martin Martin Martin.« Und dann war da der Krankenwagen und das ganze Programm, und ich mit Martin im Krankenhaus, Farbe in seinem Gesicht, Farbe auf meinen Knien, und wir beide waren dort die schrägsten Vögel, wie immer, nur dass ich diesmal niemanden zum Reden hatte außer mir selbst.
Danach habe ich dann sechs Jahre gewartet, auf ganz unterschiedliche Weisen gewartet. Warten auf Ärzte und Untersuchungsergebnisse und endgültige Ansagen (auch wenn im Grunde nie etwas endgültig war) ist ein ganz anderes Warten, als im Krankenhausfoyer auf den Fahrdienst zu warten, der mich spätnachts zurück nach Brooklyn bringt, gehüllt in eine weiche, kleine, aus seinem Zimmer geklaute Decke. Warten auf den Rückruf seiner Eltern, die, als sie es erfahren, sofort zu beten beginnen, oder den seines besten Freundes, der nur noch unentwegt flucht, ist anders, als auf den Anruf eines Anwalts zu warten, der nur Geschäft und null Hoffnung vermittelt, oder den einer besorgten Kleingaleristin, deren Leben nun nicht mehr dasselbe ist. Warten auf den Beginn der Besuchszeit ist anders, als auf das Ende der Besuchszeit zu warten. Warten auf die Pflegerin mit seinen Medikamenten ist anders, als auf den Apotheker mit meinen zu warten; den Tabletten, die helfen, eine Nacht durchzuschlafen. Warten auf einen Platz im ersten Pflegeheim, dem ersten, das ihn nehmen wird, o bitte nimm ihn doch jemand, ist anders, als auf endlich offene Türen im zweiten Pflegeheim zu warten (dem preisgekrönten, über das man tuschelt und für das man betet, einfach traumhaft, dieses Heim, heißt es). Warten auf den ersten Arzt ist anders, als auf den letzten Arzt zu warten, auf den, der einem sagen wird, was man schon weiß. Warten auf Martins Erwachen ist ein ganz anderes Warten, als darauf zu warten, dass er stirbt.
Erwachen. Sterben. Warten.
ERSTER TEIL
1.
Es ist Frühling heute, endlich, als ich mich hier in Williamsburg auf die Suche nach einem vernünftigen Waschsalon mache. Türkisblauer, wolkenloser Himmel, im Gully häuft sich, was der Regen letzte Nacht hingespült hat. Ich verlasse meine Wohnung und halte mich links in Richtung Bedford Avenue, vorbei an einem Mann, der mit einer Plastiktüte auf dem Boden kauert, neben ihm träge sein Hund, vorbei an der Brooklyn Brewery, vorbei an dem coolen Plattenladen, für den ich keine Verwendung mehr habe, obwohl ich mir immer wünsche, dass es anders wäre. Auf der Bedford stelle ich fest, dass es all diese vorsintflutlichen Läden noch gibt, die mit den schmuddeligen Fußböden, dem quälenden, die Poren vergrößernden Neonlicht, dem deprimierenden Dröhnen spanischer Musik zum Kreisen abgewetzter Unterhosen in Uraltmaschinen. An der Scheibe ein Aushang, Mitbewohner gesucht, daneben bietet jemand Gitarrenstunden an. Hier kann man auch faxen und Kopien machen. Lange Öffnungszeiten. Ein Kaugummiautomat sammelt armseliges Kleingeld für einen wohltätigen Zweck. Kaum vorstellbar, dass die Maschinen in einer solchen Umgebung imstande sein sollen, meine Sachen sauber zu kriegen. Sie können die Flecken vielleicht malträtieren, bis sie sich ergeben, aber ihnen den Garaus machen ganz sicher nicht.
Ich gehe weiter über die Bedford in Richtung Süden, den Wäschesack auf dem Rücken, vorbei an den gerade erst aus dem Boden geschossenen Restaurants: eine Gourmetpizzeria, die den Duft selbst gezogener Kräuter absondert, ein neuer Bagel-Laden als Konkurrenz für den älteren weiter unten an der Bedford, und gegenüber ein schicker Chinese mit verzierter Fassade und einem Schild, das nach hinten raus einen Garten verspricht. Und jede Menge Klamottenläden und Möbelläden und Läden mit lauter Kram, Zeug, von dem man irrtümlich meint, dass man es braucht, zum Beispiel mundgeblasene Glaskerzenhalter und Hanf-Handtaschen und importiertes Körpersalzpeeling aus Costa Rica. Als ich vor Jahren hierher zu Martin gezogen bin, gab es in dieser Gegend nur Delis und Pizzerien und ein paar polnische Metzgereien. Ich bin froh, dass die Greenpoint Tavern noch da ist, eine schmuddelige, alte polnische Bar, in der es Bier aus Styroporbechern gibt. Beim Anblick all dieser Veränderungen ist mir, als bräuchte ich ein Bier, und fast wäre ich reingegangen, aber es ist erst elf Uhr.
Normalerweise laufe ich am Wasser entlang, wenn ich meine Wohnung verlasse. Falls ich meine Wohnung verlasse. Das gleichmäßige Donnern der Laster ist mir lieber als das Stimmengewirr junger Hipster auf der Bedford. Geräusche von Rädern auf Schotter, wenn sie in Schlaglöcher schlingern. Ein staubiges Stück aufgerissene Straße vor verdreckten Lasterplanen. (Ich denke an diesen dreckigen Kleinen aus den Peanuts-Comics – Pig Pen –, wenn ich dort entlanggehe. Immer verfolgt von einer dunklen Wolke.) Doch es gibt Tage, an denen ich gezwungen bin, mit der Welt in Kontakt zu treten, Tage, an denen mir mein sorgfältig konstruiertes Universum nichts nutzt. Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputtgeht – ein Rütteln, Metall knirscht an Metall, und Ende –, ich aber zu pleite bin, um einen Handwerker zu rufen. Ich würde so gern als elegante Frau hoch oben in einem Loft empfindsam meinen Mann betrauern. Aber selbst Jackie O. brauchte saubere Schlüpfer.
Kurz vor der Metropolitan Avenue sehe ich zwei Punks in vor Dreck ergrauten Klamotten, schwarze Hosen, schwarze Springerstiefel, einer in einem T-Shirt, auf dem mit dickem Filzstift gekritzelt »Fuck You« steht, der andere in einem zerfetzten Hemd, das aber irgendwie hält und sich trotzig dagegen wehrt, ein Lumpen zu sein. Sie hocken vor einer Ziegelwand voller Graffiti, keine wilden, aufrührerischen, sondern von der Verwaltung in Auftrag gegebene Graffiti, man achtet nämlich darauf, Gebäudewände abschnittsweise an einschlägige Vandalen zu vergeben, damit sie keinen Ärger machen.
Etwas in mir erwärmt sich für diese Punks, diese Relikte vergangener Jahre, als es im Viertel noch sehr viel chaotischer zuging. Sie halten mir die Handflächen hin, und der mit dem »Fuck you«-T-Shirt sagt: »Gibst du mir ein Bier aus?«
»Klar«, sage ich. Ich stelle meinen Wäschebeutel auf dem Boden ab, schiebe die Hand in die Hosentasche und ziehe einen Dollarschein hervor, den ich ihm in die Hand drücke. Ich bin ihnen schon etwas schuldig dafür, dass sie ihre Rolle in meinem Leben spielen. So ist es immer, wenn ich das Haus verlasse. Jedes Mal kommt es mir vor, als würden sich die Leute zu Gruppen zusammentun, um dann loszulegen, nur für mich eine Show abzuziehen. Und nie kommt es mir vor, als hätte ich teil an meiner Umgebung. Ich stehe einfach da und schaue zu, außerhalb meiner selbst, außerhalb der Welt, in die ich irgendwie nur hineinblicke.
»Danke, Ma’am«, sagt er. Er hat hübsche, konzentrierte blaue Augen. Die Pupillen sind wie Steine.
»Hast du oft Glück?«, frage ich.
»An manchen Tagen«, sagt er. »Meistens laufen hier nur so geizige Drecks-Yuppies rum.« Er schaut mich an in meinen gepflegten Bluejeans, dem albernen rosa Kaschmirpullover, den Martin mir mal zu Weihnachten geschenkt hat, und der Spange, die meine kurzen schwarzen Haare zurückhält. »Nichts für ungut«, sagt er.
Als sich an der Ecke zwei ranke junge Frauen in kurzen Röcken und hohen Stiefeln zum Abschied umarmen, brüllt der andere Punk: »Und wer drückt mich?« Die Frauen drehen sich nach der Stimme um, lächeln dann matt, trennen sich und gehen in entgegengesetzte Richtungen davon.
Er rempelt seinen Freund an. »Hast du das gesehen? Die waren kurz davor, es zu machen.«
»Abends ist besser«, erklärt er dann. »Wenn alle besoffen sind.« Er zuckt mit den Schultern. »Aber schließlich habe ich heute sonst nichts zu tun.«
Das hatte ich verstanden.
Ich bücke mich, nehme den Wäschebeutel und wuchte ihn auf meine Schulter.
»Willst du abhängen?«, fragt er. »Wir könnten Party machen oder so. Wenn du noch Geld hast, ich hab eine Nummer.« Er klopft auf seine Hosentasche.
»Waschtag«, sage ich.
»Wäsche. Ja. Muss ich irgendwann auch mal machen.«
Ich lache, er lacht, ich gehe los. Ich werde mich hüten, meine Zeit mit Nervereien oder auch nur mit Getrödel zu verschwenden.
An der Ecke suche ich den Horizont ab. Rechts, ein paar Blocks weiter, hinter dem YMCA, ist ein Waschsalon, der auch Postdienste anbietet. Gleich rechts von mir eine Baustelle. Aber da links, da ist er doch, ein riesiger, blanker, neuer Waschsalon. Ich nehme es mir ein bisschen übel, das Neue zu wollen, und fühle mich meinem alten Viertel gegenüber irgendwie illoyal, aber hier geht es nicht um ein lokal gebrautes Bier für sechs Dollar gegen Budweiser im Styroporbecher, hier geht es um meine Klamotten, die letzten Spuren von Identität, die mir geblieben sind. Wenn ich es noch schaffe, gut auszusehen, ein bisschen nur, dann schaffe ich es auch, noch etwas durchzuhalten, für mich, für Martin.
Einen halben Block weiter stehe ich schließlich davor, betrachte die hohen Glasscheiben, das Lagerhausambiente. Da drin stehen locker hundert Maschinen, es gibt ein Galaga-Videospiel, einen Internetarbeitsplatz und einen Sitzbereich mit den üblichen, IKEA-mäßigen Möbeln: heller Holztisch mit Sesseln, dazu eine graue Couch, die aussieht, als wäre sie ganz bequem. Im Waschsalon ist kein Mensch, doch die Maschinen – ein einziges spektakuläres, metallisches Wirbeln – sind in Bewegung. Von hier draußen kann ich die Vibration geradezu spüren, das Wasser, den Schaum, die wilde Wucht des Reinigens.
Ich trete ein, setze meinen Beutel ab und ziehe ihn dann zu den Gängen hinter mir her. Die quadratischen Bodenfliesen sind neu und glänzen immer noch makellos. Von oben kommt Technomusik, deren Wummern den Rhythmus der Maschinen durchdringt. Ein Tanz-Club für Waschmaschinen. Kellner, wo bleibt mein Cocktail? Wie entzückend und absurd. Hier kann ich richtig gut meine Klamotten waschen.
Am Empfangstresen steht ein junger, unbehaarter kleiner Asiate mit winzigen, flinken Händen neben einer älteren Frau, die geformt ist wie ein Geschoss. Sie hat dunkle Haut und gezupfte Augenbrauen. Sie wedelt mit den Händen vor der Kasse herum, und ihre zigarettengegerbte, tiefe Stimme klingt matt.
»Kann ich nichts für«, höre ich sie sagen.
Ich suche mir einen Gang aus – rechts? Links? Nein, genau in der Mitte – und gehe ihn entlang, während mein Beutel hinter mir herkriecht wie eine Riesenschnecke.
Normalerweise mache ich gern die Wäsche. Es gibt mir das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ich kann dafür sorgen, dass sich ein ganzer Tag um nichts anderes dreht. Rotes in eine Ladung, Gelbes in eine andere. Eine Ladung Weiß mit viel Bleiche, eine Ladung Feinwäsche. Alle anderen Farben gehen zusammen, und dann noch eine Ladung für alles, was mit Denim zu tun hat. Jeans, Röcke, eine Jacke und eins von Martins alten Arbeitshemden, in dem ich manchmal schlafe, mit Farbflecken, die für immer in den Stoff gedrungen sind. Wenn man selbst eine Waschmaschine und einen Trockner und massenhaft Zeit hat, gibt es unendliche Möglichkeiten. Aber draußen in der Welt, im Waschsalon, heißt es rein und raus, an die Arbeit, keine Zeit verschwenden. Effizienz. Tempo. Präzision.
Also: Münze, Waschpulver, Start.
Ich schlurfe zurück zum Sitzbereich vorn, suche mir die Couch aus, ziehe die Füße unter mich. Ich nehme ein Village Voice-Heft, das neben mir liegt. Auf dem Cover ist eine Band, ein ziemlich verwegener Haufen älterer Männer, verhärmter Blick, zerwühlte Haare. Der in der Mitte trägt eine dunkle Nerdbrille, und er lächelt. Die sind jetzt angesagt, teilt mir das Cover mit. Super Band, von der du noch gar nichts wusstest. Passt auf, was ihr euch wünscht, denke ich.
Die Eingangstür fliegt auf, und drei Männer kommen herein, in einer Flut gelben Sonnenlichts, so hell, dass es mir in den Augen brennt. Einer hat ein Notizbuch und einen Kaffee dabei, der nächste schiebt mit einer Hand einen Kinderwagen und hält einen Kaffee in der anderen, und der dritte hat nur einen Kaffee. Sie lachen, sie lächeln. Das sind Freunde, denke ich. Und bin sofort neidisch, ich habe nämlich keine Freunde mehr, jedenfalls keine Freunde wie die. Freunde, mit denen man durch die Stadt streift. Freunde für ein schnelles Bier und ein Schwätzchen. Freunde, mit denen man die Wäsche macht. Spaß hat, eben.
Nein, die Freunde, die ich habe, machen meistens gar keinen Spaß, auch wenn es den Anschein hat, dass es uns zusammen eigentlich gut gehen sollte. Ich habe Alice, Martins Galeristin, eine extrem herbe Britin – schon beim Gedanken an sie zieht sich alles in meinem Gesicht zusammen –, die sich um meine finanziellen Belange kümmert und mich gelegentlich mit Klatsch aus der Kunstszene und vagen Komplimenten hinsichtlich meiner Loyalität belohnt. Ich bin mir relativ sicher, dass sie mich so wenig mag wie ich sie. Und ich habe Davis, Martins besten Freund, einen leicht entflammbaren Mann aus Tennessee, der gern mit mir von alten Zeiten träumt und mich gelegentlich zu lange zu fest hält. Mit beiden verbinden mich Schnüre, die an so vielen Körperstellen befestigt sind, dass ich mir in ihrer Nähe vorkomme wie eine Marionette. Das sind nicht die Freunde, die ich brauche, aber es sind die Freunde, die ich habe.
Der mit dem Notizbuch sieht mich auf der Couch, zögert, schaut mich an, als wäre ich fehl am Platz – Was machst du auf meiner Couch? –, und setzt sich dann in den Sessel schräg gegenüber. Die anderen beiden beachten mich gar nicht, der mit dem Kinderwagen setzt sich an das entgegengesetzte Ende der Couch, und der Dritte pflanzt sich in den Sessel mir gegenüber und dreht ihn prompt so, dass er nur die beiden anderen sieht. Ich schlage die Voice auf und versuche, sie meinerseits nicht zu beachten. Aber das ist unmöglich: Der Mann mir gegenüber sieht aus wie ein Filmstar, ganz schlank und straff, und ist von der Brust über die schmale Taille bis zur Hüfte – seine Sachen sehen aus, als würden sie an ihm herunterrutschen, und tatsächlich hängt die Hose gefährlich tief auf der Hüfte – eine einzige klare Linie, aber nicht starr oder abweisend, nur wohlgeformt, und dann hat er so einen großen Kopf, der irgendwie mehr auffällt als alles andere, als würden die dünnen Linien des Körpers meinen Blick zu seinem Gesicht führen, in dem sich die Ethnien geheimnisvoll mischen – der Teint sieht nach Nahem Osten aus, die großen blauen Augen stammen aus Norwegen oder Schweden, die Form der Nase ist römisch, von einer Statue aus so einem versteckten Raum im Metropolitan Museum, wo die bröselnden alten Stücke stehen, und diese glatte Haut, die eher zu einer Frau passen würde, als hätte er sich sein Leben lang keinen einzigen Tag rasieren müssen, und dann endlich sein Kinn, einfach vollkommen, das letzte, an die richtige Stelle gedrückte Teil eines Puzzles. Der mit dem Baby – ein Mädchen, glaube ich, es trägt Rosa, von meinem Platz aus kann ich die Füße in den Schuhchen sehen – erinnert mich an die Männer aus Martins Familie, ein handfester Weststaatler mit breiter Brust, massigem Körperbau und blondem, hier und da ergrautem Bart, passend zum Grau seiner Schläfen, überall wild behaart, auch auf der Brust, ich kann sehen, wie sie aus seinem Hemd quellen, kleine Löckchen, dunkler als die Haare auf seinem Kopf. Der mit dem Notizbuch trägt genau dieselbe Brille wie der auf dem Cover der Voice, und er hat dichte Koteletten, denen mein Blick folgt bis zur schicken, dunklen Frisur, aus der ihm eine freche Locke über die Stirn bis in die Augen hängt, die goldbraun sind und freundlich wirken, aber daran glaube ich nicht, der Zug um seinen Mund ist zu ironisch für jede Form von Aufrichtigkeit, und mir wird klar, dass ich ihm gern ins Gesicht sehe, weil ich nicht weiß, was da eigentlich vorgeht, ah, aber dann ist da auch noch der Rest von ihm: groß, richtig groß, lange Beine, und ich stelle mir vor, dass da Muskeln sind unter seiner Jeans, fein geschliffen wie ein guter Satz Messer, alles in Form, genau wie seine Arme, denn die kann ich sehen, sie sind gebräunt und wölben sich unter den kurzen Ärmeln des lockeren, sportlichen Hemds, und auch seine Füße sind lang, lange Zehen, die sich aus blauen Flipflops recken, und vom Hals abwärts ist er eine einzige lange, vollkommene Linie.
Wenn ich sie ansehe, ist es wie damals, als Martin mich öfter fotografierte, nachts, auf dem Dach unseres Hauses, mit einer seiner abgeranzten alten Kameras: ein Knall, ein Blitz, ich bin geblendet, und dann kann ich sehen. Plötzlich will ich sie unbedingt kennen, alles über sie wissen. Es ist schon sehr lange nicht mehr vorgekommen, dass ich jemanden kennenlernen wollte.
Der mit dem Notizbuch beugt sich vor, wachsam, wobei seine dunklen, dichten Koteletten für einen angestrengten Gesichtsausdruck sorgen, und sagt: »Okay, also, der kleine Bruder von meiner Frau, der wohnt seit zehn Jahren in Texas. Austin. Arbeitet im IT-Bereich, ist zur rechten Zeit eingestiegen, zur rechten Zeit ausgestiegen, zur rechten Zeit durchgestartet und hat einen Haufen Kohle gemacht. Stinkt vor Geld. Wie alle in der Familie meiner Frau.«
Der Filmstar mir gegenüber verdreht daraufhin die Augen. Mitfühlend.
»Letzten Winter fährt er in Urlaub. Skifahren, irgendwo in Montana. Da in der Nähe von Yellowstone, so ein kleiner Fliegenfischerort irgendwo. Dort wurde Aus der Mitte entspringt ein Fluss gedreht oder so. Er hat uns gefragt, ob wir mitwollen, aber Lily wollte nicht. Ich fand ja, dass das bestimmt lustig wäre, aber sie wollte lieber braun werden. Jedenfalls, er fährt also mit ein paar Kumpels hin, und sie geben sich’s so richtig, fahren den ganzen Tag Ski, trinken die ganze Nacht. Ein Haufen reiche IT-Fritzen, die so tun, als wären sie Cowboys, was sie zu Hause in ihrer Stadt nicht können, die echten Cowboys in Texas durchschauen so was nämlich. Sie hängen da mit den Einheimischen ab, die totalen Freaks offenbar, ein Haufen Schwerstalkoholiker eben. So Spinner. Und mit diesen Einheimischen führt er richtig intensive Gespräche, über gar nichts. Und auf einmal sieht er eine Bedeutung in Kleinigkeiten, über die er nie nachgedacht hat. Die Berge. Die Bäume. Der Schnee. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Fische. Du musst mal kommen, wenn Saison fürs Fliegenfischen ist, erklären sie ihm. Das darfst du nicht verpassen. Du musst unbedingt sehen, wie die Sonne auf den Fisch fällt, wenn du ihn gerade gefangen hast. Ein Typ hält ihm einen Riesenvortrag über die Farben der Fische, sie sitzen eines Abends da und trinken Whiskey, und er hört einfach zu, was der da labert, und er hat mir erzählt, es war, als würde der Typ quasi singen.«
»Regenbogenforelle«, sagt der mit dem Kinderwagen. Er hat aufgehört, ihn zu wiegen. Die Sonne glänzt in seinen Haaren und seinem Bart.
»Dann ist der Urlaub vorbei, und er fährt nach Austin zurück. Er fängt das Fliegenfischen an, steigt richtig drauf ein. Er arbeitet nicht mehr am Wochenende und verbringt seine ganze Zeit da draußen am See. Lake Buchanan. Er tritt dem Verein bei, fängt an, mit diesen alten Fischertypen abzuhängen, an den Wochenenden zu trinken, wie in Montana. Im Grunde vollzieht er seine Montana-Erfahrung in Texas allmählich nach. Richtet sein Leben neu aus.«
Mir fällt ein, wie Martin einmal weggefahren ist, allein, in das Wochenendhaus seiner Familie im Staat Washington, nicht weit von der Grenze zu Oregon. Er wollte auch nicht wiederkommen.
»Und keiner kapiert’s«, sagt der Filmstar. Diese Haut, so schimmernd, so makellos und gebräunt.
»Keiner kapiert’s. Seine Freundin kapiert es nicht. Seine Freunde kapieren es ein bisschen, aber sie waren in Montana im Urlaub. Da fährt man hin, man hat seinen Spaß, man lässt alles hinter sich. Und dann geht man wieder an die Arbeit. Aber obwohl er fischt und seinen Spaß hat, kann er die Farben auf den Fischen nicht sehen, es ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Allmählich überlegt er, ob die Fische in Montana vielleicht anders sind, ob die Fische in Texas nicht so gut sind wie die Fische in Montana. Vielleicht muss er zurück nach Montana. Vielleicht ist das Fischen dort besser.«
Das Baby gurrt. Die Waschmaschinen drehen sich. Die Technomusik schwillt ab und wieder an.
»Gestern Abend hat er uns angerufen. Er ist in Montana. Er ist nicht nur in Montana, er bleibt auch dort. Jedenfalls bis auf Weiteres. Er ist in irgendein billiges Motel gezogen, er hat sich einen Job als Kellner gesucht, er hat den Typen gesucht, der ihm den Riesenvortrag über die Gottesnähe beim Fliegenfischen gehalten hat und immer noch jeden Abend an derselben Stelle in derselben Bar sitzt, und zu ihm gesagt: ›Bring mir alles bei, was du weißt.‹ Und der Typ sagt: ›Klar.‹ Tja, das macht er jetzt. In Montana.«
Die anderen beiden nicken. Das Baby gibt noch einen Laut von sich, diesmal etwas fordernder, und der Vater hebt es aus dem Wagen auf seinen Schoß. Er fängt an, es auf den Knien zu wippen.
»Lily rastet aus. Die ganze Familie. Das Telefon hat gestern Abend ununterbrochen geklingelt. Ich sage, lasst den Mann doch nach Montana gehen. Aber wisst ihr, kein Mensch schert sich darum, was ich meine.«
Die drei sitzen eine Weile da und schweigen. Ich blättere zu den Kleinanzeigen hinten in der Voice. Transsexueller Escort-Service. Körperarbeit. Jetzt anrufen.
»Ich hab da mal eine Woche gezeltet«, sagt der mit dem Baby. »Einen Sommer im College. Ich hab jede Nacht Sternschnuppen gesehen. Ich hab aufgehört, sie zu zählen, so viele waren es.« Er kippt seine Tochter nach unten, wobei er ihr stützend die Hand in den Nacken legt, und schwingt sie dann wieder hoch. Sie ist begeistert. Er macht es noch mal. »Sterne hast du gern, stimmt’s, meine Kleine? Stimmt’s?«
»Ich würde nicht nach Montana fahren«, sagt der Filmstar. »Ich würde irgendwohin auf eine tropische Insel fahren, in einer Strandbar arbeiten. Touristen das Geld abknöpfen. So richtig in einer Strohhütte wohnen.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, wegzugehen«, sagt der mit dem Baby. Er hält sein Gesicht ganz dicht an ihres, worauf sie ein winziges Händchen ausstreckt und ihm an die Nase fasst. »Du hast meine Nase«, sagt er. »Sie gehört dir.«
»Tja, ich überlege gerade, ob ich meine Frau wegen ihres Bruders verlassen soll«, sagt der Geschichtenerzähler, und alles lacht schallend, zu schallend, das war nämlich lustig und auch wieder nicht. »Ich könnte echt morden für eine Wohnung in der Stadt«, sagt er. »Mit Brooklyn bin ich fertig.«
Ich klopfe mit der Hand auf die Couch.
»Ich würde einfach ins Auto steigen und losfahren«, sage ich. Es wundert mich, dass ich spreche; meist bleiben die Worte in meinem Kopf gefangen und schaffen es nie aus meinem Mund, schon gar nicht vor Fremden. Und trotzdem war mir klar gewesen, dass ich mit ihnen reden musste. Sie strahlten so hell, dort vor mir. Wenn ich an diesem sonnigen Frühlingstag schon in der Welt unterwegs sein musste, würde ich es auch zur Gänze auskosten. »Ich weiß nicht, ob ich noch mal anhalten würde.«
Alle wenden sich mir zu, aber in sehr unterschiedlicher Form. Der Filmstar schaut mich von oben bis unten an und lässt sich dabei alle Zeit der Welt. Der mit dem Baby wirft mir einen kurzen Blick zu, nimmt dabei so viel wahr, wie er verarbeiten kann, was vermutlich nicht viel ist, und widmet sich dann wieder seinem Baby. Der Geschichtenerzähler klopft einige Male mit dem Notizbuch auf sein Bein und schaut mir in die Augen; er selbst sieht da drin ein bisschen tot aus, aber lebendig auch. Er weiß nicht weiter, genau wie die anderen.
»Läufst du vor etwas davon?«, fragt er. Ich spüre, wie ein Schauder durch meinen Körper zieht, winzige Messer innen an meiner Haut.
»Ich will nur wissen, wie es da draußen so ist«, sage ich, und das stimmt. Ich weiß nicht, was mir fehlt, aber ich weiß, dass mir etwas fehlt. Man sagt, New York ist die Hauptstadt der Welt. Man sagt, was immer man will oder braucht, in New York bekommt man es jederzeit. Man sagt, sie kann ein Leben für immer verändern, diese Stadt. Dass einem die Welt sofort offensteht, wenn man hierher zieht. Ich sage, New York ist eine Insel, und man kann sich hier genauso leicht verstecken wie überall sonst.
Wir machen uns bekannt. Mal heißt der mit dem Notizbuch. Scott der mit dem Baby, das Nina heißt. Tony der mit dem Filmstarkopf. Antonio, sagt er. Aber Tony ist schon okay.
Und ich, ich bin Jarvis, Jarvis Miller. Ja, komischer Name für eine Frau. Ist ein Familienname. Ein Großonkel.
Sie erzählen mir, dass sie jeden Dienstag herkommen, um ihre Wäsche zu machen, und dass sie ein kleiner Club sind.
»Was denn für ein Club?«, frage ich.
»Der Club der Ehemänner«, sagt Mal. Er lächelt breit. Sein Lächeln ist wie ein Lkw. Er hat mich gerade mit einem Lkw überfahren, denke ich. »Wir bleiben alle zu Hause, während unsere Frauen arbeiten gehen. Wir sind Bonvivants.«
»Mit dem guten Leben im Waschsalon«, sage ich.
»Hey, du Arsch, Mal, ich habe einen Job«, sagt Tony. »Ich bin Immobilienmakler.« Er zieht sein Portemonnaie aus der Tasche und reicht mir eine Karte, mit einem gewinnenden Lächeln, bei dem sich diese exotischen Lippen über schimmernde Zähne ziehen. »Falls du mal was suchst. Aber eigentlich bin ich Schauspieler. Ich gehe ständig zu Vorsprechen.« Hat er jetzt ganz kurz Nerven gezeigt? Ist ihm die Angeberei entglitten und muss er sie erst wieder vom Boden aufsammeln? Was immer es war, es löst sich rasch auf.
»Ich glaube dir«, sage ich.
»Ein Kind aufziehen ist viel Arbeit«, sagt Scott. »Das ist ein Vollzeitjob.«
Mal schaut mich an, mit diesem breiten Grinsen. »Klar, wir haben alle Jobs. Ich bin Schriftsteller. Ich schreibe einen Roman. Schau, wie ich schreibe.«
»Ich schaue ja«, sage ich.
»Ich bin sogar fast fertig damit«, sagt er.
»Wovon handelt er?«, frage ich.
»Davon, wie man seiner Frau auf der Tasche liegt«, sagt er. Er schluckt ein Lachen herunter, und keiner schaut ihn an. »Nee, es geht um Musik. Einen, der in einer Band spielt. Worüber sollte ich sonst schreiben?«
»Deinen Vater«, sagt Scott.
»Wer ist dein Vater?«, frage ich.
Mal nennt den Namen eines ehemals populären und inzwischen für seine Korruptheit berühmten Senators. Ich hatte die Zeitung gelesen wie alle anderen auch. Ich wusste, Mal hatte einen unehelichen Bruder in einem Vorort in Maryland. (Die Mutter war für Mals Vater als Pressesprecherin tätig gewesen.) Alles Geld, das die Familie einmal besessen hatte, war wahrscheinlich futsch, infolge von sexueller Belästigung und Vaterschaftsklagen. Und trotzdem bekommt er bei jeder Wahl noch immer eine beträchtliche Anzahl von Write-In-Stimmen aus seinem Wahlkreis in Delaware, zehn Jahre nachdem er aus dem Amt gejagt wurde.
»Scheiß drauf«, sagt Mal.
»Ach weißt du, Musik mag doch jeder«, werfe ich ein.
»Mal hat mal in einer Band gespielt«, sagt Scott. »Die waren berühmt.«
»Beinahe berühmt«, sagt Mal.
»Was ist mit dir?«, fragt Tony. »Was ist deine Geschichte?«, fährt er mich an. Ich glaube nicht, dass er mich mag, aber seinetwegen mache ich mir keine Sorgen.
Ich hole tief Luft. Hinter Tony, jenseits der Scheibe, gehen die Punks auf der Straße vorbei, mit gesenkten, zusammengesteckten Köpfen, und hecken irgendwas aus. Fast habe ich Lust zu winken.
»Mein Mann liegt seit sechs Jahren im Koma«, sage ich. »Also … warte ich wohl einfach.«
Es ist immer ein trostloser Moment, wenn ich jemandem erzähle, wer ich bin. Mein armer, kranker Ehemann ist zu meiner Identität geworden, und auch wenn ich verstehe, dass niemand darüber hinwegsehen kann, wünsche ich mir das natürlich. Klar, ich erzähle nicht, dass sich der Wert der Kunst meines Mannes seit seinem Unfall vervierfacht hat – die Kunstszene liebt Tragödien – und dass ich bloß in einem Waschsalon sitze, weil meine Waschmaschine kaputt und der nächste Scheck noch nicht da ist, weil ich darauf warte, dass die Australier oder die Südafrikaner oder irgendjemand aus einem fernen Land mal wieder für einen echten Martin Miller blechen. Haltet euch ran. Es sind nicht mehr besonders viele Bilder da, und wisst ihr was: Wenn die weg sind, gibt es keine mehr.
»Mein Gott«, sagt Tony. Er kommt sich vor wie ein Arschloch, das merke ich. Ab sofort wird er besonders nett zu mir sein.
»Schon okay«, sage ich. »Echt, ist echt okay. Ich bin okay.« Und natürlich stockt es in meiner Kehle, das Koma-Stocken, und natürlich steht mir nun das Wasser in den Augen, und natürlich ist es nicht okay.
Scott legt die Hände auf das Gesicht seiner Tochter. Sie sieht so unfassbar weich aus. »Tja, du kannst mit uns warten, wenn du willst«, sagt er. »Jeden Dienstag sind wir hier. Und warten.«
»Auf jeden Fall«, sagt Mal, und ich sehe, wie das volle Leben in seine Augen tritt. »Das Einzige ist – du darfst unseren Frauen nicht erzählen, was wir hier reden.«
»Das ist ein geschützter Raum«, sagt Tony und beschreibt einen Kreis mit den Händen, bis sie sich treffen.
»Ich schwöre, mach ich nicht. Ich schwör’s bei meinem Leben«, sage ich, und ich meine es ernst, und das wissen sie, denn Scott und Tony nicken feierlich, und Mal zieht ein leicht angewidertes Gesicht.
Mir wird bewusst, dass sie, abgesehen von Pflegerinnen und Ärzten und Anwälten, die Ersten sind, die ich seit Jahren kennenlerne. Vielleicht sind das nicht die Freunde, die ich mir zulegen sollte, aber es sind die Freunde, die ich haben will.
2.
Ich laufe ziemlich benommen die Bedford entlang und spiele jeden Moment des Nachmittags noch einmal durch. Geh nach Hause, geh und denk darüber nach, was da gerade passiert ist; denk an die drei gut aussehenden Männer und ihren Charme, ist doch egal, dass dieser Charme so durchschaubar ist, sei einfach dankbar, dass er wirkt, sei einfach dankbar dafür, dass jemand seinen Charme bei dir spielen lässt, nachdem du so viele Jahre nichts gesehen hast als die Vergangenheit und einen Mann in einem Krankenhausbett.
Ich ziehe den Wäschebeutel über den Boden hinter mir her. Ich frage mich, wie ich es schaffen soll, eine ganze Woche zu warten, bis ich die Männer wiedersehe. Doch dann fällt mir wieder ein, dass ich im Warten ja inzwischen ganz gut bin.
Von Martins sechs Jahren im Koma waren einige länger als andere. Die ersten beiden kamen mir kurz vor, weil alles so schnell und wiederholt geschah, wie bei einer Asteroidenattacke in einem Sci-Fi-Film aus den Siebzigern, der unaufhaltsame Angriff einzigartiger Lebensformen, echte Menschen und echte Probleme, etwas furchtbar Fremdes für eine Frau wie mich. Zwei Jahre, wusch, vorbei. Alles war damals so neu, und man lud mich oft zu Partys ein, die geheimnisvolle Halbwitwe des brillanten Martin Miller, rufen wir das arme Ding doch mal an, ja? Soll sie vorbeikommen. Mal sehen, wie es ihr so geht. Machen wir ihr einen schönen Abend. Bestimmt wollen alle wissen, wie es ihr geht. Wie es ihm geht.
Und ich ging hin, das war nämlich alles, was ich konnte, auf Partys gehen, ich hatte zehn Jahre nichts anderes getan, und ich war immer richtig gut darin gewesen. Doch dann erwies ich mich nie als der Partygast, den die Leute erwarteten, ich benahm mich daneben, weil mein Mann im Koma lag. Meine Mätzchen waren nicht mal interessant im Sinne einer Performance, nicht wie bei Courtney Love, die an kerzenübersäten Gedenkstätten Punk-Hippies umarmte und nach einem Jahr wieder dazu überging, ihre vergrößerten Brüste im Designerfummel jedem unter die Nase zu halten, der hinsah. Ich weinte auf der Toilette, und jeder wusste, jetzt weint sie wieder. Ich erzählte zu viel von ihm, stundenlang, umklammerte fremde Hände mit dem Griff eines Kindes in der Menge. Ich zog furchtbare Gesichter, wenn man mich fragte, wie es mir ging, und irgendwann war ich nicht mal mehr hübsch, die letzte Schicht des Erträglichen abgetragen. Also lud man mich nicht mehr zu Partys ein.
Manche waren auch neidisch, diese Künstler, die allen in ihrer Umgebung Emotionen aussaugen und dann auf die Leinwand spucken wie Babys, denen die Muttermilch wieder hochkommt. Ich glaube, sie waren neidisch, weil mein Leiden authentisch war, während sie nichts anderes zu bejammern hatten als hin und wieder ein gebrochenes Herz oder eine schlechte Kritik. Wahrscheinlich hätte ich all dem ein Ende setzen können, wenn ich gewollt hätte, aber es gab ein Dutzend Gründe, es zu lassen, nicht zuletzt den, dass ich dann die Frau wäre, die ihrem Mann den Stecker gezogen hat. Und diese Frau weigere ich mich seit sechs Jahren zu sein.
Das Ende des Jahres 2001 zog sich ewig hin. Ewig. Nur in dieser Zeit fühlte ich mich wie alle anderen auch. Die Stadt kam einem vor wie planiert; wir alle waren gleich traurig. Ich war erleichtert, nicht mehr allein zu sein, und fühlte mich anschließend schuldig für meine Erleichterung. Nach den Angriffen gingen viele Menschen in meiner Umgebung pleite, woraufhin ich ihnen wieder nützlich war. Nicht genug, dass die Stadt Trauer trug – nun waren viele auch noch arbeitslos oder konnten ihre Arbeiten nicht verkaufen. Menschen, die eigentlich aus meinem Leben verschwunden waren, tauchten wieder auf, gerade so lange, um mich um Hilfe zu bitten. Alle kamen sie in mein Loft, Ich wollte mal nach dir sehen, aber was hatte ich schon zu berichten, also sprachen wir bald über sie, über ihre Probleme. Das war manchmal anstrengend, meist aber spannend. Dort draußen in der Welt hatten Menschen Bedürfnisse; es war verlockend, mir vorzugaukeln, dass ich nicht mehr allein war in meinem Leid. Die armen, hungernden Künstler. Also gab ich ihnen Geld, für die Miete, zur Rettung der Galerie/des Lofts/des Ateliers. Ich verlangte nicht, dass sie es mir zurückzahlten – ich konnte kaum meine Wohnung verlassen –, und sie standen auch nicht unbedingt Schlange, um mich zu erwischen. Nach ein paar schwächlichen Zahlungsversuchen, Ich werde das schon noch schaffen, keine Sorge, verloren sich auch diese Leute in den Graffiti entlang der Straßen von Williamsburg, und mit ihnen das kurze, süße Gefühl der Dringlichkeit, das ich empfunden hatte, weil sie so bedürftig waren.
Und in den letzten Jahren habe ich mich darin eingerichtet, in diesem Wartespiel. Ich installierte bei mir zu Hause eine WLAN-Verbindung sowie Waschmaschine und Trockner: zwei Maßnahmen, die sicherstellten, dass ich das Haus nur verlassen musste, wenn es unbedingt nötig war. Einmal habe ich über Selbstmord nachgedacht. Ich versuchte es mit ehrenamtlicher Arbeit – ein paar Jahre lang gab Davis meine Nummer an Leute weiter, denen er erzählte, ich hätte viel freie Zeit; ich glaube, er wollte nur, dass ich mal aus dem Haus ging –, doch schließlich verlor ich das Interesse, wahrscheinlich, weil ich nicht in der Lage war, mit irgendjemandem emotional ernsthaft in Verbindung zu treten. Ich bin einfach zu lange zu abgestumpft gewesen. Mittlerweile stelle ich eben Schecks aus: für Planned Parenthood, ein Obdachlosenasyl, einen gehobenen Secondhandladen, der eine AIDS-Organisation unterstützt (»Ich dachte, du hast wenigstens Spaß an den ganzen Klamotten«, sagte Davis traurig), und für die Brooklyn Botanical Gardens, wo ich einen beklemmenden Abend lang bei einer Spendenaktion Tombola-Lose verkauft habe. Wie all diese glatten Yuppies im Cocktail-Outfit inmitten des Blattwerks nach Liebe suchten – das löste bei mir einen erneuten Weinkrampf auf der Toilette aus. Man bat mich nie wieder dazu.
Größtenteils habe ich mein Leben zu Martins Sache gemacht. Mit ihm zusammen zu sein war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und nichts, womit ich meine Zeit je verbracht hätte, hat mich so glücklich gemacht. Ab und zu verbringe ich Zeit im Internet und suche nach seinem Namen. Es gibt relativ viele Fans da draußen, Leute, die ihm zu Ehren Websites einrichten, und ab und zu finde ich jemanden, der begeistert darüber schreibt, seine Werke für sich entdeckt zu haben. Ich war seltsam berührt, als ich sah, dass eine Studentin der Brown University im vergangenen Jahr ihre Abschlussarbeit über ihn geschrieben hatte. Es war schön, wirkte aber auch so endgültig: sein Werk verkapselt in einem einzelnen, ordentlichen Dokument.
Sein Werk so einzufangen scheint auch deshalb unmöglich, weil kein Mensch mehr weiß, wo eigentlich alles ist. Davis hatte sich darangemacht, es zu katalogisieren, als Martin gerade ins Koma gefallen war, doch etwa ein halbes Jahr später schnappte sich Alice große Teile von Martins Werk aus seinem anderen Atelier, dem in der North Third. (Das nutzte er nachts, wenn er mich nicht wecken wollte. Er hatte manchmal furchtbare Schmerzen, am ganzen Körper, die ihn nächtelang wach hielten und nur durch Malen zu lindern waren.) In diesem Atelier war ich nur selten gewesen – ein kleiner, offener Raum mit großem Fenster und einem durchgesessenen Futon auf der einen Seite, während gegenüber viele Hundert Bilder lehnten –, und ich hatte nicht die Absicht, mich mit dem Chaos zu befassen. Damals war ich so müde – ich war täglich im Krankenhaus, den ganzen Tag –, dass ich den beiden einfach erklärte, sie sollten es unter sich regeln, worauf Alice über die Beute herfiel. Also hat Davis einiges, Alice hat viel, ich habe das, was im Loft war, und dann gibt es in Europa noch ein paar Galeriebesitzer, die sich standhaft weigern, mir seine Arbeiten zurückzuschicken. Die Ausreden sind ohne Zahl: Sie sind nicht auffindbar, der Transport ist zu teuer, es war ein Geschenk, wir haben einen Vertrag, und so weiter und so weiter. Ich heuerte einen weiteren Anwalt an, stellte einen weiteren Scheck aus und betete, dass eines Tages alles zusammen an einem Ort sein würde.
Ich verkaufe weiter seine Arbeiten, damit die Martin-Miller-Maschine weiterläuft. Zwanzig seiner Bilder habe ich für einen Durchschnittspreis von 50000 Dollar verkauft, um seine Krankenhausrechnungen und meine Miete zu bezahlen. Sie stammten aus der Serie, die er über die Kids von der Bedford Avenue gemacht hat. Hübsche junge Leute, die er auf der Straße auflas und nachmittags mit nach Hause brachte. Mädchen aus Polen und Punks und Kunststudentinnen und Dominikaner. Ich kochte Mittagessen für sie, und dann machte er Fotos von ihnen, die er später als Vorlage für seine Bilder nutzte. Manchmal saßen sie ihm auch ein Weilchen Modell, hin und wieder kam jemand öfter. Es waren nicht meine Lieblingsbilder von ihm – ich zog die Porträts vor, die er von Leuten machte, die ihm nahestanden –, aber sie sorgten durchaus für einige Aufmerksamkeit, ein erstes Auflodern, die Times berichtete kurz über seine Schau, drei davon verkaufte er, genug für die nächsten sechs Monate Miete. All seine Modelle kamen zur Vernissage. Was für ein Abend. Was für eine Party. Wenn ich die Augen schließe, ist es, als wären sie von innen mit einem Bild dieser Gäste tätowiert: ein Haufen Minderjährige, manche in Secondhand-Sachen, andere in engen Jeans oder zerrissenen Jeans oder ausgebeulten, am Hintern hängenden Jeans, wie sie sich mit Flaschenbier betrinken, und dann die Polinnen, die hochgewachsenen mit viel Eyeliner, wie sie ausnahmslos von Martins bestem Freund Davis angemacht werden. Und die Galeristin Alice mit der maskulinen Kurzhaarfrisur und dem unerschütterlichen britischen Akzent, wie sie in einer Ecke mit äußerst wichtigen Menschen spricht und dennoch gleichzeitig irgendwie über Martin wacht. Es war, als hätte sie ein drittes Auge. Und dann Martin mit seinen langen, beweglichen Beinen als Basis für diese Brust, die sich hob und senkte wie die eines Bullen, so viel Kraft darin, im Oberkörper und in den Armen, einer davon mit schwarzen Streifen tätowiert, Relikten seiner in Punkbands verbrachten Jugend, und über all dem sein solides, attraktives Gesicht – kann eine Kinnlinie Charisma haben? Mit den Dauerstoppeln und der kantigen Männlichkeit schien sie eine eigene Persönlichkeit zu besitzen – und seine dunklen, konzentrierten Augen, die einen verfolgten, alles verfolgten, sich vergewisserten, dass man auch wirklich aufmerksam war; und wie er versucht, sehr ernsthafte und sehr wichtige Gespräche zu führen, während er alle im Auge behält, die Kids, seine Freunde und mich. Ich bin auch da, im schwarzen Cocktailkleid mit einem Träger über der einen Schulter (gekauft für vier Dollar bei Goodwill), als Gastgeberin, die ganz reizend und unbeschwert ist, trinke warmen Rotwein aus Pappbechern und kleckere ein bisschen davon auf meine Beine, sodass Martin später, als wir im Bett lagen und er mich überall küsste, sagte: »Du schmeckst nach Wein.« Und dann küsste er mich noch mehr.
Ach, Martin. Alles führt immer zu ihm zurück. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn gemacht habe, weil es immer darauf hinausläuft, was ich mit ihm erlebt habe. Halb drinnen, halb draußen.
Aber ich habe die Bilder verkauft. Ich habe sie zum Abschied geküsst, so weh es auch tat. Ein Stück Martin weniger in meinem Besitz. Das Wichtigste an ihm habe ich bereits verloren, aber es stehen noch immer Hunderte winzige Stückchen zum Verkauf, 325, um genau zu sein.
Es macht mich krank, wenn ich daran denke, aber je länger Martin lebt, desto mehr sind sie alle wert. Und wenn er dann stirbt, Mensch, alle Achtung. O Mann. Ich Glückliche.
Ach, ich Glückliche.
Inzwischen bin ich in die Eighth eingebogen, eine nette Straße, die aussieht, als würden dort nette Leute in Ruhe wohnen. Der Wäschebeutel holpert hinter mir her. Ich plane imaginäre Ausflüge mit meinen neuen Freunden. Ab in den Q Train nach Coney Island, wenn es draußen heiß wird, und die Füße in den dreckigen Atlantik tauchen. Wir können ein Auto mieten und nach Norden fahren, ein Tagesausflug, eine Wanderung im Wald. Übers Wochenende nach Atlantic City und dort unser Wäschegeld verzocken. Zuckerwatte auf der Promenade um Mitternacht.
Doch dann fällt es mir wieder ein: Sie haben selbst ihre Frauen, sie haben selbst ein Leben, und mit diesen Männern gibt es keine Auswärtstrips.
Und außerdem: Ich habe selbst einen Mann, der auf mich wartet. Wie könnte ich das je, jemals vergessen?