

Über den Autor
Jürgen Werth ist als Songpoet, Autor und Prediger unterwegs. Bis 2014 war er Leiter des Radio- und Fernsehsenders „ERF Medien“. Er ist ein Meister im Geschichtenerzählen – auch in seinen Liedern – und manche seiner Songs haben sich zu Klassikern entwickelt. Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder.

Inhalt
Vorwort
Doch Gott sieht das Herz
Der barmherzige Blick des Vaters
Und da sind Menschen …
Heimat finden
Leben ohne Schatten
Das Glück entdecken in dunklen Zeiten
Bist du ein Engel?
Gefährten, Freunde, Wegbegleiter
Doch Gott gab dich nicht auf
Die Hoffnung ist stärker
Wie ein Fest nach langer Trauer
Von der Sehnsucht nach der Versöhnung
Nun bist du fort …
Loslassen lernen
Du machst dich arm, du machst uns reich
Beschenkt aus der Fülle Gottes
Menschen wie Himmelsfilialen
Begegnungen, die reich machen
Sola fide – nur der Glaube
Was uns trägt
Bei dir alleine komm ich zur Ruhe
Vom Segen der Stille
Dann wurd’ sein Blick trüber …
Was von uns bleibt
Quellen
Die Bilder des Buches

Vorwort
Ich sehe ein Gesicht, eine Gestalt, eine Geschichte. Ich sehe und urteile: Freund oder Feind? Gewinner oder Verlierer? Gut oder böse? Gläubig oder gottlos? Ich sehe und urteile und verurteile – und täusche mich oft genug. Während andere mich sehen und sich täuschen.
Wir sehn, was man sehn kann, vor Augen die Haut …
Doch Gott sieht das Herz.
Gott sieht, wer ich wirklich bin. Was wirklich in mir steckt. Was ich wirklich denke und fühle, was ich wirklich will, wonach ich mich sehne und wovor ich mich ängstige, was ich liebe und was ich verabscheue. Er sieht und liebt und hilft und heilt. Er täuscht sich nie. Und wird darum nie ent-täuscht. Nicht von mir, nicht von den anderen, nicht von der Welt.
Bunte Bilder des Lebens und Glaubens malt dieses Buch. Bilder zum Hinschauen und Hineinschauen, zum Lächeln und Weinen, zum Staunen und Verstummen, zum Denken und Danken. Eine Seh-Schule für Anfänger und Fortgeschrittene, mit Lyrik und Prosa, mit farbenfrohen Bildern und Skizzen. Eberhard Münch und ich nehmen Sie mit auf eine kleine Reise durchs Leben. Die einzelnen Stationen sind Nahaufnahmen eines Lebens, meines Lebens, eingefangen mit dem Weitwinkelblick des Himmels.
Wir laden Sie ein, ins Herz unserer Geschichten zu schauen – und ins Herz der Bilder und Zeichnungen, der bunten und der schwarz-weißen. Vielleicht entdecken Sie ja Ihr eigenes Herz darin. Und das Herz Gottes. Dann hätte es sich gelohnt, für Sie dieses Buch zu schreiben und zu illustrieren.
Viel Freude beim Lesen und Betrachten!
Wetzlar und Wiesbaden, im Herbst 2017
Jürgen Werth
Eberhard Münch
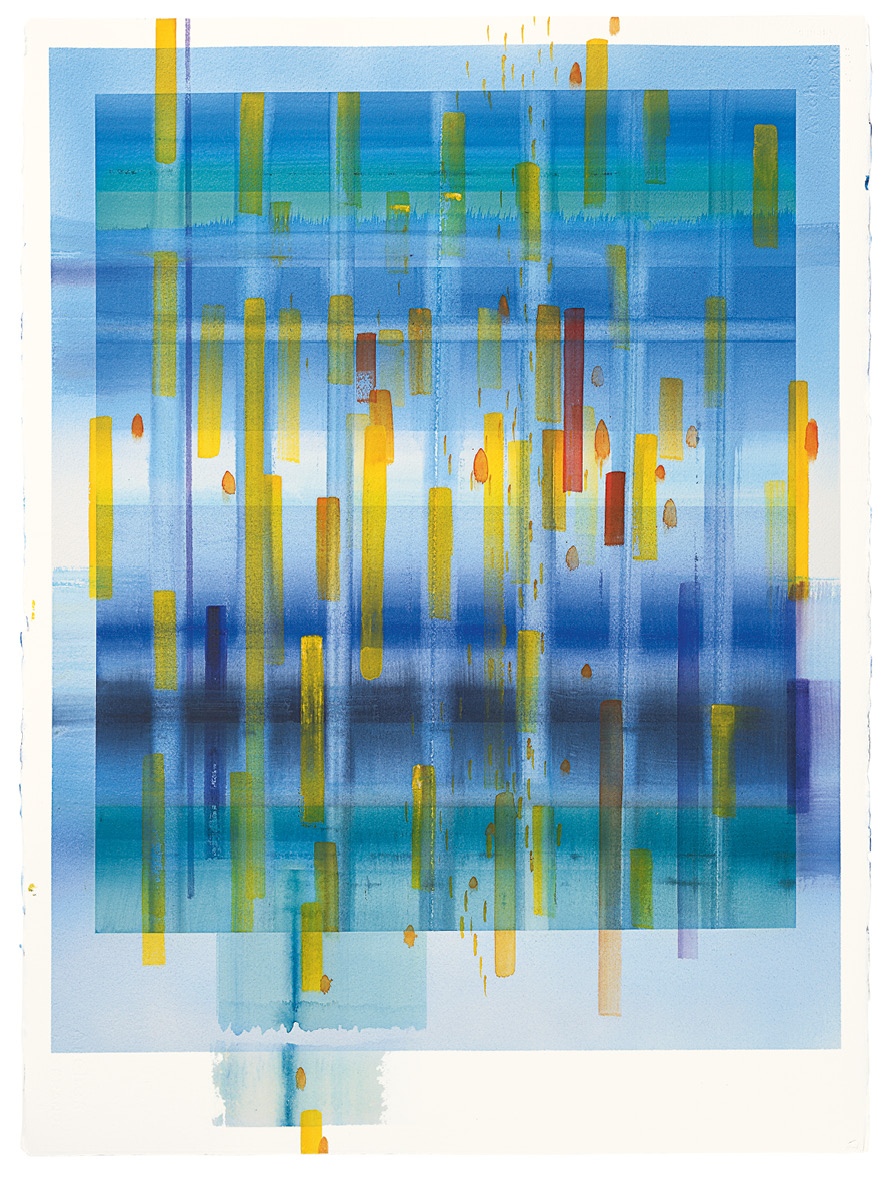
Doch Gott sieht das Herz
Der barmherzige Blick des Vaters
Vor Augen
Vor Augen: Der Kleinste, der Letzte im Glied
Verwuschelt, verwildert und scheu, wie man sieht
Der wird es wohl nicht sein, so denkt der Prophet
Ein Kerl wie ein Baum muss es sein, ein Athlet
Ein König, ein Held, das erwartet das Volk
Nur wer etwas hermacht, hat beim Volk auch Erfolg
Wir sehn, was man sehn kann
Vor Augen die Haut
Und Gott sieht das Herz
Vor Augen: der Schlimmste, der Letzte im Glied
Ein gottloser, treuloser Mensch, wie man sieht
Die Ehe gescheitert, die Kinder bei ihr
Und morgens schon riecht er nach Rauch und nach Bier
Jetzt läuft er sogar einem Typ hinterher
Den kann keiner brauchen, den will keiner mehr
Wir sehn, was man sehn kann
Vor Augen die Haut
Und Gott sieht das Herz
Vor Augen: der Beste, der Erste im Glied
Ein aufrechter Kerl, klar und wahr, wie man sieht
Der Anzug gebügelt, gescheitelt das Haar
Mehr Einfluss, mehr Macht und mehr Geld Jahr für Jahr
Wenn er seine Meinung sagt, brandet Applaus
Der Typ von „Mein Auto, mein Boot und mein Haus“
Wir sehn, was man sehn kann
Vor Augen die Haut
Und Gott sieht das Herz
Vor Augen: mein Leben, mal schlimm und mal gut
Mal Glauben, mal Zweifel, mal Angst und mal Mut
Mal Siegen, mal Scheitern, mal vor, mal zurück
Mal Power, mal Panik, mal Unglück, mal Glück
Mal Himmel, mal Erde, mal Hü und mal Hott,
Mal Flucht und mal Heimkehr, mal Teufel, mal Gott
Wir sehn, was man sehn kann
Vor Augen die Haut
Doch Gott sieht das Herz
Text: Jürgen Werth · Musik: Florian Sitzmann · © Gerth Medien Musikverlag, Asslar
Der Tag. Der Satz. Mein Tag. Mein Satz. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“ Die Bibel. Altes Testament. 1. Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Mein Konfirmationsspruch. Für mich ausgewählt und mir zugesprochen von meinem Gemeindepfarrer Heinrich Schoenenberg. 1965. Lang ist es her. Sehr lang.
Heinrich Schoenenberg war ein Pfarrer, wie man sich einen Pfarrer vorstellt, damals vorgestellt hat: gebildet und geachtet und ein bisschen gefürchtet. Geistesstark und lendenstark. Acht Kinder. In den alten Sprachen und Schriften war er zu Hause: Latein, Hebräisch, Griechisch fließend. Aber nicht so sehr in den neuen. Englisch gar nicht. „Ich krieg das ‚Si Äitsch‘ nicht hin.“ Dafür beherrschte er das „Gallia est omnis divisa in partes tres“ und das „Sch’ma Israel“. Wovon ich profitiert habe. Und das gleich mehrfach.
Zum ersten Mal hat mir sein Wissen geholfen, als ich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt bin und in einem Jahr den Stoff von sechs Schuljahren Latein nachholen musste. „Komm zu mir!“, raunzte er freundlich und ließ dabei die Pfeife zwischen seinen Lippen zustimmend nicken. Und ich kam. Und habe danach viele Stunden in seinem Arbeitszimmer verbracht, wo es nach alten Büchern und abgestandenem Zigarrenqualm roch. Nach Gelehrsamkeit, Geschichte und Gott. Nach Glauben und Wissen. Es war ein langes Jahr. Vokabeln pauken, Grammatik büffeln – ohne allzu große Begeisterung, zugegeben. Aber immer hoch konzentriert. Klar, ich war der einzige Schüler. Und am Ende hatte ich mein großes Latinum!
Ein paar Jahre später durfte ich dann wieder in den Genuss seiner altsprachlichen Kenntnisse kommen: als ich beschlossen hatte, Theologie zu studieren. Schon in der Schulzeit wollte ich biblisches Hebräisch lernen, das Hebraicum machen und so die teure Studienzeit verkürzen. „Komm zu mir!“, raunzte Heinrich Schoenenberg erneut, und wieder nickte die Pfeife zwischen seinen Lippen zustimmend. Warum interessierte mich die Theologie so sehr? Weil ich lernen wollte, was viele meiner älteren Freunde längst wussten. Und weil ich so einer werden wollte wie er, wie Heinrich Schoenenberg.
Ich bin dann doch kein Theologe geworden, sondern Journalist – aber das ist eine andere Geschichte. Mit dem Schoenenberg hat sie jedenfalls nichts zu tun. Er war mein Sprachenlehrer und ein, zwei Jahre zuvor mein Glaubenslehrer. Er hat mich konfirmiert. Auch an diese zwei Unterrichtsjahre erinnere ich mich sehr gut. Jeder von uns hatte ein Heft, in das er die wichtigsten Lerninhalte notieren musste. Manche Sätze weiß ich noch heute. Zum Beispiel diesen: „Es gibt nur eine Sünde, alles andere sind Missetaten.“ Nur eine Sünde? Ja, die Trennung von Gott, das ist der „Sund“, der zwischen Schöpfer und Geschöpfen liegt, der aber vom Kreuz des Christus überspannt wird. Oder: „Glauben kommt vom althochdeutschen ‚gelowen‘, das heißt geloben, sich angeloben, sich verloben. Wer glaubt, geht eine Beziehung ein.“
Wir mussten noch auswendig lernen. Zentrale Sätze der Bibel. Das Glaubensbekenntnis. Choralverse. Die wichtigsten Wahrheiten aus dem Katechismus. Wir wussten: Am Ende der Konfirmandenzeit werden wir geprüft. Vor der Gemeinde. Irgendwie haben wir wohl alle bestanden. Jedenfalls erinnere ich mich an keinen, der durchgefallen wäre – was vielleicht auch daran lag, dass wir uns besonders intensiv mit dem Kernbegriff des Evangeliums beschäftigt hatten: mit Gnade.
Und dann kam die Konfirmation, im dunklen Anzug und mit Krawatte. Feierlich war’s und fröhlich und auch ein bisschen beklemmend. Wir ahnten: Es geht um was! Zudem markierte der Tag für viele einen wichtigen Lebenseinschnitt. Die „Volksschule“ war vorbei, nun begann der „Ernst des Lebens“: eine Lehre. Nur eine Handvoll ging weiter zur Schule.
Später habe ich ein Gedicht von Erich Kästner gefunden, das die Gefühlslage der meisten von uns sehr treffend zusammenfasst:
Zur Fotografie eines Konfirmanden1
Da steht er nun, als Mann verkleidet,
und kommt sich nicht geheuer vor.
Fast sieht er aus, als ob er leidet.
Er ahnt vielleicht, was er verlor.
Er trägt die erste lange Hose.
Er spürt das erste steife Hemd.
Er macht die erste falsche Pose.
Zum ersten Mal ist er sich fremd.
Er hört sein Herz mit Hämmern pochen.
Er steht und fühlt, dass gar nichts sitzt.
Die Zukunft liegt ihm in den Knochen.
Er sieht so aus, als hätt’s geblitzt.
Womöglich kann man noch genauer
erklären, was den Jungen quält:
Die Kindheit starb; nun trägt er Trauer
und hat den Anzug schwarz gewählt.
Er steht dazwischen und daneben.
Er ist nicht groß. Er ist nicht klein.
Was nun beginnt, nennt man das Leben.
Und morgen früh tritt er hinein.
Für mich war die Konfirmation aber noch aus einem anderen Grund eine wichtige Wegmarke. Ich habe an diesem Tag tatsächlich mein Leben festgemacht bei Gott. Nicht zum ersten und ganz sicherlich nicht zum letzten Mal. Aber ich wollte meinen Glauben wirklich „konfirmieren“, also bestärken, bekräftigen. So, wie uns das Heinrich Schoenenberg ans Herz gelegt hatte.
Da kam so ein Bibelvers gerade richtig, der Konfirmationsspruch. Er war so etwas wie die Losung, der Leitgedanke für das Leben, das nun begann.
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“
Ob ich damals gleich gewusst habe, wo das steht? Wohl eher nicht. Heute weiß ich es, natürlich, und kenne auch die Geschichte, aus der dieser Vers stammt:
Der Prophet Samuel soll im alten Israel einen neuen König salben. Gott schickt ihn zur Hirtenfamilie von Isai. Der hat viele Söhne. Einer von ihnen soll’s sein, hat Gott angekündigt. Der Reihe nach stellen sie sich vor. Samuel ist beeindruckt. Aber Gott flüstert ihm ins Herz: „Der ist es nicht ... und der auch nicht.“ Und dann kommt der Satz, mein Satz. „Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“
Sieben Kandidaten fallen durch.
„Waren das alle?“, fragt Samuel irritiert.
„Nein“, antwortet Isai. „Der Jüngste ist noch draußen bei den Schafen und Ziegen.“
Samuel lässt ihn holen und weiß: Der ist es! Israels neuer König. Sein Name: David.
Sich nicht blenden lassen von Äußerlichkeiten. Nicht von Alter und Anspruch. Nicht von Status und Statur. Nicht von Verfehlungen, Verwerfungen und Verunstaltungen. Nicht blind verehren und vergöttern. Nicht blind verachten und verabscheuen. Tiefer blicken. Das Herz sehen. Damals, bei meiner Konfirmation, habe ich wohl angefangen, das zu begreifen. Und die Menschen fortan ein bisschen anders gesehen. Die Eltern, die Lehrer, die Freunde, die Feinde, die Frommen, die Unfrommen und, ja, wohl auch ihn: meinen Pfarrer. Wen darf ich bewundern und wofür? Von wem sollte ich mich fernhalten und warum? Von wem kann ich lernen – und was?
Ein paar Jahre später hatte ich einen Englischlehrer, vor dem wir mächtig Respekt hatten. Er wusste das. Er schätzte das. Und doch wollte er auch unser väterlicher Freund sein. Manchmal gab er den allzu Eingeschüchterten einen Tipp, den ich nie vergessen habe: „Stellt euch vor, ich stehe vor euch in langen Unterhosen. Da hättet ihr dann keine Angst mehr vor mir. Denn so sieht jeder Mann lächerlich aus.“ Sätze, die man in einem Jungs-Gymnasium mal einfach so sagen konnte.
Wie er wohl wirklich war? Ohne Schüler? Ohne Rolle?
Wie oft verwechseln wir Hülle und Herz! Wie oft haben Menschen das im Laufe der Jahrzehnte bei mir verwechselt! Für viele war ich vor allem das: erfolgreich, selbstbewusst, ausgeglichen, freundlich, humorvoll, menschenzugewandt, glaubensstark. Dabei zweifle ich allzu oft an dem, was andere als Erfolg wahrnehmen. Zweifle an mir. Traue mir vieles nicht wirklich zu. Leide zuweilen unter den Erwartungen meiner Zuhörer, Zuschauer, Leser. Und an meinen eigenen. Finde Menschen oft eher anstrengend als bereichernd, auch weil ich mich meist zu tief auf sie einlasse, in sie hineinspüre. Kann wegen ungelöster Konflikte manchmal nächtelang nicht schlafen. Nehme mir Kritik und Kränkungen allzu oft allzu sehr zu Herzen. Leide wie ein Hund unter Unverständnis, Ungerechtigkeit und Unversöhnlichkeit.