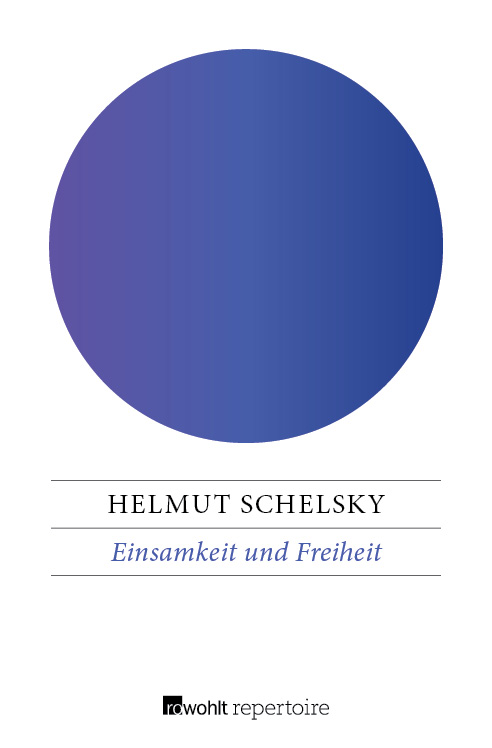
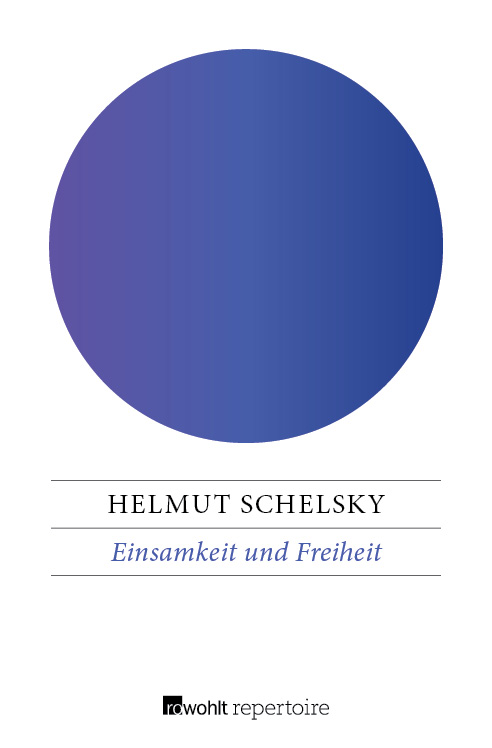
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
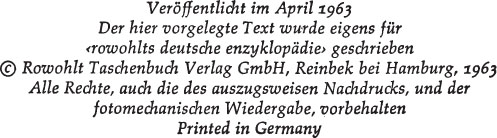
ISBN Printausgabe 978-3-499-55171-0
ISBN E-Book 978-3-688-10482-6
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-10482-6
Die ‹Nr.›-Hinweise im Text beziehen sich auf die Numerierung der Literaturhinweise auf S. 333.
THORSTEIN VEBLEN, The Higher Learning in America. 1919; UPTON SINCLAIR, The Goose Step. 1923; DAVID RIESMAN, vgl. Nr. 61 u. 67.
Akademierede vom 19. Januar 1809, vgl. ADOLF HARNACK, Geschichte der Kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. II, Berlin 1900, S. 341ff, und Nr. 41, S. 223.
Gesammelte Schriften, Akademieausgabe Bd. III, S. 140.
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 1844; vgl. KARL MARX, Die Frühschriften, hg. v.S. Landshut. Stuttgart 1953, S. 218.
Vgl. PAULSEN, Nr. 55, Bd. I, S. 112ff.
Vgl. zum folgenden vor allem GRUNDMANN, Nr. 25.
FRIEDRICH V.BEZOLD, Die ältesten deutschen Universitäten in ihrem Verhältnis zum Staat. Hist. Ztschr., Bd. 80, 1898, S. 459.
FRIEDRICH STEIN, Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 1891, S. 11.
Vgl. für die Denkschriften W. V.HUMBOLDTs, FICHTEs, SCHLEIERMACHERs, STEFFENs’ und WOLFs Nr. 37, 38, 15, 74, 95, 80 sowie für die Vorlesungen SCHELLINGs und FICHTEs Nr. 70, 13, 14, 16; leichter zugänglich die meisten dieser Denkschriften in Nr. 78, 2, 89. Diese Schriften werden um der verschiedenen Ausgaben willen nach Paragraphen- bzw. Kapiteleinteilung zitiert.
GÖTZ VON SELLE, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen. Königsberg 1944, S. 110.
Vgl. JOHANN DAVID MICHAELIS (Göttinger Professor), Raisonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland. 4 Bde. Frankfurt/Leipzig 1768/75, Bd. III, S. 286ff, und CHRISTOPH MEINERS, Über die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten. 2 Bde., Göttingen 1801/02, Bd. I, S. 80ff.
GÖTZ VON SELLE, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen. Königsberg 1944, S. 110.
JOHANN JAKOB ENGEL, Denkschrift zur Errichtung einer großen Lehranstalt in Berlin. 1802; THEODOR ANTON HEINRICH SCHMALZ, Denkschrift über die Errichtung einer Universität in Berlin. 1807; CHRISTOPH WILHELM HUFELAND, Ideen über die neu zu errichtende Universität zu Berlin und ihre Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften und anderen Instituten. (Undatiert) Sämtliche Denkschriften abgedruckt in Nr. 89, S. 3–27, Zitate ebd. S. 6, 9, 11, 19.
FRIEDRICH NICOLAI, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. 12 Bde., Berlin 1781–1796, Bd. IV, S. 57ff; zit. Nr. 55, Bd. II, S. 111 (PAULSEN).
GÖTZ VON SELLE, a.a.O., S. 160f.
W. SCHRADER, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle. 2 Bde. Berlin 1894, Bd. I, S. 383, Bd. II, S. 490; zit. Nr. 55, Bd. II, S. 128.
GÖTZ VON SELLE, a.a.O., S. 161.
Die Ausführungen des Abschnittes 3 stützen sich vor allem auf RENÉ KÖNIG, Nr. 45, Buch I: Der Kampf um Aufhebung oder Reform der Universitäten, S. 17–53, und SPRANGER, Nr. 77, S. 1–18; vgl. dazu auch HEUBAUM, Nr. 30, und das die sozialen Zusammenhänge betont herausarbeitende Buch von ROESSLER, Nr. 64.
HEINRICH STEPHANI, Grundzüge der Staatserziehungswissenschaft. 1797, später: System der öffentlichen Erziehung 1804; JOH. FRIEDRICH ZÖLLNER, Ideen über Nationalerziehung. Berlin 1804, vgl. Nr. 30, S. 8.
Bei EMIL F. ROESSLER, Die Gründung der Universität Göttingen. Entwürfe, Berichte und Briefe der Zeitgenossen. Göttingen 1855, S. 483; dort S. 474 auch die Äußerung V. MÜNCHHAUSENs über Professoren in einer Frage des Lehrbetriebs: ‹Wollen sie dieses nicht verstehen, muß man’s ihnen von oben herab verständlich machen›. ‹Akademisches Bergwerk›, ebd. S. 481. Vgl. Nr. 44, S. 71ff.
A. a.O., I, S. 315f, 338; III, S. 251; vgl. Nr. 45, S. 23f.
A. a.O., Bd. XVI, S. 218f, 164; vgl. Nr. 45, S. 26f.
Vgl. Nr. 45, S. 27ff; Quelle: ADOLF STÖLZEL, Die Berliner Mittwochsgesellschaft über Aufhebung und Reform der Universitäten, 1795. Forsch. z. brandenb. u. preuß. Geschichte II, 1889.
HIPPOLYTE TAINE, Die Entstehung des modernen Frankreich. 3 Bde., 1875 bis 1893, Bd. III, 6. Buch, Kap. I, 6.
MEINERS, a.a.O., Bd. II, S. 117ff.
STEPHANI, a.a.O., 2. Aufl. 1813, S. 111; JULIUS EBERHARD WILHELM ERNST VON MASSOW, Ideen zur Verbesserung des öffentlichen Schul- und Erziehungswesens mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Pommern. Annalen des preuß. Schul- und Kirchenwesens, Bd. I, 1805 (geschrieben 1797), S. 126f. Vgl. Nr. 50, S. 36ff, und Nr. 45, S. 49ff.
Jahrbücher der preußischen Monarchie, 1798, II, S. 187f.
Vgl. SPRANGER, Nr. 77, S. 97.
Vgl. dazu bes. SPRANGER, Nr. 77, und ROESSLER, Nr. 64.
WILHELM PINDER, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas. Berlin 1926; KARL MANNHEIM, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden 1935; erw. engl. Ausgabe: Man and Society in an Age of Reconstruction. London 1951, p. 41.
KLEMENS THEODOR PERTHES, Friedrich Perthes Leben. 3 Bde. Gotha 18574, Bd. II, S. 146. Vgl. die Betonung dieses Gesichtspunktes bei ROESSLER, Nr. 64, S. 8.
EUGEN ROSENSTOCK-HUESSY, Soziologie. Bd. I, Die Übermacht der Räume. Stuttgart 1956, S. 32–37.
HERMANN HEIMPEL, Der Mensch in seiner Gegenwart. Göttingen 1954, S. 12. Vgl. die gleiche These vom Beginn der ‹Gegenwart› des heutigen Erziehungswesens mit der Wende zum 19. Jahrh. bei ROESSLER, Nr. 64, S. 18 und 353.
Zur Gründungsgeschichte der Universität Berlin vgl. neben dem älteren Werk von RUDOLF KÖPKE, Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berlin 1860, vor allem MAX LENZ, Nr. 50, und SPRANGER, Nr. 77. Die wichtigsten Dokumente letzthin zusammengefaßt in der ‹Gedenkschrift zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin›, Nr. 89.
Zitiert von WILHELM WEISCHEDEL, Einleitung in Nr. 89, S. XXI.
Vgl. ROESSLER, Nr. 64, S. 216ff, 410ff.
F.A. WOLF, Nr. 95, S. 297, 289, 291.
Vgl. KAEHLER, Nr. 41, S. 211ff.
Vgl. HELMUT SCHELSKY, Über die Stabilität von Institutionen, besonders Verfassungen. Kulturanthropologische Gedanken zu einem rechtssoziologischen Thema. Jahrb.f.Sozialwiss. Bd. 3, 1952, S. 5–8.
MAURICE HAURIOU, La théorie de l’institution et de la fondation. In: ‹La Cité moderne›, Cahiers de la nouvelle journée, Paris 1925, S. 31ff. – BRONISLAW MALINOWSKI, A Scientific Theory of Culture and Other Essays. North Carolina Press 1944, S. 48, 52; dtsch. Zürich 1949.
Vgl. HELMUT SCHELSKY, Ist die Dauerreflektion institutionalisierbar? Zum Thema einer modernen Religionssoziologie. Ztschr.f.Evangelische Ethik, 1957, S. 168, 173.
Zitate SCHLEIERMACHERs: Gelegentliche Gedanken, Kap. II, Anhang; Kap. III, Anhang.
Gedenkschrift Nr. 89 I, S. 252, 257f, 231ff, 247ff, 260. Vgl. a. LENZ, Nr. 50, S. 410–431.
Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. 1794, Nr. 13, S. 261.
W. V.HUMBOLDT, Nr. 37, S. 279; Nr. 38, S. 251.
Deduzierter Plan, § 10, 2.
Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. 1795, 27. Brief.
DAVID RIESMAN, The Lonely Crowd. 1950, dtsch. Die einsame Masse, rde Bd. 72/73, Hamburg 1958, 5. Aufl. 1961; vgl. H. SCHELSKY, Im Spiegel des Amerikaners. David Riesmans Analyse des Zeitgenossen. Ztschr. Wort u.Wahrheit, XI, 5, 1956, und Einführung zu rde Bd. 72/73.
Brief an CAROLINE, 9. Oktober 1804.
Vgl. Briefe an Caroline, Bd. IV (1814), S. 380f; Nr. 41, S. 276; SPRANGER, Nr. 77, S. 135.
Vgl. I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 1793; F. SCHILLER, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. 1795.
J.G. FICHTE, Werke, hg.v.Medicus, Bd. IV, S. 561.
Vgl. W. THIEME, Nr. 84, S. 212; A. KÖTTGEN, Nr. 46, S. 19.
HEINRICH LEO, Aus meiner Jugendzeit. Gotha 1880, S. 137.
Vgl. SPRANGER, Nr. 77, S. 103.
Vgl. W. WEISCHEDEL, Nr. 89, S. XVIII.
Brief vom 19.10.1808 an SCHÜTZ, zit. Nr. 50, S. 103.
Abgedr. in Nr. 89, S. 251f.
H. V.TREITSCHKE, Die Lage der Universität Berlin (im Jahre 1873). Göttingen 1927, S. 5; THEODOR MOMMSEN, Reden und Aufsätze. 1905, S. 9; H. LEO, a.a.O., S. 138; sämlich zit. Nr. 8, S. 62, 103.
ERNST BAASCH, Geschichte Hamburgs 1914–1918. Stuttgart 1925, Bd. II, S. 320; WERNER V.MELLE, Dreißig Jahre Hamburger Wissenschaft, 1891–1921. Bd. I, Hamburg 1923, S. 356. Die Hinweise auf diese Stellen verdanke ich meinem Kollegen KARL SCHILLER, Hamburg.
KONRAD MÜLLER, Die Standortbestimmung bei der Neugründung von Universitäten. In: Nr. 31, S. 90.
J.W. GOETHE, Kunst und Altertum am Rhein und Main. Bd. 12 Artemis-Ausgabe, Zürich 1949, S. 523; seine Äußerung ausführlich zit. bei K. MÜLLER, Nr. 31, S. 76, 81f.
JOH. H. CHR. CAMPE, Geschichte und Unterricht in der Geschichte. Leipzig 1859, S. 243; vgl. ROESSLER, Nr. 64, S. 101ff: Die Erziehung zum gelehrten Stand.
Vgl. JOHAN HUIZINGA, Erasmus. Basel 1936; als ‹Europäischer Humanismus: Erasmus›. rde Bd. 78, Hamburg 1958, 2. Aufl. 1962, S. 93.
THEODOR GEIGER, Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft. Stuttgart 1949, S. 2, 12 usw.; vgl. auch HEINRICH STIEGLITZ, Der soziale Auftrag der freien Berufe. Köln-Berlin 1946, bes. S. 149ff.
Vgl. eine ähnliche Kritik der akademischen Gebildeten als ‹Oberschichten-Elite› bei HANS PAUL BAHRDT, Gibt es eine Bildungselite? In: atomzeitalter, Heft 5, 1962.
Diesen Zug des deutschen Bildungsbürgertums betont und belegt WALTER BENJAMIN, Deutsche Menschen. Frankfurt 1962.
Vgl. KARL MANNHEIM, Ideologie und Utopie. 3. Aufl. Frankfurt 1952, S. 135: ‹Eine solche stets experimentierende, eine soziale Sensibilität in sich entwickelnde, auf die Dynamik und Ganzheit ausgerichtete Haltung wird aber nicht eine in der Mitte gelagerte Klasse, sondern nur eine relativ klassenlose, nicht allzu fest gelagerte Schicht im sozialen Raum aufbringen … Jene nicht eindeutig festgelegte, relativ klassenlose Schicht ist (in Alfred Webers Terminologie gesprochen) die sozial freischwebende Intelligenz.›
PETER R. HOFSTÄTTER, Einführung in die Sozialpsychologie. Wien 1954, S. 205, vgl. auch S. 78.
Vgl. HELMUT SCHELSKY, Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. 4. Aufl., Stuttgart 1955, S. 159.
RÜDIGER ALTMANN, Die Fragwürdigkeit der Bildungspolitik in unserer freien industriellen Gesellschaft. Bergedorfer Gesprächskreis zu Fragen der freien industriellen Gesellschaft, Protokoll Nr. 1, 1962, Hamburg 1962.
Vgl. W. FLITNER, A.L. Hülsen und der Bund der freien Männer. Jena 1913.
W. V.HUMBOLDT, Ges. Schriften, Akademieausgabe, Bd. X, S. 100.
Vgl. seine Charakterisierung der geistigen Anforderungen an einen ‹höheren Staatsbeamten› in dem ‹Gutachten über die Organisation der Ober-Examinations-Kommission› von 1809. Ges. Schr. Bd. X, S. 87; vgl. auch KAEHLER, Nr. 41, S. 238.
Nr. 41, S. 227; die gleiche Erklärung des Tatbestandes bei R. KÖNIG, Nr. 45, S. 161f; noch neuerdings die Betonung dieses Widerspruchs bei SPRANGER, Nr. 79, S. 10, und WENKE, Nr. 92, S. 27.
H. SCHELSKY, Anpassung oder Widerstand? Soziologische Bedenken zur Schulreform. Heidelberg 1961, S. 178.
W. V.HUMBOLDT, Ideen zu einer Instruktion für die wissenschaftliche Deputation bei der Sektion des öffentlichen Unterrichts. Ges. Schriften, Bd. X, S. 179ff; Votum zu Süverns Entwurf einer Instruktion für die wissenschaftliche Deputation vom 15. November 1809. Ebd. S. 196ff.
Zitiert bei LENZ, Nr. 50, S. 89.
So berichtet bei RUDOLF KÖPKE, Die Gründung der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berlin 1860, S. 75; kürzer im ‹Organisationsplan›: ‹Die Hauptsache beruht auf der Wahl der in Tätigkeit zu setzenden Männer›, Nr. 38, S. 254.
Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Hg. von A.v.Sydow, Berlin 1906ff, Bd. III, S. 19 und S. 399.
KLUGE, Nr. 44, S. 78ff.
Vgl. KARL JASPERS, Das Doppelgesicht der Universitätsreform. In: Nr. 75, S. 36–51.
Vgl. dazu HERMANN HEIMPEL, Alexander von Roes und das deutsche Selbstbewußtsein des 13. Jh. In: Archiv für Kulturgesch. Bd. 26, 1935, S. 19ff; HERBERT GRUNDMANN, Über die Schriften des Alexander von Roes. Dtsch. Arch.f.Erforschung des Mittelalters, Bd. 8, 1950, S. 154ff, und DERS., Nr. 25, S. 59ff.
Nr. 44, S. 114; KLUGE rechnet die nationalsozialistische und die sowjetzonale Universitätsumgestaltung nach 1933 bzw. 1945 nicht mit zu den Universitätsreformen, obwohl er z.B. durchaus sieht, daß ‹während der Herrschaft des Nationalsozialismus die deutschen Universitäten eine radikale Umgestaltung erfahren haben› (ebd. S. 100); zu einer Strukturtypologie der Hochschulreform gehören unseres Erachtens aber diese universitätspolitischen Maßnahmen der totalitären Systeme unbedingt dazu, da sonst eine wichtige und in gewissen Ausmaßen immer wirksame Strukturtendenz dieses Verhältnisses von Staat und Universität unberücksichtigt bliebe.
E. BERNHEIM, Die gefährdete Stellung unserer deutschen Universitäten. Rektoratsrede Greifswald 1899, S. 3.
Haus der Abgeordneten. Stenogr. Bericht der Sitzung vom 19.2.1859, S. 208, zit. Nr. 8, S. 57; vgl. zu diesem Absatz ebd. S. 53–57, und KLUGE, Nr. 44, S. 85–93.
Vgl. zum Begriff der Selbstregierung der Hochschule WERNER NÄF, Wesen und Aufgabe der Universität. Denkschrift im Auftrage des Senates der Universität Bern, 1950, S. 109, und GERBER, Nr. 23, S. 42.
Vgl. dazu den kritischen Aufsatz von HELLMUT BECKER, Kulturverwaltung oder Kulturpolitik? 1956, abgedr. in Nr. 6, insbes. S. 190ff; weiterhin KLUGE, Nr. 44, S. 108f; KÖTTGEN, Nr. 46, S. 5.
G. VICO, Opere, Bd. I, S. 131f. In: Scrittori d’Italia, hg. v.B. Croce u.a., Bari 1914–31; I. KANT, Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. 1787, S. XII f; FRIEDRICH JONAS, Sozialphilosophie der industriellen Arbeitswelt. Stuttgart 1960, S. 205.
HUGO DINGLER, Das Experiment. Sein Wesen und seine Geschichte. München 1928, S. 251.
Vgl. JACQUES ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle. Paris 1954, S. 16ff, und SCHELSKY, Nr. 71, S. 11f.
HANS FREYER, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart 1955, S. 167.
Vgl. MAX WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1922, S. 365.
A. V.HARNACK, Vom Großbetrieb der Universität. 1905. In: Aus Wissenschaft und Leben, Bd. I, Gießen 1911, S. 10ff; F. EULENBURG, Der akademische Nachwuchs. Leipzig-Berlin 1908; MAX WEBER, Nr. 86; H. PLESSNER, Nr. 56; zur grundsätzlichen Problematik vgl. M. SCHELER, Nr. 68, insbes. die Abhandl. ‹Erkenntnis und Arbeit›, S. 233ff.
Vgl. z.B. A. BUSCH, Nr. 8, S. 29ff.
Vgl. H. HERMELINK und S.A. KAEHLER, Die Philipps-Universität zu Marburg 1527–1927. Marburg 1927, S. 546; F. TRENDELENBURG, Aus heiteren Jugendtagen. Berlin 1924, S. 116; M. LENZ, Nr. 50II, 1, S. 432; vgl. Nr. 8, S. 29.
Nr. 57, I; auch H. ANGER, Nr. 1, bes. den Teil ‹Nachwuchsprobleme›, S. 360–450.
Vgl. dazu die Analyse der Medizin von RENATE FRENZEL in Nr. 57 I, S. 181–220, Zitate S. 206/07; vgl. auch CHRISTIAN GRAF VON KROCKOW, Soziologische Aspekte der klinischen Medizin. Deutsche Universitätszeitung, 13. Jg. 1958, S. 650–658.
So vor allem GOLDSCHMIDT u. FRENZEL in Nr. 57 I, S. 44, 217, 220; V. KROCKOW, a.a.O., S. 651ff.
Vgl. Preußische Statistik, Bd. 236, 1913, S. 75, und CÄCILIE QUETSCH, Die zahlenmäßige Entwicklung des Hochschulbesuchs in den letzten fünfzig Jahren. Berlin 1960, S. 44.
Vgl. die eigenhändigen Entwürfe W. V.HUMBOLDTs, ‹Gutachten über die Organisation der Ober-Examinations-Kommission› vom 8.7.1809 und ‹Über Prüfungen für das höhere Schulfach› vom 11.4.1810, Ges. Schr., Bd. X, hg.v.Bruno Gebhardt, Berlin 1903, S. 81ff, 239ff.
Zit. bei H. HAEVECKER, 40 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. In: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1951.
DIETER BIELENSTEIN, Autonomie der Forschung? Zur Manipulation der Wissenschaft durch Staat und Wirtschaft. In: atomzeitalter, Mai 1961, S. 106.
Vgl. HELMUT SCHELSKY, Die skeptische Generation. Düsseldorf 1957, S. 314ff, und HABERMAS, Nr. 26, S. 279.
ANDREAS PREDÖHL, Ein Kartell der Kultusminister. Darf die wissenschaftliche Laufbahn bürokratisiert werden? In: Frankfurter Allgemeine vom 27.2.1962.
Vgl. M.G. LANGE, Totalitäre Erziehung. Frankfurt 1954; HABERMAS, Nr. 26, S. 270; WILHELM GIRNUS, Zur Idee der sozialistischen Hochschule. Berlin 1957.
Vgl. z.B. LITT, Nr. 49; HEINRICH WEINSTOCK, Arbeit und Bildung. Heidelberg 19562; WERNER LINKE, Technik und Bildung. Heidelberg 1961; JOHANN FRIEDRICH HEYDE, Technik und Bildung. In: Nr. 75, S. 242–276, u.a.
Vgl. LLOYD BERKNER, Erdsatelliten und Außenpolitik. In: Foreign Affairs, Januar 1958; ARNOLD GEHLEN, Was wird aus den Intellektuellen? In: Wort und Wahrheit, Jg. XIII, 1958, S. 614f.
Vgl. z.B. Bundesminister Professor SIEGFRIED BALKE, Grenzschichtprobleme in Wissenschaft und Politik. Essen 1957.
Vgl. WILHELM DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Ges. Schriften, Bd. I, Leipzig 1913; ERICH ROTHACKER, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften. Bonn 19483.
ALFRED WEBER, Abschied von der bisherigen Geschichte. Hamburg 1948; DERS., Der dritte oder der vierte Mensch. München 1953.
Vgl. THEODOR W. ADORNO, Kulturkritik und Gesellschaft. In: Prismen, Frankfurt 1955.
Wie sehr gerade BECKERs Betonung der Soziologie die Gemüter damals bewegt hat, geht aus der heftigen Polemik hervor, die der Historiker V. BELOW und der Soziologe F. TÖNNIES über das Thema ‹Soziologie und Hochschulreform› geführt haben; vgl. GEORG V.BELOW, Soziologie als Lehrfach. Ein kritischer Beitrag zur Hochschulreform. München 1920; FERDINAND TÖNNIES, Soziologie und Hochschulreform. Weltwirtschaftliches Archiv, XVI. Bd. , 1920/21, S. 212ff; und wiederum G. V.BELOW, Soziologie und Hochschulreform. Eine Entgegnung. Ebd. S. 512ff.
HANS FREYER, Das politische Semester. Ein Vorschlag zur Hochschulreform. Jena 1933.
Zuerst erschienen in LEOPOLD V.WIESE (Hg.), Soziologie des Volksbildungswesens. München 1921; dann aufgenommen in Nr. 68, S. 489–537.
Nr. 69; vgl. zu SCHELERs Bildungstheorie auch: Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik. Halle 1913/16, und die verschiedenen Passagen über das ‹Bildungswissen› in Nr. 68.
Vor allem sei hier auf die von der Rektorenkonferenz veröffentlichte Sammlung der ‹Dokumente zur Hochschulreform 1945–1959› – Nr. 53 – hingewiesen, die alles Wichtige bis 1959 enthält; dann die Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates Nr. 93, 94. Zahlreiche Beiträge und Stellungnahmen zur Hochschulreform in den von der Westdeutschen Rektorenkonferenz mitgeteilten Empfehlungen, Entschließungen und Nachrichten (Schwarze Hefte), in der Deutschen Universitätszeitung, bisher (1962) 17 Jahrgänge, und in den Mitteilungen des Hochschulverbandes, bisher 10 Bde.
Blaues Gutachten vgl. Nr. 53, S. 346; V. WEIZSÄCKER ebd. S. 371; V. Dtsch. Studententag: restaurieren – reparieren – reformieren, ebd. S. 168 bis 243, bes. S. 184ff; HEIMPEL, Nr. 28, S. 27. Zum Studium generale vgl. WALTHER KILLY, Studium generale und studentisches Gemeinschaftsleben. Berlin 1952, und WALTER RÜEGG, Humanismus, Studium generale und Studia Humanitatis in Deutschland. Genf/Darmstadt 1954. Für vergleichende Bemühungen um eine ‹Bildungsreform› der Universität sei auf das Wirken ROBERT M. HUTCHINS in den USA und auf die an das Buch von Sir ROBERT MOBERLY, The Crisis in the University. London 1949, folgende Diskussion in England verwiesen, z.B. MICHAEL OAKESHOTT, The Universities. In: The Cambridge Journal, vol. II, 1949, p. 515–542; M.L. OLIPHANT, L. ELVIN, Lord LINDSEY OF BIRKER u.a. in Universities Quarterly, vol. 4, 1949, p. 11ff.
EDUARD BAUMGARTEN, Gedanken zur künftigen Hochschule. In: Mitteil.d.Hochschulverbandes, Bd. 8, 1960, S. 135; SIEGFRIED FLÜGGE, Gedanken zur Hochschulreform. Schriftenreihe des Forschungsrates des Landes Hessen, 1959. Zur ‹Europa-Universität› vgl. ALEXANDER NIKURADSE (Hg.), Europäische Universität, ein Gebot der Stunde. Berlin 1960; DERS., Zur Idee der europäischen Universität. In: Nr. 75, S. 548ff; HENDRIK BRUGMANS, Probleme einer Europäischen Universität. Ebd. S. 582; GUSTAV MENSCHING, Idee und Aufgabe der Weltuniversität. Ebd. 610ff; gegen diese Pläne kritische Stellungnahmen der Rektorenkonferenz, des Stifterverbandes usw.
Hofgeismarer Kreis vgl. Nr. 53, S. 466ff; G. RITTER, Nr. 62, zit. S. 21; AUGUST RUCKER, Ziele und Wege des akademischen Studiums. Gedanken zur Reform der Studiengänge. Heidelberg 1960, zit. S. 26; WILHELM WALCHER, Die personelle Struktur der neuen Hochschulen im Bereich der Naturwissenschaft, besonders der Physik. In: Nr. 32, S. 35ff; die Bedenken der Rektorenkonfrenz Nr. 53, S. 75; JASPERS-ROSSMANN, Nr. 40, S. 180ff, zit. S. 207; PAUL BOCKELMANN, Aufgaben und Aussichten der Hochschulreform. In: Ruperto-Carola, Mitteil.d.Vereinig. d. Freunde d. Studentenschaft d. Univ. Heidelberg, XIII. Jg., 1961, S. 91–96; TELLENBACH, Nr. 82, S. 11f.
HELMUT COING, Lage und Ausbau der deutschen Hochschulen. Mitt.d.Hochschulverbandes, Bd. 8, 1960, S. 18; LUDWIG RAISER, Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates als Appell an die Hochschullehrer. Ebd., Bd. 9, 1961, S. 81; kritisch z.B. schon der Hofgeismarer Kreis, Nr. 53, S. 478; ANRICH, Nr. 3, S. 93ff; BOCKELMANN, a.a.O.; u.a.
Blaues Gutachten, vgl. Nr. 53, S. 295; HEIMPEL, Nr. 28, S. 21, 27; vgl. auch WILHELM HAHN, Die Problematik der deutschen Hochschulen heute. In: Nr. 31, S. 13f; ROTHE, Nr. 66 und: Der Bremer Universitätsplan. In: Nr. 31, S. 114; Wissenschaftsrat, Nr. 94, insbes. S. 73, 75f, 78, 81, 97; kritisch: Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Studentenschaften im März 1962 in München nach Zeitungsmeldungen; WENKE, Nr. 91, S. 14; auch JASPERS-ROSSMANN, Nr. 40, S. 182f; HUBERT OHL, Hochschule und Studentenwohnheim. In: Nr. 31, S. 135f; JÜRGEN FISCHER, Das Studentenwohnheim und seine Hochschule. In: Die Deutsche Universitätszeitung, 17. Jg., 1962, S. 7–10.
BAUMGARTEN, Kriterien zum Entwurf neuer Universitäten. In: Nr. 31, S. 41, 46; WENKE, Nr. 91, S. 27.
BAUMGARTEN, in Nr. 31, S. 38, 41, 43, 53; RAISER, a.a.O., Anm. 9, S. 83.
Wissenschaftsrat Nr. 94, S. 16f; WALCHER, a.a.O., Anm. 8, S. 44ff; BAUMGARTEN, Nr. 31, S. 42f.
AUGUST FLESCH, Universitas ‹Utopia›. In: Die Deutsche Universitätszeitung, 17. Jg. 1962, S. 4; BAUMGARTEN in Nr. 31, S. 53.
Rektorenkonferenz, Nr. 53, S. 46; THURE VON UEXKÜLL, Die personelle Struktur der klinischen Fächer in den neuen Hochschulen. In: Nr. 32, S. 21ff.
Sie entsprechen im gewissen Sinne den ‹latenten Funktionen› ROBERT K. MERTONS; vgl. dessen Abhandlung Manifest and Latent Functions. In: Social Theory and Social Structure. Glencoe, Illinois, 4. Aufl. 1961, S. 19ff.
THEODOR VIEHWEG, Der deutsche Jurist. Über Mängel und Reform des Rechtsstudiums in der Bundesrepublik. In: Wort und Wahrheit, XVII. Jg., 1962, S. 362.
GEORGES SOREL, Le procès de Socrate. 1889, zit. bei MICHAEL FREUND, Georges Sorel, Der revolutionäre Konservativismus. Frankfurt a.M. 1932, S. 30.
ARNOLD J. TOYNBEE, Der Gang der Weltgeschichte. Stuttgart 1949, bes. S. 61ff, 423ff.
Das große und eigentümliche Geschenk der Universität war das Geschenk einer Zwischenzeit. Hier war die Möglichkeit, die liebevollen Bindungen der Kindheit und Jugend aufzugeben, ohne den Zwang, sie durch neue Verpflichtungen zu ersetzen …, eine Möglichkeit, jenes ‹interesselose Urteil› zu gewinnen, mit dem verglichen eine bloß liberale ‹Neutralität› nur ein Schatten ist … Wir, die wir nicht zu den Muße- und Luxusklassen zählten, waren für kurze Zeit befreit vom Fluche Adams, der bedrückenden Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel.
Vgl. ARISTOTELES, Metaphysik, I. 2, und Nic. Ethik, I. 1 und VI. 7; RITTER, Nr. 63, S. 14ff u. 23; vgl. DERS., Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theorie bei Aristoteles. Köln-Opladen 1953, und: Zur Grundlegung der praktischen Philosophie bei Aristoteles. Archiv f. Rechts- u. Sozialphilos., Bd. XLVI, 1960, S. 179–199.
Zur Klärung des soziologischen Theoriebegriffs vgl. ROBERT K. MERTON, a.a.O., insbes. die Abhandlungen The Bearing of Sociological Theory on Empirical Research und The Bearing of Empirical Research on Sociological Theory S. 85–117; TALCOTT PARSONS, The Position of Sociological Theory und The Present Position and Prospects of Systematic Theory in Sociology. In: Essays in Sociological Theory Pure and Applied. 3. Aufl., Glencoe, Illinois, 1949, S. 3–41; RENÉ KÖNIG, Artikel ‹Geschichts- und Sozialphilosophie›. In: Das Fischer Lexikon: Soziologie, Frankfurt 1958, S. 88–96; HELMUT SCHELSKY, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie. Düsseldorf 1959, insbes. S. 86ff.
Vgl. RIESMAN, Nr. 61, bes. Teil III: Secondary Education and ‹Countercyclical› Policy, S. 120–174.
Vgl. H. SCHELSKY, Das Problem des Nonkonformismus bei David Riesman. Eine Betrachtung zur Autonomie der Person in der modernen Gesellschaft. In: Randzonen menschlichen Verhaltens. Festschrift für Hans Bürger-Prinz, Stuttgart 1962, S. 46f.
Vgl. SCHELSKY, Nr. 71, S. 41, und die Analyse vom ‹Mythos des Menschen› in der technischen Zivilisation bei JACQUES ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle. Paris 1954, S. 351ff.
Diese Schrift zur Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen ist von einem Soziologen geschrieben, ohne deswegen eine soziologische Schrift zu sein. Sie ist ein Versuch der historischen Erinnerung und der Vergegenwärtigung geschichtlichen Geschehens mit der Absicht, uns von der bloßen Tradition und von der geistigen Herrschaft des Historischen zu befreien. Sie wirft dem deutschen Bildungs- und Universitätsdenken der letzten Generationen vor, in nur ideenhaft-geistesgeschichtlichen Vorstellungen von Bildung und Wissenschaft erstarrt zu sein, und wird doch selbst wieder die Dominanz der Idee in allen Versuchen, die Einrichtungen der Wissenschaft und Bildung zu erneuern, mit Emphase behaupten. Sie ist davon überzeugt und glaubt es beweisen zu können, daß die Ideen WILHELM VON HUMBOLDTs über das Wesen der Universität, der Bildung und der Hochschulpolitik auch heute noch ihre Gültigkeit und Gestaltungskraft für die Zukunft unserer Universität haben, und doch wird sie denen, die sich als die legitimen Bewahrer der Humboldtschen Ideen fühlen, ein Ärgernis sein.
Diese Widersprüche gehen zum großen Teil darauf zurück, daß ich es für berechtigt und fruchtbar ansehe, die Methode der soziologischen Analyse auch in der Erörterung der Idee der Universität anzuwenden. Ich halte es für eine Voreingenommenheit, zu glauben, die soziologische Betrachtung denaturiere sozusagen die Idee zur bloßen funktionalen Abhängigkeit von den sozialen Tatsachen. Gewiß besteht die Aufgabe der Soziologie nicht darin, die ‹Idee› in ihrem normativen Gehalt zu propagieren und zu predigen, wohl aber kann sie die Funktion der Idee für gestaltendes soziales Handeln aufweisen und die strukturellen Zusammenhänge zwischen der Freiheit der Idee und den sozialen Notwendigkeiten erhellen, Einsichten, die zur Entfaltung des ‹hellsten Bewußtseins des Zeitalters›, worin JASPERs mit Recht die unaufgebbare Idee der Universität erblickt (Nr. 40, S. 1)[1], heute dazugehören. Es ist auffällig, wie sehr sich das deutsche wissenschaftliche Denken bisher dem Gesichtspunkt der soziologischen Analyse der Universität verschlossen hat; während zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika seit Generationen (von THORSTEIN VEBLEN und UPTON SINCLAIR bis zu DAVID RIESMAN)[2] unbekümmert die sozialen Zusammenhänge der Universität soziologisch überprüft werden, zerfällt die deutsche wissenschaftliche Erörterung der Universität in pädagogisch-philosophische Ideenanalyse und hochschulrechtliche Untersuchungen, also beides unmittelbar normative Betrachtungsweisen, einerseits und in unmittelbar pragmatische, die sozialen Tatsachen meist sehr subjektiv in Betracht ziehende Universitätsplanungen andererseits; eine analytische Soziologie der Universität gibt es bei uns kaum in Ansätzen. Wenn dies verkannt wird und die vielfachen Ansprüche der sozialen Wirklichkeit an die Universität bereits als soziologische Erkenntnis verstanden werden, die von ‹der Verantwortung für die Substanz der Sache› abführen, so verwechselt man hier in einer heutzutage allzu häufigen intellektuellen Schwäche ‹sozial› und ‹soziologisch›, eine Infektion, vor der leider auch hervorragende Gelehrte nicht geschützt sind.
Wenn wir meinen, daß auch die normative ‹Idee› der Universität erst einmal einer absichtslosen soziologischen Analyse ihrer Handlungsstrukturen und -möglichkeiten zu unterwerfen ist und damit einer ideell gestaltenden Reform der Universität eher neue und reale Chancen des Zugriffs geboten werden, als daß die Erkenntnis der sozialen Zusammenhänge die Idee in der bloßen Anerkennung der Faktizität erdrosselte, so befinden wir uns in dieser wissenschaftlichen Handlungsvorstellung mit den Einsichten in Übereinstimmung, die der Gelehrte und Staatsmann geäußert hat, der in der Begründung der Idee und der Institution der deutschen Universität die hervorragendste Rolle spielt: mit WILHELM VON HUMBOLDT. In seiner Rede beim Eintritt in die Berliner Akademie der Wissenschaften im Januar 1809, also zu Beginn seines staatsmännischen kulturpolitischen Wirkens, hat er die bemerkenswerten Sätze gesprochen: ‹Dann gießt die Wissenschaft oft ihren wohltätigen Segen auf das Leben aus, wenn sie dasselbe gewissermaßen zu vergessen scheint›; ihr wahrer Wert zeigt sich darin, den menschlichen Geist so zu bilden, ‹daß er den schwer zu entdeckenden Punkt nicht verfehlt, auf welchem Gedanke und Wirklichkeit sich begegnen und freiwillig ineinander übergehen. Es gibt in allen wichtigen Geschäften des Lebens einen solchen Punkt, den nur der mit der reinen Wissenschaft Vertraute erreichen und nur das wahrhaft praktische Talent nie überschreiten wird›[3]. Auch uns geht es in dieser Erörterung der deutschen Universität und ihrer Reform darum, den Punkt zu finden, ‹auf welchem Gedanke und Wirklichkeit sich begegnen und freiwillig ineinander übergehen›. Die damit vertretene Auffassung der sozialen Handlung unterscheidet sich von der idealistischen darin, daß sie nicht deren Hybris teilt, die geschichtliche und soziale Wirklichkeit sei schlicht und unmittelbar bloßes Material der Idee, deren Überzeugungskraft sich das faktisch Vorhandene einfach zu unterwerfen hat. Auch wir hoffen auf eine ‹Begegnung›, auf ein ‹freiwilliges Ineinanderübergehen› von Idee und Wirklichkeit. Der ‹Gedanke› – und es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß HUMBOLDT damit die ‹Idee› im Sinne des philosophischen Idealismus meint – ist Partner der Wirklichkeit, die dem Handelnden ihre eigenen Ansprüche stellt; diese müssen als solche erkannt und dürfen nicht von der vorgefaßten Idee vergewaltigt werden. Von HUMBOLDT stammen daher auch die Sätze: ‹Es ist zwischen Leben und Idee zwar ein ewiger Abstand, aber auch ein ewiger Wettkampf: Leben wird zur Idee erhoben, und die Idee in Leben verwandelt›[4]. ‹Es genügt nicht›, sagt KARL MARX später im gleichen Sinne gegen die bloßen ‹Idealisten›, ‹daß der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muß sich selbst zum Gedanken drängen›[5]. Beide gegensinnig verlaufende Vorgänge bedürfen heute der Hilfe der Wissenschaft: die Sublimierung der vorhandenen Wirklichkeit zur Idee bedarf der ‹absichtslosen› analytischen Erkenntnis der Wirklichkeit; die Planungen der Wirklichkeitsveränderung bedürfen der wissenschaftlich gefestigten Ideen und Prinzipien. So ist unsere Aufgabe auf der einen Seite, der vorhandenen sozialen Wirklichkeit unserer Universitäten die in ihnen steckenden normativen Möglichkeiten abzulauschen, auf der anderen Seite den Anspruch der so erkannten ideellen Ziele der Universität in die vorhandene soziale Wirklichkeit gestaltungskräftig hineinzudenken. Dieser Versuch soll hier gemacht werden. –
Der Erste Teil der Schrift ist der Untersuchung der Vorgänge gewidmet, die zur Gründung der Universität Berlin im Jahre 1809 geführt haben, mit der Absicht, die noch heute gültigen Strukturen der sozialen Handlungen aufzudecken, die zu einer so vorbildhaften Erneuerung der deutschen Universität geführt haben. Dabei ist das I. Kapitel im wesentlichen eine Schilderung der kultur- und universitätspolitischen Situation vor 1800, die sich auf die bereits vorhandene historische Literatur stützt und, dem enzyklopädischen Charakter der Reihe entsprechend, in der diese Schrift erscheint, vielfach auch einfach über Tatbestände unterrichtet, deren Kenntnis bei dem mit dem Gegenstand wissenschaftlich Vertrauten vorausgesetzt werden konnte. Auch die weiteren Kapitel des Ersten Teiles bringen vielfach informativ literarische Belege, die im Text unmittelbar auszubreiten uns fruchtbarer erschien, als sie in einen dokumentarischen Anhang zu verweisen; sie wollen darüber hinaus aber bereits die soziologischen Gesichtspunkte der Humboldtschen Universitätsgründung herausarbeiten, die nach unserem Urteil bisher in der geistesgeschichtlichen Tradierung der deutschen Universitätskonzeption allzusehr vernachlässigt wurden und dennoch gerade für die Gegenwart sehr aktuell sind. Der Zweite Teil der Schrift versucht eine soziologische Analyse der gegenwärtigen Universität und ihrer Reformbestrebungen. Da es sich herausstellen wird, daß diese Bemühungen um eine Erneuerung der Universität ohne eine klare Theorie der Wissenschaft und ohne eine zeitgemäße Idee der wissenschaftlichen Bildung vergeblich bleiben müssen, mußte der Versuch, eine Wissenschaftstheorie und eine universitäre Bildungsidee für die Gegenwart zu entwerfen, gewagt werden; der Unvollkommenheit dieses Unterfangens bin ich mir bitter bewußt.