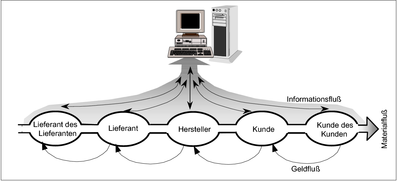UNIVERSITÄT HAMBURG
FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Institut für Industriebetriebslehre und Organisation

Supply Chain Management
als Ansatz zur Effizienzsteigerung
in der Logistikkette
Diplomarbeit in Industriebetriebslehre
eingereicht von :
Elena Tsyganova Betriebswirtschaftslehre 8. Fachsemester
Hamburg, den 20. Oktober 1999
Abkürzungsverzeichnis
a.o. and other
ANX Automotive Network Exchange
APO Advanced Planner & Optimizer
APS Advanced Planning and Scheduling
ATP Available to Promise
Aufl. Auflage
BMI Buyer Managed Inventory
bspw. beispielsweise
BSL Bundesverband Spedition und Lagerei
bzw. beziehungsweise
ca. cirka
CAD Computer Aided Design
CCG Centrale für Coorganisation GmbH
CD Cross-Docking
CDP Cross-Docking-Point
CMI Co-Managed Inventory
CRP Continuous Replenishment Program
d.h. das heißt
DV
Datenverarbeitung
EA Efficient Assortment
EAN Europäische Artikel Nummer
ECR Efficient Consumer Response
ed. edition
EDI Electronic Data Interchange
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, EDIFACT Transport
Elektronische Datenverarbeitung
EDV European Network Exchange
ENX Efficient Replenishment ER Efficient Promotion EP Efficient Product Introduction
EPI et cetera
etc.
EUL Efficient Unit Loads
Hrsg. Herausgeber
ILN International Location Nummer
JiT Just-in-Time
MADAKOM Marktdateninformation
MTV Mehrweg-Transportverpackungen
NVE Nummer der Versandeinheit
Organisation for Data Exchange by ODETTE Teletransmission in Europe
Point of Sales
POS Quick Responce Services
QRS Supply Chain Council
SCC Supply Chain Execution
SCE Supply Chain Management
SCM Supply Chain Planning SCP Supply Chain Operations Reference Model SCOR Standardregelungen einheitlicher Datenaustauschsysteme
SEDAS Standardregeln einheitlicher Logistiksysteme
SELOS Secure Electronic Transfer Protocol
SET Stammdateninformation
SINFOS Serial Shipping Container Code
SSCC Secure Sockets Layer SSL Transmission Controll Protocol / Internet Protocol TCP /IP und andere
u.a. und so weiter
usw. Value Added Network Services
VAN Verband der Automobilindustrie
VDA vergleiche
vgl. Vendor Managed Inventory VMI Virtuelle Private Network VPN zum Beispiel
z.B.
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1: Supply Chain Management 3
Darstellung 2: Das Zielsystem des Supply Chain Managements 6
Darstellung 3: Kernkompetenzen der Supply Chain 8
Darstellung 4: Funktions- und Prozeßorientierte Organisationsgestaltung 10
Darstellung 5: Modellierung der Schnittstellen 11
Darstellung 6: ANET-Pilot als der Vorläufer von ENX 16
Darstellung 7: Das Aufgabenmodell des Supply Chain Managements 18
Darstellung 8: Kernmanagementprozesse der Supply Chain 21
Darstellung 9: Konfigurationswerkzeug des SCOR-Modells 21
Darstellung 10: Drei Prozeßebenen des SCOR-Modells 22
Darstellung 11: Darstellung der Ebene 2 des SCOR-Modells 23
Darstellung 12: Supply Chain des ACME-Laptops 24
Darstellung 13: Darstellung der Ebenen 3 und 4 des SCOR-Modells 24
Darstellung 14: Zuordnung von Leistungsmerkmalen und Kennzahlen zum Prozeßelement 25
Darstellung 15: Empfehlung zum Prozeßelement von Best Practices und Software 25
Darstellung 16: Integrierte Supply Chain Planung 26
Darstellung 17: Gegenüberstellung traditioneller und fortgeschrittener Planungssysteme 27
Darstellung 18: Sequentielle und simultane Planung 28
Darstellung 19: Bullwhip-Effekt 29
Darstellung 20: Cross-Docking System 35
Darstellung 21: Logistics Postponement in der Supply Chain für HP-Printer 41
Darstellung 22: Form Postponement 42
Darstellung 23: Übergang von traditioneller Beschaffung zum Modular Sourcing in der SC 45
Darstellung 24: Elemente des Supply Chain Managements 48
Darstellung 25: ECR-Hindernisse 51
Darstellung 26: Effizienzsteigerung in der Logistikkette durch den SCM - Ansatz 52
Darstellung 27: Kernkompetenzen und Produkte bei Canon I
Darstellung 28: Von Kernkompetenzen zu Endprodukten in der Supply Chain I
Darstellung 29: Standards in Efficient Consumer Response, Deutschland V
1 Einführung
1.1 Unternehmerische Umwelt im Wandel
Seit Anfang der 90er Jahre spielt das Supply Chain Management (SCM) eine wachsende Rolle als Instrument zur Effizienzsteigerung in Unternehmen. Diese Entwicklung ist bestimmt durch folgende Trends in Gesellschaft, Wirtschaft und den Technologien:
Globalisierung
der Märkte erfordert einerseits notwendige regionale Anpassungen und ande- eine systematische Integration der regionalen Strukturen im globalen Unternehmensnetzwerk. Die entstehenden Organisationsformen sind durch extreme Heterogenität und eine Vielzahl von Schnittstellen gekennzeichnet, deren Überwindung eine starke Prozessorientierung der Organisationsstruktur benötigt.
1
Outsourcing
und Konzentration auf die Kernfähigkeiten bezeichnet einen Paradigmenwechsel beim Übergang von der Industrie- zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft. Die alten Paradigmen der industriellen Großbetriebe mit starker Arbeitsteilung und hierarchischer Aufbauorganisation betrachteten die Größendegressionseffekte als die effizienteste Form des Wirtschaftens. Die modernen Paradigmen sehen dagegen die effizientere Form des Wirtschaftens in einem Netzwerk spezialisierter Betriebe, die durch Informationsaustausch eng miteinander verknüpft sind.
2
Eine Verringerung der Fertigungstiefe
aufgrund des Outsourcing hat zur Folge, daß die Wettbewerbsfähigkeit der am Markt angebotenen Güter und Dienstleistungen nicht mehr durch ein einzelnes Unternehmen bestimmt wird, sondern durch die Leistungen aller an der Wertschöpfung beteiligten Partner. Dementsprechend gewinnt die unternehmensübergreifende Koordination an strategischer Bedeutung.
Die Qualität
der angebotenen Produkte genügt nicht mehr allein zur Abgrenzung von der Kon-
3
Über den Markterfolg entscheiden auch Faktoren wie Verfügbarkeit und Lieferzeit, das Angebot an maßgeschneiderten Produktvarianten sowie die Flexibilität bei kurzfristigen Änderungswünschen und Serviceleistungen.
4
Technischer Fortschritt
führt zu einer Verkürzung der Produktlebenszyklen und verschärft den Zeitfaktor im Wettbewerb. Eine immer schnellere Einführung von Produktinnovationen sowie kürzere Produktionszeiten sind notwendig.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien
unterstützen globalen Datenaus- in Echtzeit. Die neuen hauptspeicherresidenten Hochgeschwindigkeitsprogramme kommunizieren in standortübergreifenden Netzen und ermöglichen Simulationen und Planungen, die in traditionellen Planungsverfahren nicht machbar waren.
5
Die Einführung von integrierten Transaktionssystemen wie SAP, Baan, JD Edwards führten in der ersten Hälfte der 90er Jahre
mit der Standardisierung und Optimierung aller Geschäftsprozesse zur Integration des gesam- Belegflusses innerhalb eines Unternehmens.
6
Die geschilderten Entwicklungen stellen nicht nur hohe Anforderungen an das Unternehmen, sondern bedeuten auch große Chancen für ein überproportionales Wachstum. Die Fähigkeit des Unternehmens, schneller als andere auf die sich aus den Veränderungen ergebenden Chancen und Risiken zu reagieren, selbst aber auch proaktiv zu agieren, unterscheidet im modernen Wettbewerb Gewinner von Verlierern.
Das Streben nach Wettbewerbsvorteilen als eine Voraussetzung der Existenzsicherung unter Berücksichtigung von modernen Rahmenbedingungen führt die Unternehmen zur Suche nach neuen Konzeptionen: Die Durchführung des Business Process Reengineering und Lean Management restrukturierten und beschleunigten die betrieblichen Prozesse. Eine weitere Optimierung innerhalb des Unternehmens würde nur marginale Verbesserungen erzielen. Das Konzept des Supply Chain Managements soll die erheblichen Erfolgspotentiale durch die ganzheitliche Optimierung der gesamten unternehmensübergreifenden Wertschöpfungskette erschließen.
7
Es betrachtet alle Prozesse zur Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung vom Rohstofflieferanten bis zur Serviceleistung beim Endverbraucher und richtet sie auf die Erfüllung seiner Bedürfnisse aus.
8
Das Supply Chain Management verknüpft die Wertschöpfungsprozesse wie ein gemeinsames „Nervensystem“ miteinander; es ist daher für die Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität des gesamten Systems verantwortlich.
9
1.2 Gang der Untersuchung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung, welche Potentiale das Supply Chain Ma- zur Effizienzsteigerung in der Logistikkette erschließen kann und wo seine Grenzen sind. Die Untersuchung beginnt mit der Klärung der Begriffe Supply Chain und Supply Chain Management im Rahmen dieser Arbeit. Daran schließt die Darstellung des Supply Chain Management Konzeptes an, präsentiert weiterhin das Zielsystem, zeigt die zugrunde liegenden Prinzipien auf und verdeutlicht die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung des Supply Chain Managements.
Das Kapitel zur Modellierung der Logistikkette stellt eine Grundlage zur einheitlichen Betrach- der gesamten Supply Chain dar. Das Modell definiert die vier Kernmanagementprozesse Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung, die in den folgenden Kapiteln im Sinne der Effizienzbetrachtung untersucht werden.
Das Kapitel Supply Chain Management Planung und Steuerung weist darauf hin, welche Werk- dem Supply Chain Management zur Verfügung stehen und wie die effizienten Planungs-und Steuerungsprozesse dazu beitragen, die Logistikkette schlank und flexibel zu gestalten.
5
Vgl. Dinges (1998), S.22.
Da das Supply Chain Management den Kunden als Auslöser von Geschäftsprozessen in der Logistikkette betrachtet, geht der Gang der Untersuchung rückwärts vom Markt aus. Dementsprechend werden zunächst die Distributionsprozesse und ihre effiziente Gestaltung im Rahmen des SCMs diskutiert, gefolgt von den Fertigungsprozessen. Die Beschaffungsprozesse schließen den Untersuchungsgang ab.
Die Schlußbetrachtung faßt die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammen und gibt eine kritische Würdigung des Ansatzes.
1.3 Begriffsklärung
Der Begriff
Supply Chain
spiegelt die Verzahnung von Unternehmen bei der gemeinsamen Leistungserstellung wieder (s. Darst.1). Der Supply Chain entsprechen in der deutschen Literatur die Begriffe Logistikkette, Lieferkette, Versorgungskette und unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette.
10
Christopher definiert eine Supply Chain als ein Netzwerk von vertikal gebundenen Unternehmen, die in die Prozesse der Wertschöpfung für die Kunden in Form von Produkten und Dienstleistungen involviert sind.
11
Stadtler übersetzt eine Supply Chain als Produktions- und Logistiknetzwerk, um die Bedeutung von vielfältigen Verflechtungen, die bei der gemeinsamen Bearbeitung mehrerer Kundenaufträge entstehen, zu betonen.
12
Supply Chain umfaßt alle Beschaffungs-, Produktions-, Lager- und Transportaktivitäten vom Zulieferer der Rohmaterialien bis zum (End-) Kunden. Dementsprechend wird unter Supply Chain auch die Gesamtheit aller Geschäftsprozesse verstanden, die zur Befriedigung der Nachfrage nach Produkten oder Service erforderlich sind.
13
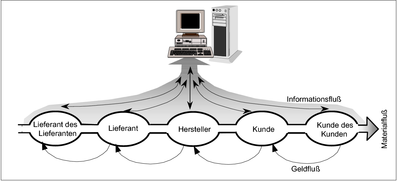
Darstellung 1: Supply Chain Management
14
Supply Chain Management (SCM) koordiniert alle Aktivitäten innerhalb einer Supply Chain, ausgehend von einer Kundenanforderung mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Supply Chain zu steigern.
15
Das Wort
Effizienz
stammt aus dem lateinischen Verb „efficere“ als Synonym von Wirkkraft, Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit.
16
Effizienz stellt in den Wirtschaftswissenschaften eine differenziertere Größe dar, indem sie die relativen Zielbeiträge von Maßnahmen erfaßt und hierdurch eine Abstufung dieser Maßnahmen ermöglicht.
17
Die Effizienz eines Logistiksystems kann auf der technologischen Ebene zum Beispiel durch die Produktivität, auf der ökonomischen Ebene durch die Rentabilität gemessen werden. Kriterien zur Beurteilung der Effizienz einer Logistikkette sind nicht nur die Kosten und Qualität der erbrachten Leistungen, sondern auch die zur Leistungserstellung benötigte Zeit sowie die Flexibilität der Anpassungen an Markterfordernisse.
18
2 Ansatz des Supply Chain Managements