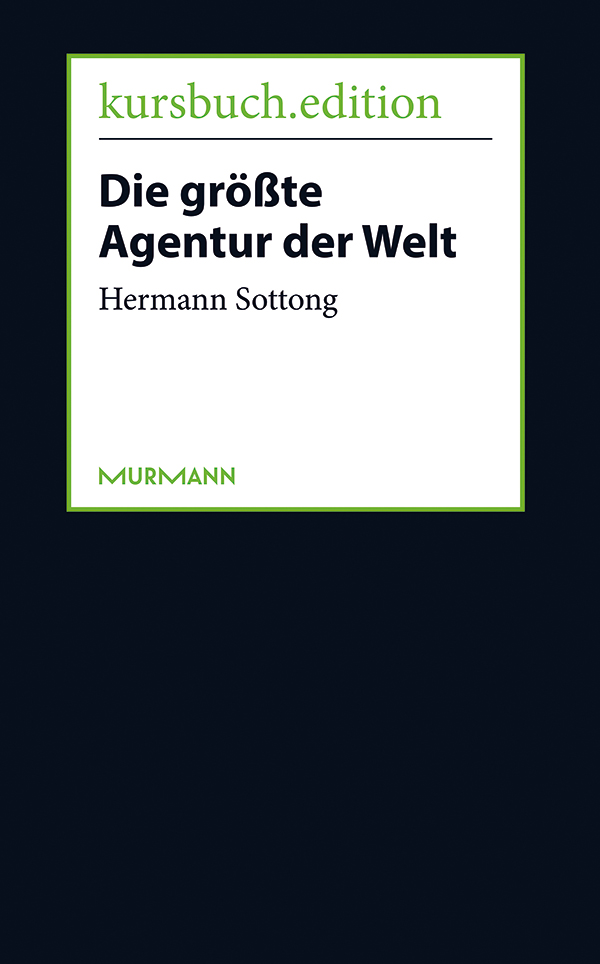
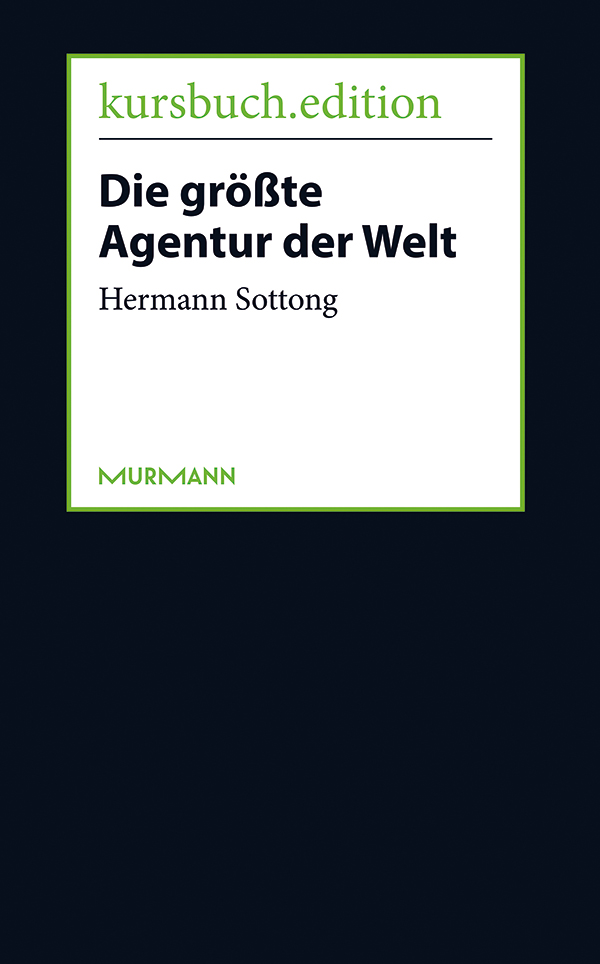

Hermann Sottong
Die größte Agentur der Welt
Anleitung zum
Post-Fake-Marketing
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Keine Marke ohne Zeichen: Die Semiotik der Marke
Das Markenzeichen
Was ist eine Marke?
Marken und Emotionen
Markendiskurse oder: Wie wir Konsumenten Marken machen
Der Owner und seine Marke
Werbung oder: Vom Versprechen zu Versprechungen
Die Zukunft der Marken in der digitalen Kultur
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Wir Menschen sind auf verlässliche Information angewiesen. Sie ist für unser Überleben ähnlich essenziell wie sauberes Wasser. Mit beiden Lebensgrundlagen sind wir in der Vergangenheit nicht immer pfleglich umgegangen. Lange Zeit wurde die Verschwendung und Verschmutzung wertvoller Ressourcen wie Wasser oder Information unbedacht hingenommen. Zu ernsthaften Reaktionen auf die entstandenen ernsthaften Probleme kam es – wie so oft – erst spät.
Wie im Falle des Wassers. Erst im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts, als Seen und Flüsse allerorten bereits umgekippt waren, begannen hierzulande Politik wie Wirtschaft auf den öffentlichen Druck zu reagieren. Nun, im ersten Drittel unseres Jahrhunderts, wird sich Ähnliches abspielen. Dieses Mal geht es um die Informationsflüsse. Bei immer mehr Menschen macht sich immer stärker das Gefühl breit, dass es »reicht«: In gleichem Maße, wie verlässliche und relevante Information zum knappen Gut zu werden scheint, drängt sich uns ein Zuviel an unnötigem Informationsballast und diskursorischem Abfall auf – ein geistiger Giftmüll, der ungeklärt in die Kommunikationskanäle eingeleitet wird und dessen Entsorgung bislang weitgehend dem Einzelnen überlassen bleibt.
Aber: Es wächst das Bewusstsein dafür, dass verlässliche Information ein wertvolles öffentliches Gut darstellt, das entsprechend gemeinschaftlich eingefordert und gepflegt werden muss. Für dessen Erhalt wir alle gemeinsam die Verantwortung tragen.
Ein erheblicher Teil des Informationsmülls wird von der seit Jahrzehnten anschwellenden Flut derjenigen Botschaften verursacht, die Wirtschaftsunternehmen mit ihrem Marketing auf allen Kanälen »versenden«. Ihre Versprechungen und Ideen vom schönen Leben sollen unsere Aufmerksamkeit kapern und sie so auf die bunte Welt der Produkte und Dienstleistungen lenken. Eine ganze Reihe von Indizien spricht jedoch dafür, dass das bisher praktizierte Marketing mit seinen Strategien an ein Ende gekommen ist: Steigerungsorientierung und der Glaube an das rein quantitative Prinzip »Mehr nützt mehr« erzwingen einen verzweifelten Aufwand, dem ein abnehmender Grenznutzen von Werbung gegenübersteht. Gleichzeitig entwickeln die Konsumenten konsequent Abwehrstrategien, um den Zumutungen eben dieses Marketings zu entgehen.
So gesehen sind Markenkommunikation, Marketing und Werbung auch ein Bereich, auf dem sich auf exemplarische Weise beobachten lässt, welche Transformationen die sogenannte »Informationsgesellschaft« insgesamt durchmacht – und welche Chancen sich dabei ergeben.
Im Grunde verdanken die Menschen in marktliberalen Demokratien der Marketingindustrie eine gewisse Routine im Umgang mit Fake-Kommunikation. Denn wer tagtäglich mit allgegenwärtiger Werbung konfrontiert ist, muss damit umzugehen lernen, dass es lebensweltliche Bereiche gibt, in denen man ausschließlich und systematisch interessengeleitet informiert wird. Dabei geht es nicht so sehr um glatte Lügen: Fake-Marketing operiert – kaum subtiler – lieber durch Beschönigung, Übertreibung, Beschwörung, Verschwisterung, Flunkern und Verschweigen.
Lange Zeit wurde auch dieses Fake-Marketing als Teil des marktwirtschaftlichen Spiels hingenommen. Und vor allem gab es da immer auch einen Ausgleich durch einen alternativen, quasi unterirdischen Informationsfluss, der das Marketinggeschrei relativieren konnte: die reale Kommunikation von Konsumenten über Produkte, Marken und Märkte, in der immer schon andere, zusätzliche, erfahrungsbasierte Informationen verfügbar und insofern verlässlicher, glaubwürdiger, zumindest einschätzbarer waren.
Die Parallelität dieser Informationsströme – den des Marketings und den des Konsumentendiskurses – stützt eine der zentralen Thesen dieses Buches: Marken entstehen wesentlich als Ergebnis eines diskursiven Prozesses. Sie werden nicht vom Marketing, sondern von Konsumenten gemacht.
Internet und Digitalisierung haben auch hier wieder einiges geändert. Die Marketingstrategen sind darauf fixiert, uns mithilfe der neuen Medien noch besser beobachten, verfolgen und gezielter erreichen zu können – und erzeugen dabei im Effekt noch heftigere Abwehrreaktionen. Die andere Seite dieser Medaille: Der ehemals eher unterirdisch fließende Strom der Konsumentenkommunikationen tritt nun an die Oberfläche und verbreitert sich beträchtlich. Noch nie konnten sich Konsumenten besser gegenseitig beobachten, miteinander in Kontakt treten, untereinander austauschen als heute, noch nie waren sie unabhängiger von den Botschaften der Unternehmen und Markeninhaber. Mit ihrer »Macht«, selbst Marken zu machen, wächst auch ein neues Selbstbewusstsein der Konsumenten heran.
Die Entwicklung hin zum Post-Fake-Marketing hat schon begonnen. Was genau dabei alles entstehen wird, bleibt offen. Getragen aber wird sie sein von der Erkenntnis, dass Marken nicht in Vorstandsetagen und Agenturen gemacht werden können, dass sie zwar geführt, aber nicht gesteuert werden können. Die »Leadership« bei diesem Prozess liegt bei den Kunden und Konsumenten. Post-Fake-Marketing wird dialogischer und damit spannender, komplexer, anspruchsvoller und aufregender werden, als es das Fake-Marketing der Mad Men je war. Und es kann viele Beispiele dafür liefern, wie eine zukünftige Informationsgesellschaft aussehen kann, die mit »Fake« fertiggeworden ist.
Einleitung
Sie sind überall, sie umgeben uns permanent und wir entkommen ihnen nicht: Die Rede ist von Markenprodukten, Markenlogos, Markennamen. Marken prägen das Bild unserer Straßen und Plätze, leuchten noch in der Nacht von Hochhausdächern auf uns herab und füllen als Text und Bild sämtliche unserer Medien. Sie sind nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Diese Allgegenwart, die wir heute erleben, ist ein historisch gesehen relativ junges Phänomen: Im Jahr 1875 wurden die gekreuzten Schwerter der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen registriert. Sie gelten als ältestes offizielles Markenlogo hierzulande – das noch ganz dezent an der Unterseite der Produkte platziert wurde.
Heute drängen die Marken mit ihren Zeichen ganz nach vorne. Es hat den Eindruck, als versuchten sie, noch jede erdenkliche Oberfläche zu besetzen. Ein Versuch, der nicht ohne Erfolg bleibt: Scheint es doch vielen Konsumenten völlig normal zu sein, als lebende Litfaßsäulen durch die Straßen unserer Städte zu laufen. Auf dem T-Shirt prangt unübersehbar CK, ebenso auffällig das D&C im Bügel der Sonnenbrille. In der einen Hand die Tüte von – uuups – Zara, in der anderen das Smartphone mit dem perfekt designten Apfel. Unter der Masse von »Markenträgern« fallen heute diejenigen auf, die sich den ostentativen Verzicht auf einen »gebrandeten« Auftritt leisten.
Die Massivität und Intensität, mit der Marken heute auf sich aufmerksam machen, hat exponentiell zugenommen. Seit Mitte der 1960er-Jahre hat sich die Anzahl der Werbereize und -botschaften, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, auf geschätzt 14 000 täglich versiebenfacht. Die globalen Ausgaben der Unternehmen dafür steigen Jahr für Jahr und liegen derzeit bei ungefähr 500 Milliarden US-Dollar jährlich. Demgegenüber wirken die Zeiten der Mad Men, in denen die Werbebranche in den USA eine goldene Ära durchlebte, geradezu beschaulich. Der immer höhere Aufwand, den Werbung derzeit betreiben muss, um noch aufzufallen und Erfolge zu erzielen, ist nicht zuletzt ein gutes Indiz dafür, dass es bei aller marketingtechnischen Aufrüstung eher schwieriger geworden ist, die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Gerade weil Markenbotschaften und Markenzeichen so ubiquitär und omnipräsent sind, tut sich die einzelne Marke immer schwerer, überhaupt durchzudringen.
Allein in Deutschland dürften derzeit ungefähr 800 000 Marken eingetragen sein. Wenn, wie Schätzungen sagen, vom Durchschnittsdeutschen 50 000 Wörter umstandslos verstanden werden, dann folgt daraus, dass der Löwenanteil der existierenden Marken allgemein unbekannt bleibt und kein Wissen über Produkte und Firmen damit verbunden wird. Die allgemeine Auffassung von dem, was eine Marke ist, wird beherrscht von einer Gruppe populärer, sogenannter starker Marken. Das sind diejenigen, die in nahezu jedem Haushalt zu finden sind, die das Straßenbild prägen, deren Spots über die Bildschirme flimmern, die die Anzeigenseiten dominieren, in den Regalen der Supermärkte auf Augenhöhe stehen und die besten Plätze besetzen. Vor den Flagshipstores der großen Marken versammeln sich die Fans, und wenn Apple ein neues Produkt lanciert, kampiert die Anhängerschaft vor der Ladentür, um als Erste das neue iPhone ihr eigen nennen zu dürfen. Eine so hingebungsvolle Begeisterung wurde noch vor wenigen Jahrzehnten höchstens Rockstars und Popikonen zuteil.
»Markenwahn« wird vor allem den Jugendlichen gern attestiert. Wer auf dem Schulhof keine oder – schlimmer noch – die falschen Marken zur Schau stelle, werde gemobbt. Dabei lässt sich gerade an Jugendkulturen beobachten, wie differenziert und interessant der Umgang mit dem Phänomen Marke mittlerweile geworden ist und wie vielfältig die kommunikativen Funktionen sind. Jugendmarken können scheinbar aus dem Nichts populär werden und ebenso rasant wieder von der Bildfläche verschwinden. Abercrombie & Fitch mit den hippen Läden, in die die Klientel von halb nackten, durchtrainierten Teenies gelotst wurde, um die ebenso unverschämt teuren wie kultigen Teile zu erwerben, stürzte 2015 so schnell und so tief, dass danach nur noch die Wandlung zur Günstigmarke zu bleiben schien.
Während die amerikanische Modemarke in Werbung und Marketing scharf auf die unter 30-Jährigen gezielt hatte und nach dem kurzfristigen Erfolg feststellen musste, dass Markentreue nicht zu den Stärken dieser Zielgruppe gehört, kommen andere Marken bei Jugendlichen zum Erfolg, ohne zu wissen, wie ihnen geschieht: Irgendein Accessoire oder ein neuer Stil, den popkulturelle Vorbilder, aber eben auch Altersgenossen auf Instagram oder YouTube vorzeigen, kann zu einem mehr oder weniger kurzfristigen Hype führen.
Diese spontane Entstehung von Kultmarken in Jugendkulturen zeigt, dass Marken als populäre Zeichen und Phänomene sozialer Kommunikation nicht notwendig durch Werbung »gemacht« werden müssen. In vielen Fällen entstehen sie eben durch die Kommunikation von (Sub-)Kulturen. Mit anderen Worten: Wir selbst als Kunden, Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger haben das Potenzial, Marken zu »machen« – ein Phänomen, das uns im weiteren Verlauf dieses Buches noch eingehender beschäftigen wird.
Die Sprache der Marken
Marken erfüllen für Jugendliche einerseits die Funktion, sich insgesamt von den älteren Generationen abzuheben, andererseits aber auch, Differenz innerhalb der eigenen Altersklasse zu signalisieren: Marken zeigen also Zugehörigkeit, Abgrenzung und manchmal eben auch Ausgrenzung an. Deutlicher noch als in der Erwachsenenwelt wird hier ihre Funktion als Zeichen in der Kommunikation. Dass die Verwendung von Markenzeichen unter Jugendlichen sozial strenger gehandhabt wird, die sozialen Folgen der Missachtung von Codes und Regeln härter sind und die Wechselfrequenz höher ist, hat damit zu tun, dass sie sich im Prozess der Identitätsfindung und Erprobung von Rollenmodellen befinden – und nicht unbedingt damit, dass sie empfänglich für eine mentale Erkrankung namens Markenwahn sind. Wenn Psychologen so eine Krankheit erfinden, zeugt dies eher davon, wie wenig sie die Tatsache reflektieren, dass auch sie – wie wir alle – Teil einer Kultur sind, in der soziale Kommunikation in hohem Maße über die Verwendung von Markenzeichen stattfindet, ganz gleich, ob der Einzelne das nun will oder nicht.
Markenzeichen bilden also eine Art Sprache, die zusammen mit anderen Codes dazu benutzt wird, soziale Identität zu konstruieren, zu variieren und anderen zu signalisieren, wer man ist – oder genauer: was man anderen gegenüber darstellen möchte. Nicht nur für Jugendliche gilt, dass im Repertoire sozialer Zeichen das Präsentieren von Markenprodukten und Markenzeichen immer auch ein Mittel ist, soziale Differenzen, Zugehörigkeiten und Abgrenzungen zu demonstrieren. Das funktioniert, wenn die dafür benutzten Markenzeichen gut bekannt sind. Dann kann man davon ausgehen, dass festgelegte Botschaften, Haltungen, Bedeutungen mit dieser Marke assoziiert werden. Wer mit einem Mazda MX-5 Roadster vorfährt, legt es darauf an, für jugendlich, sportlich und unternehmungslustig gehalten zu werden, wer aus einem Dacia steigt, wird dagegen als pragmatisch, autonomiebestrebt und unangepasst eingeschätzt.
Nun findet man bei Automobilen nahezu keine Marke, die nicht mit entsprechenden Klischees aufgeladen ist, weil Autos durch die Bank massiv beworben werden. Aber in den meisten anderen Bereichen entdeckt man Nischenmarken, regionale, lokale Marken, über die anders und anderes kommuniziert werden kann: Man demonstriert damit beispielsweise seine ökologische Orientierung, seine Unabhängigkeit, zeigt sich als Kenner, Lokalpatriot, Nostalgiker etc. Wer nicht zur Masse gehören will, wird andere Marken wählen als der Durchschnittskonsument. Und mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die aktiv auf der Suche nach Dingen sind, die überhaupt nicht gebrandet sind: handwerklich hergestellte Produkte, Selbstgemachtes, Vintage, No-Name-Waren. Und auch sie senden damit Botschaften wie Eigenständigkeit, Individualismus, Nichteinverständnis, alternative Haltung. Denn eines kann man gemäß Paul Watzlawicks Diktum auch auf diesem Gebiet nicht: Man kann auch durch die Wahl von Produkten nicht nicht kommunizieren.
Mit Markenzeichen verweisen wir auf Haltungen, Vorlieben, Zugehörigkeiten und Identitätskonstrukte, signalisieren – bewusst oder nicht bewusst – Differenz. Betrachtet man das Phänomen Marke unter dem Zeichenaspekt und im Hinblick auf soziale Kommunikation als eine Art Sprache, dann kann man die einzelne Marke als Wort auffassen, die Menge aller Markenzeichen als das Wörterbuch. Und genauso wenig, wie wir uns in Einzelwörtern, sondern in zusammenhängenden Sätze verständigen, »äußern« wir uns über einzelne Markenzeichen. Auch hier macht die Kombination im Ausdruck erst die Bedeutung aus. Und offenbar gibt es auch in dieser Sprache eine Art von Grammatik, also Regeln dafür, wie man die Zeichen so zu kombinieren hat, dass der hergestellte »Text« als sinnvoll, passend, verständlich interpretiert werden kann. Eine Frau im eleganten Kostüm und mit einer praktischen, aber aus bestem Leder gearbeiteten Umhängetasche – beides, Kostüm und Tasche, ohne sichtbares Logo – steigt aus einem Dacia Sandero. Diese Kombination werden wir völlig anders interpretieren als die einer Frau in Lederjacke von Armani mit Louis-Vuitton-Tasche, die aus einem BMW 5er steigt. Und je mehr wir über die von diesen beiden Frauen bevorzugten Produkte und Freizeitangebote erfahren – wo und was sie essen, einkaufen, rezipieren etc. –, desto mehr Hypothesen werden wir über ihre Persönlichkeit, ihre Haltung, ihre Identität bilden.
Die Sprache der Marken, wie wir sie heute vorfinden, ist ein Kulturphänomen der westlichen Gesellschaften seit den 1950er-Jahren und hat längst den Bereich der Warenwirtschaft verlassen, um zum eigenen sozialen Zeichensystem zu werden, das Orientierung gibt und einzuschätzen hilft, wer die anderen sind und welchen Platz im sozialen System sie einnehmen: Dabei ergänzt es nicht nur bestehende Zeichensysteme zur sozialen Orientierung und Unterscheidung, sondern ersetzt sie sogar größtenteils. Denn viele der traditionellen sozialen Codes sind im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehr und mehr erodiert. Die Art der Kleidung, des Auftretens, des Benehmens und der Schicklichkeit, die Art zu reden und zu schweigen gaben Aufschluss über soziale Zugehörigkeiten, ebenso wie der Konsum von Speisen, Vergnügungen, Bildungsgütern, die Angemessenheit des gesamten Habitus. All diese »feinen Unterschiede«, die Pierre Bourdieu als soziosemiotische Systeme für das Frankreich der 1960er- und 1970er-Jahre rekonstruiert hat, sorgten in früheren Jahrhunderten dafür, dass man zeigen und erkennen konnte (aber auch musste!), wer jemand ist und wo jemand hingehört.1
Aus heutiger Sicht hat Bourdieu mit diesem Klassiker der Soziologie all jenen sozialen Regelsystemen auch ein Denkmal gesetzt, denn sie sind mittlerweile einer wesentlich fluideren, flüchtigeren Systematik gesellschaftlicher Kommunikation und Ordnung gewichen, deren Struktur und Grenzen heute nicht mehr auf die gleiche Weise beschrieben werden könnten.
Die wachsende Ungleichheit zwischen der kleinen Schicht Vermögender und der breiten Masse, aber auch das stetige Schrumpfen eines gemeinsamen Fundus an kulturellem Wissen und damit auch an diskussions- und konsensfähigen Vorstellungen über eine wünschenswerte Entwicklung des Gemeinwesens sind Indizien dafür, dass sich in unserer Gesellschaft subkutan Ordnungen und Spaltungen abzeichnen, die härter sind, als es das Schauspiel vermuten lässt, das wir an der Oberfläche der Alltagskultur beobachten können. Selbstverständlich gibt es ihn noch, den von Bourdieu so genannten Habitus, der das Paradigma der zeichenhaften Verhaltensweisen, Ausstattungsmerkmale und Auswahlkriterien bezeichnet, der signifikant und typisch für soziale Schichten und damit für Inklusion oder Abgrenzung ist. Aber heute kann auch der Oberstudienrat, Chefarzt, Bankangestellte oder Facharbeiter an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Gelegenheiten die Rolle, seinen gesamten Habitus wechseln. Multiple Identitäten simulieren oder leben zu können ist nicht nur möglich geworden, es ist fast schon zur Anforderung an soziale Kompetenz geworden. Der Habitus ist nicht mehr der kommunikative Ausdruck der einen, fest gefügten sozialen Rolle, er tritt heute in der Mehrzahl auf, man wählt situationell in Entsprechung zu wechselnden Spielorten und Lebensphasen den passenden aus.
Wo die festen Soziolekte abhandengekommen sind und die Verlässlichkeit der Interpretation des Habitus fehlt, füllt auch die Sprache der Marken die Lücke. Mithilfe von Marken zu kommunizieren verschafft Freiheiten, eröffnet die Möglichkeit zu schnellen Rollenwechseln, erhöht die Adaptivität. Zugehörigkeit ist nicht mehr daran geknüpft, lebenslang an dieselbe Gruppe und deren Habitus gebunden zu sein. Zugehörigkeiten können wechseln, auch parallel existieren, und gleichzeitig ist es möglich, durch kombinatorisches Geschick bei alldem individuell zu bleiben.
Die Kehrseite dieser Freiheit ist die Zumutung, ständig zwischen diesen Optionen wählen zu müssen. Wir müssen nicht nur immer wieder neu entscheiden, wer wir nach außen hin sein, wohin wir gehören wollen und wohin nicht, wir müssen auch permanent entscheiden, mithilfe welcher Auswahl an Produkten und deren Botschaften wir unsere Position signalisieren wollen. Die Sprache der Marken ist höchst lebendig. Ständig kommen neue Produkte und damit Marken – und mit ihnen neue Optionen, sich auszudrücken – hinzu, andere verschwinden, wieder andere verändern im Laufe der Zeit ihre Bedeutung. War der Trainingsanzug mit den drei Streifen einst die Sportbekleidung von Altherrenfußballern und Dienstuniform des biederen Nationaltrainers Helmut Schön, wurde adidas mit der Entdeckung durch goldkettenbehangene Gangsta-Rapper zum Streetwear-Kult.
Da wir alle durch die Kombination von Marken, durch ihre Nutzung, durch unser Reden über Marken, durch gegenseitiges Beurteilen, Verurteilen oder Bewundern unserer Markenstile zur ständigen Transformation der Markensprache beitragen, müssen wir uns auch permanent über deren Entwicklung auf dem Laufenden halten. Eine solche »Markensprachkompetenz« muss also nicht nur erworben, sondern auch immer wieder aufgefrischt werden.
Die Sprache der Marken spielt eine beachtliche Rolle in unseren Alltagskommunikationen: Was zu uns passt, was uns steht, was geht und was gar nicht geht, was unmöglich ist, was uns hilft, begeistert, glücklich macht, gut für uns ist und »woran man gleich sieht, dass …«, all das beschäftigt uns in Alltagsgesprächen. Produkte und Dienstleistungen sind in einer Kultur, die Waren im Überfluss produziert und anbietet, fester Bestandteil von Alltagsdiskursen. Es gibt kaum eine Thematik, an die sich nicht Problemlösungen – aber auch Problemursachen – in Gestalt warenförmiger Angebote anschließen ließen. Ganz gleich, ob es um Gesundheit oder Genuss, um Geld oder Ökologie, Ernährung oder Schönheit, Sex oder Sicherheit geht: Es gibt immer passende Produkte und Dienstleistungen. Und es gibt die entsprechenden Erfahrungen, Erlebnisse und Bewertungen der Gesprächsteilnehmer. Dass Markennamen dabei eine kaum zu überschätzende praktische Funktion erfüllen, liegt auf der Hand: Man stelle sich vor, man müsste all diese Waren umständlich beschreiben. Es ist der permanente Austausch von Erfahrungen mit allem, was an sachlichen und emotionalen Urteilen damit verbunden ist, der die Bedeutung der Markennamen wesentlich mit prägt: Wir plappern eben nicht einfach brav nach, was die Werbung über eine Marke sagt, sondern geben unsere eigenen Eindrücke und Werturteile wieder.
Dieser Aspekt wird von der Mehrheit der Marketingprofis immer noch unterschätzt: Viel zu verliebt sind sie in die Idee, dass es ihre Werbung und ihre Maßnahmen sind, die die Marke machen. Tatsächlich sind Markenbedeutungen das Produkt sozialer Kommunikationen und Austauschprozesse und entstehen allein durch ihre Präsenz in solchen Alltagsdiskursen, in denen sie stark werden können.
Marken brauchen keine Werbung
Die großen und starken Marken kennen wir aus der Werbung: Sie nehmen die Plakatflächen ein, die Anzeigenseiten der Printmedien, zerstückeln mit ihren Werbespots das TV-Programm, zögern den Beginn von Kinofilmen hinaus und ploppen auf unseren Computerbildschirmen auf. Intuitiv denken daher viele von uns, dass es einen notwendigen Zusammenhang zwischen dieser Art von Werbung und dem Entstehen von Marken gibt. Dabei sind tatsächlich die meisten Marken, denen wir vertrauen und die wir mögen, auf ganz andere Weise in unser Leben getreten: durch Empfehlung von Verkäufern oder Freunden, durch schöne Zufälle, aktive Recherche, Beobachtung anderer. Klar ist, dass fast immer irgendeine Art von Marketing stattgefunden haben muss, damit diese Ware überhaupt zu uns gelangen konnte. Um aber Marke zu sein, muss ein Angebot jedenfalls nicht notwendig beworben werden. Auch muss es nicht notwendig global bekannt und verfügbar sein. Das, was Marken ausmacht, ist skalierbar und in unterschiedlichen Maßstäben gültig. Wie groß und mächtig eine Marke ist, hängt unter anderem auch davon ab, welche Strategie und welche Ziele ein Anbieter verfolgt. In vielen Bereichen sind es gerade die besten Marken, die nicht unbedingt unbegrenzt wachsen wollen.
Die Steigerungsraten bei Werbereizen und Werbezeiten sind so enorm, dass der Peak bald erreicht sein wird – wenn er nicht bereits überschritten ist. Die Gegenreaktionen jedenfalls sind vielfältig und die Abneigung gegen Werbung steigt. Auch in Werbeagenturen werden Adblocker benutzt, um in Ruhe arbeiten zu können. Dass Werbung mehr und mehr in Ungnade fällt, liegt auch an der Art und Weise, wie sie vielfach kommuniziert, an den Versprechungen, die sie uns macht, und häufig genug auch daran, dass sie unsere Intelligenz beleidigt. Unternehmen scheinen noch gar nicht begriffen zu haben, dass sie mit Werbung für etwas bezahlen, was ihnen unter Umständen nicht nur nichts nützt, sondern mittelfristig sogar schaden kann. Auch da sind es weniger die einzelnen Marken, die leiden, als ganze Branchen: Gerade dort, wo exzessiv geworben wird, wie etwa im Automobilbereich, sagen immer mehr, vor allem jüngere Kunden, dass ihnen Marken gleichgültig werden.
Es gibt keinen rationalen Grund für die Behauptung, dass Marken Werbung brauchen. Ebenso wenig gibt es einen rationalen Grund für die Überzeugung, dass Marktwirtschaft ohne diese Art von Werbung nicht auskommen kann. Als Beleg reicht ein Blick zurück in die Historie: Marktwirtschaften florieren seit Jahrhunderten, massenmedial verbreitete Werbeversprechungen sind gemessen daran ein sehr junges Phänomen. Aber auch ohne den Blick zurück in die Geschichte lässt sich beobachten, wie Marktwirtschaft erfolgreich ohne klassische Werbung funktioniert. Wenn Unternehmen untereinander ins Geschäft kommen, dann sieht das Marketing auf einmal ganz anders aus. Im sogenannten B2B-Bereich nämlich setzen die Marken auf Information, Kundenpflege, Service, Erklärung der Produktvorteile. Hier bedeutet Markenpolitik Aufbau und intensivste Pflege eines rational überprüfbaren Markenversprechens, dessen Einhaltung essenziell und existenziell ist.
Wenn es dagegen um den privaten Konsum und uns Verbraucher geht, dann zielt Werbung auf Emotion, auf Wunschbilder, Träume und Triebe. Man unterstellt uns, dass wir gerne beschummelt werden, ja sogar mit vollem Einverständnis betrogen werden wollen: Automobile, die immer größer und schneller werden, dabei immer weniger verbrauchen und kaum mehr Schadstoffe ausstoßen? Nahrungsmittel, die schmecken wie aus Omas Sonntagsküche, mit besten Zutaten aus Wald und Wiese, nahezu fettfrei und gesund? Modische Klamotten, chemiefrei und von glücklichen Näherinnen hergestellt, quasi Entwicklungshilfe und trotzdem zum Schnäppchenpreis? Keine Frage: Das alles hat über Jahrzehnte hinweg gut funktioniert. Und die Konsumentenschaft in toto kann von der Verantwortung dafür, wie die Werbung – und damit die Unternehmen – mit ihr umgeht, nicht freigesprochen werden.
Aber der Wind beginnt sich zu drehen. Die hektischen Debatten in der Werbebranche darüber, mit welchen Mitteln den Konsumenten heutzutage noch beizukommen sei, sind ein deutliches Indiz für den beginnenden Wandel. Jetzt schon ist klar, dass immer mehr Aufwand betrieben werden muss, um auch nur annähernd noch die gewohnten Effekte zu erzielen. Mündige Verbraucher finden Marken, die anders agieren – und anders sind. Marken, die nachprüfbare Versprechen abgeben und auch halten. Marken im Nahbereich ihres Lebens, Marken, die auch beobachtet werden können.
Die Abwendung von Werbung bedeutet also keinesfalls automatisch eine Abwendung von Marken. Sie sind in unserer Kultur nicht nur hilfreiche Zeichen in der Alltagskommunikation, sie sind auch unverzichtbar für unsere Orientierung auf den Märkten. Marken sind schlicht praktisch. Denn sie helfen den Konsumenten, die ansonsten kaum zu bewältigende Komplexität der Angebotswelt zu beherrschen.
Dass Markenentwicklung und Markenführung die Mittel sind, um am Markt zu reüssieren und Produkte erfolgreich zu machen, wird in der Wirtschaft als selbstverständlich angesehen. Bisher werden aber meist die enormen Potenziale der Innenwirkung von Marken unterschätzt: Nach meiner Überzeugung ist gerade ein starkes, klares Markenbewusstsein ein vielseitiges Instrument für Unternehmer und Manager, um ihre Organisation zu führen, ihre Identität aufzubauen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
1 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Frankfurt am Main 1987.