

INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch

ÜBER DIE AUTORIN
Andrea Gerk arbeitet als Autorin und Moderatorin für öffentlich-rechtliche Radiosender und hat 2015 das Buch Lesen als Medizin bei Rogner & Bernhard veröffentlicht. Sie hat viele Jahre in Wien verbracht und lebt in Berlin, was sie als Expertin für schlechte Laune besonders qualifiziert.
ÜBER DAS BUCH
Ohne schlechte Laune wäre das Leben halb so lustig. Sie ist die Grundtemperatur umtriebiger Schnelldenker, Inspirationsquelle für Künstler und Alltagsphilosophen, geistige Nahrung für Melancholiker und Romantiker. Ohne sie wäre das Leben ein Einerlei aus Langeweile und Stillstand. Denn ein zufriedener Mensch denkt nicht, sondern liegt in der Hängematte und genießt sein Glück. Gäbe es keine schlechte Laune, hätten wir keinen Schopenhauer, keinen Thomas Bernhard, keinen Dagobert Duck und keine Komödien mit Jack Nicholson.
»Jeder Mensch hat ein Recht auf schlechte Laune. Man sollte das in die Verfassung aufnehmen.«
Georges Simenon
»Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist.«
Ödön von Horváth
»Das Leben hat an und für sich nur lauter Nachteile.«
Thomas Bernhard
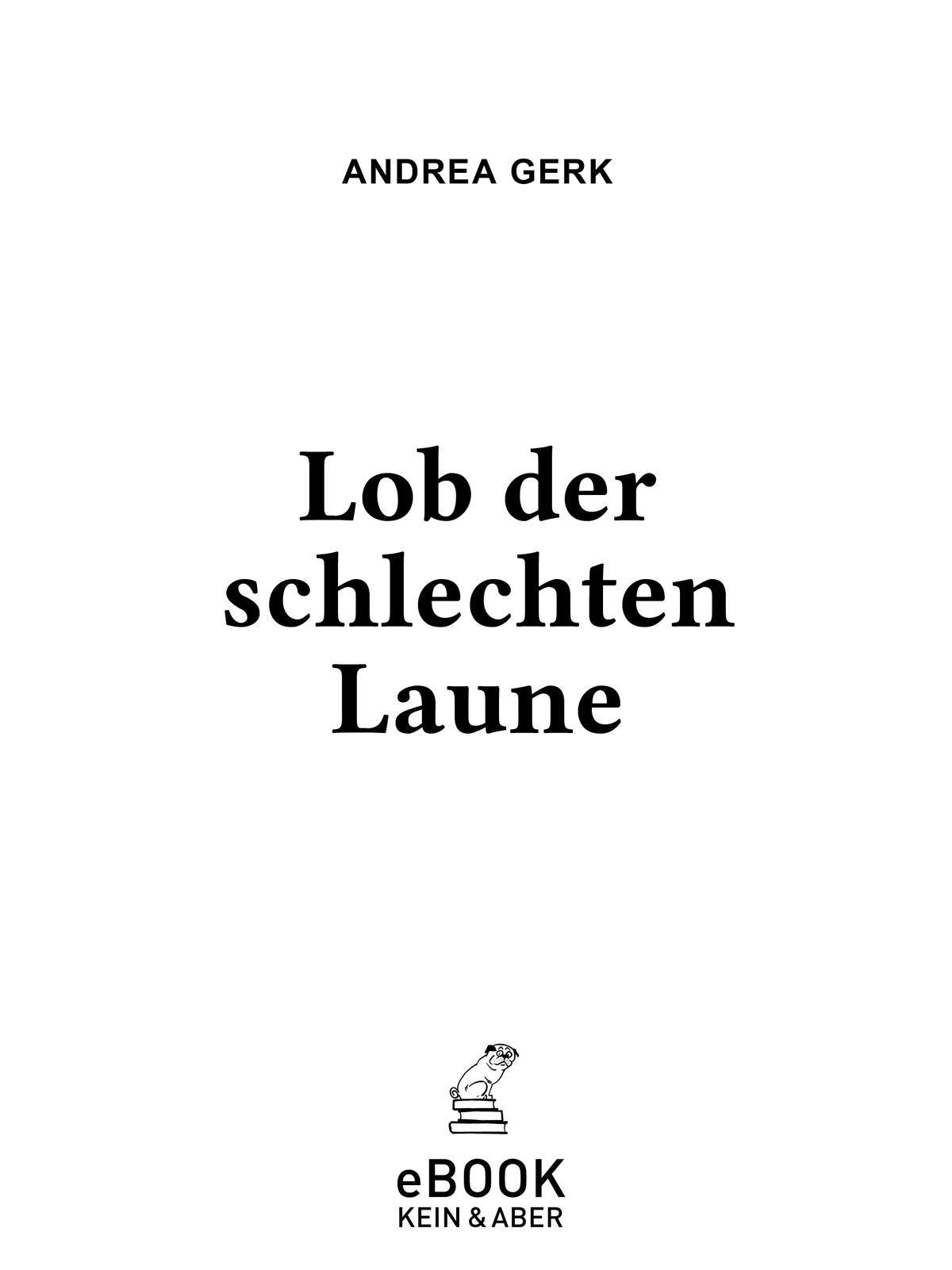
»Und von mir aus kannst du so mürrisch sein, wie du willst.
Auch das hat seinen Wert.«
KARL OVE KNAUSGÅRD: KÄMPFEN
»Guten Morgen, I-Ah«, sagte Pu.
»Guten Morgen, Pu Bär«, sagte I-Ah düster.
»Falls es ein guter Morgen ist«, sagte er. »Was ich bezweifle«, sagte er.
»Warum, was ist denn los?«
»Nichts, Pu Bär, nichts. Nicht jeder kann es, und mancher lässt es ganz. Das ist der ganze Witz.«
»Nicht jeder kann was?«, sagte Pu und rieb sich die Nase.
»Frohsinn, Gesang und Tanz. Ringel Ringel Rosen.
Darf ich bitten, mein Fräulein.«
»Aha!«, sagte Pu.
A.A. MILNE: PU DER BÄR
1. Knurrigkeit statt Zwangsoptimismus
»Jeder Mensch hat ein Recht auf schlechte Laune.
Man sollte das in die Verfassung aufnehmen.«
GEORGES SIMENON
Die letzten Sommerferien unserer Schulzeit verbrachten meine Freundin Eva und ich in der Gaststätte eines Badesees, um das Geld für unseren ersten elternfreien Urlaub zu verdienen. Während alle anderen ausschliefen, fuhren wir jeden Morgen auf unseren Mofas an den See, stopften die Haare unter hygienisch einwandfreie Kopftücher und gingen ans Werk. Eine half in der Küche, Hunderte von Schnitzeln zu panieren, die andere stand in dem zur Wirtschaft gehörenden Kiosk hinter der Theke. Am nächsten Tag wurde gewechselt.
Dieser Kiosk, in dem Badegäste und Campingplatzbewohner Süßigkeiten, kalte Getränke, einzelne Klopapierrollen und sonntagmorgens auch frische Brötchen kaufen konnten, war eine Art Gravitationszentrum negativer Energien. Hier entlud sich alles, was ansonsten, weil ja Ferien waren, unterdrückt werden musste. Womöglich bildeten sich auch wegen des kathartischen Potenzials dieses Ortes regelmäßig lange Schlangen vor dem kleinen Häuschen.
Welche Dramen sich unter den Wartenden abspielten, bekamen wir meist nur am Rande mit oder bei Totaleskalation, wenn es zu Handgreiflichkeiten kam.
Aber auch drinnen war in dieser Hinsicht genug los. Bestellte einer der Badehosenträger ein Bier, galt es etwa zehn Meter in den hinteren Teil des Kiosks zu gehen, die Flasche aus dem Kühlschrank zu nehmen und wieder zurückzulaufen. Kaum war das erledigt und kassiert, verlangte der Nächste ebenfalls ein Bier, und das Ganze wiederholte sich. Orderte nun ein bis dahin versteckter Dritter noch mal das Gleiche, begann es unter unseren blütenweißen Kopftüchern zu köcheln. Die Flasche knallte auf die Durchreiche, die Männer lachten, wir fauchten: »Könnt ihr nächstes Mal gleich zusammen bestellen?!«, was sie mit beschwichtigenden Grunzlauten quittierten. Manche äußerten ihre Wünsche auch absichtlich nacheinander und amüsierten sich über unseren anschwellenden Ärger.
Der Sommerkiosk war ein Zentrum schlechter Laune, die sich wellenartig hochschaukelte und zuweilen in wüsten Beschimpfungen und Unmutsbekundungen entlud. War diesbezüglich alles gesagt, gab man sich wieder seinen Urlaubsgefühlen hin, als wäre nichts gewesen. Was genau genommen ja stimmte. Auch wir fanden es nicht weiter schlimm, unsere Tage in diesem Missmutsinferno zuzubringen. Gut gelaunt waren wir nach Feierabend, und zwar ziemlich gut, schließlich hatten wir unseren Ärger bereits an den Badegästen ausgelassen. Die saßen nun ebenfalls entspannt vor ihren Zelten oder Wohnwagen, grillten Würstchen und waren froh, ihren latenten Groll bei uns losgeworden zu sein. Ohne etwas dicke Luft zwischendurch wären die penetrant schönen Sommertage unerträglich langweilig gewesen.
Damals, als die politischen Blöcke noch klar erkennbar waren, man mit der Jugendgruppe zur Friedensdemo nach Bonn fuhr und die Eltern Franz Josef Strauß wählten, schien niemand schlechte Laune besonders schlimm oder überhaupt bemerkenswert zu finden. Man nahm sie hin wie den institutionalisierten Frohsinn im »Komödienstadl«, »Ohnsorg-Theater« oder im heimischen Partykeller und war dankbar, dass es Orte gab, an denen sie gut aufgehoben war wie am Badesee, im Bierzelt, am Stammtisch, bei der Arbeit oder im Kreis der Familie.
»Die Väter, Gastwirte, Lehrer, Handwerker und Landwirte, waren in dieser Zeit brummelige schweigsame Männer, die immer arbeiteten und kaum Verständnis für die Konsum- und Freizeitwünsche ihrer Kinder zeigten. Sie ›bruddelten‹ eigentlich nur den ganzen Tag, das heißt, sie schimpften ständig schlecht gelaunt vor sich hin, das Beste war, man ging ihnen so gut wie möglich aus dem Weg«, erinnert sich die Musikerin Christiane Rösinger in ihrem autobiografischen Buch Das schöne Leben. Womöglich war Fernsehvater Alfred Tetzlaff alias Ekel Alfred deshalb so erfolgreich, weil sich die halbe Nation darüber amüsierte, einen Doppelgänger ihres Ehemanns, Vaters oder Kollegen auf dem Bildschirm herumnörgeln zu sehen, der noch dazu in größtmöglichem Kontrast zu Stimmungskanonen wie Heinz Schenk, Willy Millowitsch und Peter Alexander stand.
Schlechte Laune prägte aber nicht nur das Grundbefinden der männlichen Bevölkerung. Auch alte Leute, von der eigenen Lieblingsoma abgesehen, präsentierten sich vorwiegend als ungenießbare Murrköpfe. Zu jeder ordentlichen Dorfgemeinschaft gehörten dunkel gekleidete Figuren, die knorzige Krückstöcke schwangen und aus zahnlosen Mündern unverständliche Schimpftiraden krächzten, sobald sich Kinder ihren Häusern näherten. Sie erinnerten an die Struldbrugs, jene verbitterten unsterblichen Wesen, von denen Jonathan Swifths Gulliver auf seinen Reisen beim Volk der Luggnaggier hört: »Sie seien nicht nur halsstarrig, mürrisch, gierig, verdrießlich, eitel und geschwätzig, sondern keiner Freundschaft fähig und für alle natürliche Zuneigung tot, die niemals weiter reiche als bis zu ihren Enkeln. Neid und ohnmächtige Wünsche seien ihre vorherrschenden Leidenschaften. Die Dinge aber, auf die sich ihr Neid in der Hauptsache zu richten scheint, sind die Laster der Jüngeren und das Sterben der Alten.«1
Innerhalb der Familie war die Rolle des Griesgrams ebenfalls fest besetzt: Irgendein verwitweter Onkel oder eine unverheiratete Tante saß bei jeder Familienfeier mit verdrießlichem Gesicht dabei, sagte kaum etwas, und wenn, dann nur galliges Zeug. Es waren Furcht einflößende Wesen, deren eigentümliche Gemütsverfassung aber alle respektierten wie beim mürrischen Alm-Öhi aus dem Kinderbuchklassiker Heidi. Unvorstellbar, dass jemand versucht hätte, diese brummigen Gestalten aufzuheitern oder ihnen ihre schlechte Laune auszureden. Die meisten hatten einiges mitgemacht, und da sie außer Langeweile, Siechtum und Tod nicht mehr viel vor sich hatten, auch allen Grund, schlecht gelaunt zu sein.
Heute kann man kaum noch in Ruhe schlecht gelaunt sein, für jede Stimmungsflaute muss man sich rechtfertigen, und die knurrigen Gesinnungsgenossen von früher trifft man fast nur noch in Film und Literatur. Das Alter ist zu einer Art zweiten Jugendzeit geworden, bevölkert von bunt gekleideten Senioren, die vor Unternehmungslust strotzen. Väter »bruddeln« nicht mehr, sondern buddeln emphatisch mit ihren Kindern im Sand, Verkäufer begrüßen einen nach amerikanischer Art überschwänglich wie einen alten Freund. Wer schwer erkrankt, soll darin eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung sehen, und schnappt einem jemand den Parkplatz vor der Nase weg, soll man ihm noch dazu gratulieren.
»Wir leben in der Diktatur der Positivität«, schreibt Tobias Haberl in der Süddeutschen Zeitung. »Alles Dunkle soll hell, alles Gefährliche abgeschafft, alles Triebhafte reguliert, alles Melancholische heiter gemacht werden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts muss alles sympathisch und sonnig und gut gelaunt sein, jede Wohnung, jeder Moderator, jede Zeitschrift. […] Das Leben kommt mir vor wie eine viel zu gesunde Rhabarbersaft-Schorle, auf jeden Fall wie eine halbe Sache, weil irgendwie nur noch die eine, die positive Hälfte stattfinden darf.«2
Die andere schlecht gelaunte Hälfte passt nicht ins kollektive Wohlfühlprogramm und in einen auf ökonomische Effizienz und emotionale Reibungslosigkeit angelegten Alltag. Womit kein nostalgisches Loblied auf die gute alte Schlechte-Laune-Zeit angestimmt werden soll. Gefühle und Stimmungen sind vergänglich, auch in der historischen Zeit. Empfindungen wie Scham, Ehre, Mitleid haben emotionale Konjunkturen, die viel über Gesellschaften und ihren Wandel aussagen, so die Historikerin und Emotionsforscherin Ute Frevert.3 Was also bedeutet es, wenn wir allzeit gut drauf sein sollen, stets mit uns im Reinen, ausgeglichen und zufrieden? Welches Menschenbild steckt dahinter, wenn in den USA, wo der pursuit of happiness, das Streben nach Glück sogar in der Verfassung verankert ist, Leuten wegen ihrer angeblich negativen Arbeitseinstellung gekündigt werden kann und Motivationstrainer predigen, sich von komplizierten Personen möglichst rasch zu verabschieden, um keine Zeit mit Negativem zu verschwenden? Natürlich ohne dazuzusagen, wo pubertierende Kinder oder störrische Alte nach so einer beherzten Trennung eigentlich hinsollen. Auch in den sozialen Netzwerken soll der Daumen nur nach oben zeigen. Als Facebook-User vor einigen Jahren massenweise einen »Dislike«-Button forderten, erklärte Mark Zuckerberg, man wolle Miesepetern keine Plattform bieten.4
Ähnlich wie Heimweh, Sehnsucht oder Langeweile ist schlechte Laune zu einer altmodischen Angelegenheit für komische Kauze, Ewiggestrige und unbelehrbare Sturköpfe geworden, die sich den Bekehrungsversuchen der Wohlfühlideologen verweigern. Und ist das nicht auch gut so?
Sollen die Griesgrame und Stinkstiefel in ihren düsteren Kämmerchen miesepetrig sein, während alle anderen in das Gute-Laune-Mantra »Jede Zelle meines Körpers ist glücklich« einstimmen und nur sich selbst und ihren Mangel an positiver Lebenseinstellung dafür verantwortlich machen, wenn etwas schiefgeht. Weshalb soll man sich für einen so unzeitgemäßen und zwiespältigen Gemütszustand interessieren, dessen Ausdrucksformen eher unangenehm sind, der hochgradig ansteckend und doch zu flüchtig und diffus ist, um Mentalitätsforscher, Kulturhistoriker oder Therapeuten für sich einzunehmen? Nicht mal Wikipedia interessiert sich für das Stichwort »schlechte Laune«.
Weil sich das, was wir leichtfertig als schlechte Laune abtun, bei genauerer Betrachtung als wahre Wundertüte erweist. Zügellos und anarchisch, wie sie ist, kann sie ein massives Schutzschild gegen leere Glücksversprechen sein, die alle Verantwortung dem Einzelnen zuschieben, ohne die Gesellschaft oder den Zufall noch als Verursacher in Betracht zu ziehen. Schlechte Laune kann eine Form von emotionalem Widerstand sein, ein Aufbegehren gegen die vermeintliche Kalkulierbarkeit unserer Psyche: Als unkontrollierte, unangemessene Reaktion kann sie zum fruchtbaren Störfall werden, der einer durchrationalisierten Gesellschaft, in der Algorithmen das Gefühlsleben berechnen, Apps wie »I Feel« emotionale Botschaften standardisieren und eine Wellnessideologie für die Steigerung des persönlichen Marktwerts sorgt, ganz guttut.
Im besten Fall kann schlechte Laune eine Form produktiver Kritik an der Arbeitswelt, der Familie, den (emotionalen) Zumutungen der modernen Konsumwelt sein. Auch wenn sie nicht sofort praktikable Alternativen mitliefert oder auf die Verwirklichung einer konkreten Utopie abzielt, sondern eher mit leisem Grummeln am Bestehenden rüttelt wie ein sanftes Beben.
Wischt man diese Stimmung einmal nicht wie Staub vom Tisch, entfaltet sie einen ungeahnten Zauber. Auch Staub hat einen miserablen Ruf. Er ist lästig, löst allergische Reaktionen aus und kann, falls er radioaktiv, quarz- oder asbesthaltig ist, schwere Krankheiten verursachen. Deshalb versucht die Menschheit erfolglos, die feinen Partikel per Verordnung in ihre Schranken zu weisen. Aber Staub ist stärker als jeder Lappen, und er wird noch durch die Stratosphäre schweben, wenn sich auf der Erde längst nichts mehr tut. Genau wie schlechte Laune, die ausnahmslos jeden überkommen kann, mag er sein Gemüt noch so eifrig auf Hochglanz polieren.
Ohnehin bedarf es nur einer minimalen Verschiebung der Perspektive, um in diesen so unscheinbaren wie omnipräsenten Phänomenen nicht nur anarchische Widerstandskraft, sondern auch Schönheit, kreatives Potenzial und einen hohen Unterhaltungswert zu entdecken.
Der britische Künstler Paul Hazelton verarbeitet flüchtige Stoffe, die menschliche Lebewesen absondern, wie Haare, Dreck, Staub, und fertigt daraus filigrane Skulpturen. Sein texanischer Kollege Scott Wade verwirklicht sich als »Dirty Car Artist«, indem er Meisterwerke wie Leonardo da Vincis Mona Lisa oder auch ein Porträt von Albert Einstein in die verstaubten Heckscheiben schmutziger Autos zeichnet. Die monochrom anmutenden Aquarelle des Italieners Luca Vitone verdanken ihre gedeckte Farbigkeit dem Inhalt von Staubsaugerbeuteln aus Institutionen wie dem Bundestag oder der Bundesbank, und der schwäbische Bildhauer Wolfgang Laib wurde 2015 für seine leuchtenden Blütenstaubelegien mit dem Nobelpreis der Künste, dem Praemium Imperiale ausgezeichnet. Es gibt sogar zwei Staubsammler, die sich seit Jahren darum streiten, wessen Kollektion die einzig wahre ist.
Staub beflügelt aber nicht nur Künstler und Sammler, sondern auch die Natur. Den rötlichen Abendhimmel, den so viele Dichter besungen haben, verursachen Staubpartikel in der Atmosphäre, die dafür sorgen, dass hauptsächlich rote Lichtanteile bis zur Erde durchdringen. Meist unsichtbare Mikroteilchen werden Tausende von Kilometern über die Erde geweht, um Mineralstoffe zu transportieren, die auf anderen Kontinenten für die nötige Düngung sorgen. Dieser luftgetragene Staub ist eine Art fliegender Zoo voller Lebewesen, Keime und Pollen.
So gesehen, ist eine staubfreie Umgebung weder realistisch noch erstrebenswert. Genau wie ein Leben ohne schlechte Laune. Denn diesem energiegeladenen, unzeitgemäßen Gefühlsgemisch verdanken wir nicht nur die unterhaltsamsten Filmkomödien, Popsongs, Comics, Romane und Kinderbücher, sondern auch große Erfindungen, bahnbrechende Erkenntnisse und hin und wieder einen ordentlichen Adrenalinstoß, der uns im Alltagstrott wachrüttelt.
Als »Geisteshaltung«, wie Grumpy Cat, die millionenschwere Katze mit dem mürrischen Gesicht, ihren Zustand mal beschrieben hat, erhöht schlechte Laune nicht nur nachweislich die Aufmerksamkeit und verbessert das Denken, sie ist oft die einzig natürliche Reaktion auf die Fährnisse des Daseins. Oder um es mit Arthur Schopenhauer, dem Schutzpatron aller Übellaunigen, zu sagen: Es gibt kein geglücktes Leben, nur ein Leben, das stets daran gehindert wird, zu glücken. Allein deshalb schreiben wir dem gelungenen Moment eine so große Bedeutung zu. »Verweile doch, du bist so schön«, ruft man nur dann aus vollem Herzen, wenn einem bewusst ist, dass der Normalzustand eher trübe ist.
Eine gewisse Unstimmigkeit oder Unzufriedenheit ist noch dazu Voraussetzung, um überhaupt ins Grübeln, Reflektieren und Philosophieren zu kommen. Anders, als es der Mythos vom musengeküssten Genie will, ist kreative Arbeit nämlich ganz schön anstrengend und von schweren Schlechte-Laune-Anfällen durchsetzt. Wer gut drauf ist, schreibt keine Kritik der reinen Vernunft, sondern kauft sich ein Eis und legt sich in die Hängematte. Oder wie mir der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann sagte: »Wer sich freut, denkt nicht.«
Sicher sind knurrige Zeitgenossen besonders für ihr näheres Umfeld lästig und mühsam. Wird schlechte Laune chronisch, also habituell oder pathologisch, verliert sie ohnehin ihre Produktivkraft. Ein ständig schlecht gelaunter Mitmensch, der an nichts mehr Spaß hat, verdirbt auch allen anderen die Lebensfreude. Wohin das führen kann, berichtet der Mediziner Fritz Wiedemann in einem frühen Ratgeber, dem 1953 erschienenen Buch Müde Menschen. Heilung der Zeitkrankheiten Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, schlechte Laune: »Eine Frau muss sich erbrechen, wenn sie das mürrische Gesicht ihres Mannes sieht, ein Straßenbahnschaffner nimmt sich sogar das Leben, weil er das Genörgel seiner Frau nicht mehr erträgt.«5
So etwas mag es geben. Es kann aber auch ziemlich aufschlussreich sein, einfach mal nachzufragen, warum jemand so garstig auf einen reagiert. Mit etwas Glück erfährt man etwas Anregendes über sich oder dazu, wie man die Welt auch wahrnehmen kann.
Wobei es sich bei derartigen Extremformen von Missmut auch nicht wirklich um schlechte Laune handelt, sondern eher um eine ernsthafte Depression oder einen hoffnungslosen Fall. Auch ein Kellner, der seinen Gästen das Essen auf den Tisch knallt, anstatt höflich zu servieren, dürfte weniger unter schlechter Laune als am falschen Beruf leiden. Und gesellschaftliche Gruppierungen, die sich in ihrem Beleidigtsein zusammenrotten (siehe Pegida & Co) und allen anderen die Schuld an ihrer vermeintlichen Benachteiligung geben, schreien nur auf verquere Weise nach Aufmerksamkeit.
Derartige Motive sind der guten schlechten Laune vollkommen egal. Niemals würden sich ihre Exponenten in Gruppen oder einem Verein zusammenschließen, das widerspräche zutiefst der streng individualistischen Verfasstheit dieser Gemütslage.
Schlechte Laune lässt sich nicht mit anderen teilen, dazu ist sie auch viel zu flüchtig. Bis man im Vereinsheim angelangt wäre, hätte sich der ganze Verdruss längst in nichts aufgelöst. Abgesehen davon, hat man ja meist wegen anderer Menschen, ihren lästigen Angewohnheiten, unangenehmen Gerüchen und den quälenden Geräuschen, die sie produzieren, so eine miese Stimmung. Deren Funktion besteht dann wiederum darin, die Verursacher in einen erträglichen Abstand zu bringen.
»Schlechte Laune hat ein schlechtes Image, warum eigentlich? Mühelos sind damit andere auf Distanz zu halten«, twittert der Philosoph Wilhelm Schmid. Wer grummelig, miesepetrig, mürrisch oder verdrießlich ist, will seine Ruhe haben, vor anderen und nicht zuletzt vor sich selbst.
Schlechte Laune ist auch deshalb nicht zur Vereinsbildung geeignet, weil zwar alle wissen, was damit gemeint ist, aber jeder etwas anderes darunter versteht. Sie ist weniger ein klar definierbares Phänomen als ein dehnbarer Begriff, mit dem sich ein verwirrend breites Spektrum emotionaler Reaktionen fassen lässt: Den einen freut nichts, der andere ärgert sich über einen Fehler, ein Dritter bekommt schlechte Laune, weil er mit einem Projekt nicht vorankommt, sein Zimmer aufräumen soll, Stress auf der Arbeit oder Beziehungsprobleme hat. Und der Vierte weiß selbst nicht, was eigentlich mit ihm los ist. Stellt sich schlechte Laune derart grundlos, als milde Verzweiflung am Weltzustand ein, ähnelt sie ihrer viel beschriebenen Schwester, der Melancholie. Dann erzeugt sie zuweilen einen von milder Düsternis durchdrungenen Echoraum auf die Beschwernisse des Daseins, einen heimeligen Zustand der Fülle und Leere zugleich, der sehr erhellend und inspirierend sein kann. Genau wie die Langeweile, von der Walter Benjamin schrieb, sie sei »ein warmes graues Tuch, das innen mit dem glühendsten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns, wenn wir träumen.«6
In diesem Modus kann die schlechte Laune zum Traum der Wachen und unzufriedenen Schnelldenker, der besessenen (Lebens-)Künstler, innovativen Problemlöser und Alltagsanarchisten werden. Äußerlich mögen sie griesgrämig, kantig und grau wirken, doch in ihrem Inneren brennt nicht selten ein funkelndes Feuerwerk, wie man an chronischen Grantscherben wie Arthur Schopenhauer, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Thomas Bernhard, Lou Reed oder Helmut Schmidt sehen kann; aber auch an fiktiven Querköpfen wie Charlie Brown und Lucy van der Pelt, Privatdetektiv Simon Brenner und seiner Kollegin Bella Block, an Ekel Alfred, Dr. Gregory House oder Oscar the Grouch, dem zufrieden in seiner Mülltonne vor sich hin grummelnden Griesgram aus der Sesamstraße.
Neben der eher passiven Version schlechter Laune, die meist einen Hang ins Melancholische hat, gibt es auch die aktive Variante des sich permanent beklagenden, unzufriedenen Misanthropen. In der Literatur wird dieser Typus von Molières Alceste oder Thomas Bernhards Theatermacher Bruscon ebenso verkörpert wie von Shakespeares Bösewichtern Richard III., Shylock oder Iago, die von tiefem Groll getrieben sind. Anders als die sehnsüchtig-verstimmten Melancholiker in den Stücken Anton Tschechows oder deren antriebslos phlegmatischer Landsmann Oblomow.
Im Alltag kann sich die eher eruptive Form von schlechter Laune manchmal ziemlich gut anfühlen. Oder weshalb feiern Menschen Familienfeste und drängeln sich samstags freiwillig durch die Fußgängerzone? Überfüllte Kaufhäuser, der öffentliche Nahverkehr, die endlosen Staus zu Ferienbeginn und -ende und andere Brennpunkte des kollektiven Missmuts bieten ein latentes Reizklima, in dem es stimmungsmäßig schnell zur Sache geht. Und genau deshalb suchen alle diese Zentren der Übellaunigkeit auf.
Wenn der Ärger blitzschnell die neuronale Zündschnur hochbrennt, man einer mentalen Inkontinenz gleich nicht mehr an sich halten kann, weil eine geheimnisvolle Macht einem den Stecker zieht, ist auf einen Schlag alles, was unsere Mütter uns in mühevoller Kleinarbeit beigebracht haben, gelöscht, und ein ungezähmter Wilder schlägt das domestizierte Über-Ich k.o. Im besten Fall führt das zu literarisch hochwertigen Hasstiraden auf die »schamlose und unverbesserliche« Wirklichkeit, in die der österreichische Schriftsteller Werner Kofler seinen Zorn gegossen hat, man wirft mit Hausschuhen nach den Dienstboten wie Ludwig van Beethoven oder exekutiert Teekannen und Füllfedern wie Heimito von Doderer. Kurz, wir sind für einen wohltuenden Moment wieder da, wo wir alle herkommen: daheim im Neandertal.
Von dort, wo sich nach dem Gefühlssturm eine tiefe Ruhe ausbreitet, kann es wieder losgehen mit dem Erfinden, Dichten, Komponieren und den Alltag Organisieren. Denn das Schönste an der schlechten Laune ist, sagt meine zehnjährige Tochter, dass man nachher keine mehr hat. Zumindest erst mal.