Die Ladenhüterin
Roman
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
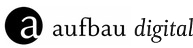
Sayaka Murata wurde 1979 in Chiba, Japan, geboren und arbeitet selbst in einem Konbini. Für ihre literarische Arbeit erhielt sie bereits mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Noma-Literaturpreis für Nachwuchsschriftsteller und den Mishima-Yukio-Preis. Ihr Roman »Die Ladenhüterin« gewann 2016 mit dem Akutagawa-Preis den renommiertesten Literaturpreis Japans.
Ursula Gräfe hat Japanologie, Anglistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main studiert. Seit 1989 arbeitet sie als Literaturübersetzerin aus dem Japanischen und Englischen und hat neben zahlreichen Werken Haruki Murakamis auch Autoren wie Yasushi Inoue und Hiromi Kawakami ins Deutsche übertragen.
»Absurd, komisch, klug, mutig und präzise. Einfach überwältigend.« Hiromi Kawakami
Die literarische Sensation aus Japan: Eine Außenseiterin findet als Angestellte eines 24-Stunden-Supermarktes ihre wahre Bestimmung. Beeindruckend leicht und elegant entfaltet Sayaka Murata das Panorama einer Gesellschaft, deren Werte und Normen unverrückbar scheinen. Ein Roman, der weit über die Grenzen Japans hinausweist.
Keiko Furukawa ist anders. Gefühle sind ihr fremd, das Verhalten ihrer Mitmenschen irritiert sie meist. Um nirgendwo anzuecken, bleibt sie für sich. Als sie jedoch auf dem Rückweg von der Uni auf einen neu eröffneten Supermarkt stößt, einen sogenannten Konbini, beschließt sie, dort als Ladenhilfe anzufangen. Man bringt ihr den richtigen Gesichtsausdruck, das richtige Lächeln, die richtige Art zu sprechen bei. Keikos Welt schrumpft endlich auf ein für sie erträgliches Maß zusammen, sie verschmilzt geradezu mit den Gepflogenheiten des Konbini. Doch dann fängt Shiraba dort an, ein zynischer junger Mann, der sich sämtlichen Regeln widersetzt. Keikos mühsam aufgebautes Lebenssystem gerät ins Wanken. Und ehe sie sichs versieht, hat sie ebendiesen Mann in ihrer Badewanne sitzen. Tag und Nacht.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Die Ladenhüterin
Roman
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
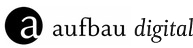
Inhaltsübersicht
Über Sayaka Murata
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Anmerkungen
Impressum
Leseprobe aus: Han Kang – Menschenwerk
Der Convenience Store ist voller Geräusche. Begleitet vom Glockenklang beim Eintreten der Kunden, preist ein Promisternchen über Lautsprecher neue Produkte an. Dazu kommen die Stimmen der Angestellten, das Piepen beim Einlesen der Strichcodes, der dumpfe Aufprall, mit dem Waren in Körbe plumpsen, das Klacken von Absätzen und das Knistern von Brottüten. All das verbindet sich zu dem einen typischen Konbini-Klang, den ich stets im Ohr habe.
Eine Plastikflasche wird aus dem Regal genommen, die darüberliegende rollt mit einem leisen Ton nach. Mein Körper reagiert beinahe automatisch auf dieses Geräusch, denn viele Kunden nehmen sich die kalten Getränke erst kurz bevor sie zur Kasse gehen. Ich drehe mich um. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass die Kundin, ihr Mineralwasser in der Hand, noch nach einem Dessert sucht und nicht sofort zur Kasse kommt, wende ich mich wieder ab.
Während ich aus den vielen Geräuschen meine Informationen ziehe, räume ich die gerade gelieferten Onigiri ins Regal. Die gewürzten Reisbällchen verkaufen sich, ebenso wie Sandwiches und Salate, um diese Zeit am Vormittag besonders gut. Mir gegenüber kontrolliert Frau Sugawara mit einem kleinen Scanner die Lieferung. Ordentlich sortiere ich die maschinell hygienisch verpackten Lebensmittel ins Regal. In die Mitte kommen zwei Reihen von dem neuen Käse mit Seelachsrogen, daneben zwei Reihen von unserem Bestseller, der Thunfischmayonnaise, und ganz an den Rand die Ladenhüter, die sich am schlechtesten verkaufen, Onigiri mit Thunfischflocken und Sojasoße. Es kommt auf Geschwindigkeit an, und ich überlasse mich, ohne nachzudenken, den Abläufen, die mir längst in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Auf ein leises Klimpern hin wende ich mich um und schaue zur Kasse. Wenn jemand mit Kleingeld in der Hosentasche spielt, höre ich das sofort, denn in der Regel ist es ein Kunde, der nur schnell Zigaretten oder eine Zeitung kaufen will. Tatsächlich schreitet ein Mann, die eine Hand in der Hosentasche, in der anderen eine Dose Kaffee, auf die Kasse zu.
Ich schlittere durch den Laden hinter die Kasse, um gleich zur Stelle zu sein. Er soll nicht warten müssen.
»Guten Morgen«, sage ich mit einer leichten Verbeugung und nehme ihm die Dose ab.
»Ah ja, und einmal die Zigaretten Nummer 5.«
»Sofort.« Rasch nehme ich eine Packung Marlboro Menthol Lights heraus. »Dürfte ich Ihr Alter überprüfen?«
Während ich seinen Ausweis auf das dafür vorgesehene Feld lege, lässt der Mann seinen Blick über die Vitrine mit dem Fastfood schweifen. Er hat aufgehört, mit dem Geld zu klimpern. Ich könnte ihn fragen, ob er noch einen Wunsch hat, doch anscheinend überlegt er noch, ob er etwas kaufen soll, und ich beschließe abzuwarten.
»Und einen Hotdog am Stiel.«
»Kommt sofort.« Ich desinfiziere mir die Hände, öffne die Vitrine und wickle den Hotdog ein. »Soll ich das Kaltgetränk und die warme Wurst getrennt einpacken?«
»Nein, nicht nötig. Eine Tüte genügt.«
Rasch verstaue ich Kaffee, Zigaretten und Hotdog in einer Tüte der Größe S. Als wäre ihm etwas eingefallen, greift der Mann, der ursprünglich mit dem Kleingeld in der Hosentasche geklimpert hatte, in seine Brusttasche. Aus dieser Geste schließe ich, dass er doch mit Karte zahlen will.
»Ich zahle mit Suica.«
»Sehr gern. Hier bitte, das Suica-Feld.«
Selbst die unauffälligsten Gesten und Blicke nehme ich automatisch wahr. Meine Reaktionen sind Reflexe, meine Augen und Ohren Sensoren, die die kleinsten Regungen und Wünsche meiner Kundschaft registrieren. Ich hüte mich, den Mann unnötig scharf zu beobachten, damit er sich nicht unbehaglich fühlt, und folge meiner Intuition.
»Hier bitte, Ihr Beleg. Vielen Dank für Ihren Einkauf«, sage ich, während ich ihm den Kassenzettel aushändige.
Der Mann bedankt sich leise und verlässt den Laden.
»Guten Morgen. Entschuldigen Sie die Wartezeit«, begrüße ich die nächste Kundin.
Vor allem morgens, wenn der Tag beginnt und die Menschen an unserer fleckenlos polierten Scheibe vorbeieilen, genieße ich meine Arbeit in dem hell erleuchteten Glaskasten. Um diese Zeit erwacht die Welt, und ihre Zahnräder setzen sich in Bewegung. Eines dieser Rädchen bin ich, und ich drehe mich immerfort.
Als ich gerade zu den Regalen zurückeilen will, um weiter einzuräumen, fragt mich Frau Izumi, die Chefaushilfe, wie viele Fünftausend-Yen-Scheine ich noch in der Kasse habe.
»Nur noch zwei.«
»Das ist schlecht. Irgendwie haben wir heute nur Zehntausender. Hinten im Safe sind auch keine Fünftausender mehr. Wenn der erste Ansturm vorbei ist und die Lieferungen da sind, gehe ich mal auf die Bank.«
»Danke, das wäre nett.«
Die Nachtschicht ist nicht ausreichend besetzt, weshalb neuerdings der Filialleiter sie übernimmt und Frau Izumi, die in meinem Alter ist, mich tagsüber als vollwertige Mitarbeiterin einsetzt.
»Gut, dann gehe ich gegen zehn Uhr mal was wechseln. Ach ja, und heute hat jemand Inarizushi vorbestellt. Wenn der Kunde kommt, kümmerst du dich darum, ja?«
»Wird gemacht!«
Ich sehe auf die Uhr. Gleich halb zehn. Um diese Zeit lässt der morgendliche Andrang allmählich nach, und ich muss mit dem Einräumen fertig werden, um anschließend die Vorbereitungen für die Mittagszeit treffen zu können. Ich strecke mich und gehe wieder zum Regal, um weiter Onigiri einzusortieren.
An die Zeit vor meiner »Geburt« als Ladenhilfe im Konbini kann ich mich nur sehr vage erinnern.
Aufgewachsen bin ich in einem Vorort, in einer ganz normalen, liebevollen Familie. Dennoch war ich ein sonderbares, etwas verhaltensauffälliges Kind.
Einmal, als ich noch im Kindergarten war, fand ich im Park einen toten Vogel. Er war sehr hübsch und hatte ein blaues Gefieder, vermutlich ein entflogenes Haustier.
Alle Kinder umringten ihn, und einige weinten. Der Hals des kleinen Vogels war verdreht, und seine Augen waren geschlossen.
»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragte ein Mädchen.
Hastig nahm ich den kleinen Vogel an mich und lief zu meiner Mutter, die auf einer Bank mit anderen Müttern plauderte.
»Keiko, was ist denn? Ach, ein Vögelchen … Es ist wohl jemandem davongeflogen. Das Ärmste! Wollen wir es begraben?«, sagte sie und strich mir dabei liebevoll übers Haar.
»Lieber essen«, sagte ich.
»Wie bitte?«
»Papa mag doch Hähnchenspieße so gern. Wir können den kleinen Vogel heute Abend braten«, erklärte ich noch einmal deutlicher, weil ich glaubte, sie habe mich nicht verstanden. Meine Mutter wirkte bestürzt, und auch die anderen Mütter rissen entgeistert Augen und Mund auf. Sie sahen zum Brüllen aus. Aber weil sie so auf meine Hand starrten, dachte ich, ein einzelner Vogel wäre wahrscheinlich nicht genug.
»Soll ich noch mehr holen?« Mein Blick huschte zu ein paar in der Nähe herumhüpfenden Spatzen, woraufhin meine Mutter endlich ihre Fassung zurückgewann.
»Keiko!«, rief sie vorwurfsvoll. »Wir machen jetzt ein Grab für den kleinen Vogel. Guck mal, alle weinen. Ein Freund ist gestorben, das ist doch traurig. Tut dir der kleine Vogel nicht leid?«
»Wieso? Der ist doch tot.«
Meiner Mutter fehlten die Worte.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Vater, meine Mutter und meine kleine Schwester Asami den Vogel nicht gern verspeisen würden. Mein Vater mochte Hähnchenspieße sehr, und Asami und ich waren ganz versessen auf Gegrilltes.
Im Park gab es eine Menge Vögel, die man fangen und mit nach Hause nehmen konnte. Warum sollte man sie also vergraben, statt sie zu essen? Es war mir ein Rätsel.
»Sieh doch mal, so ein niedliches kleines Vögelchen, meinst du nicht?«, redete meine Mutter mir zu. »Wir begraben es dort drüben, und ihr legt Blumen auf sein Grab, ja?«
Letztendlich geschah es so, aber verstehen konnte ich es nicht. Die anderen Kinder standen um das Grab herum und jammerten, wie leid ihnen der kleine Vogel tue. Anschließend rissen sie überall Blumen aus, die dann auch tot waren. »So schöne Blumen. Bestimmt freut sich der kleine Vogel«, sagten sie, und ich fragte mich, ob sie vielleicht den Verstand verloren hatten.
Das Vogelgrab befand sich innerhalb einer Einfriedung mit einem Betreten verboten-Schild. Jemand steckte einen Eiscremestiel aus dem Mülleimer in die Erde, und sie häuften die toten Blumen darauf.
»Jetzt guck doch mal, Keiko, das ist doch traurig, das arme Vögelchen«, flüsterte meine Mutter unentwegt auf mich ein, aber ich fand das kein bisschen.
Solche und ähnliche Dinge passierten immer wieder. Zum Beispiel, als sich kurz nach meiner Einschulung auf dem Schulhof zwei Jungen prügelten. Es herrschte große Aufregung.
»Wir müssen einen Lehrer rufen!«, schrien einige Kinder.
»Ja, jemand muss sie aufhalten!«
Genau, dachte ich, aufhalten. Rasch holte ich mir eine Schaufel aus dem Geräteschuppen und schlug einem der Streithähne damit auf den Kopf.
Alle kreischten, der Junge hielt sich den Kopf und blieb reglos liegen. Als ich das sah, schwang ich erneut die Schaufel, um auch den anderen Jungen außer Gefecht zu setzen.
»Keiko! Hör auf! Hör auf!«, heulten die Mädchen.
Die herbeigeeilten Lehrer konnten es nicht fassen und verlangten eine Erklärung von mir.
»Es hieß doch, wir müssten sie aufhalten, und das war die schnellste Methode.«
Entgeistert stammelte einer der Lehrer, dass Gewalt doch keine Lösung sei.
»Aber alle haben gesagt, die sollen aufhören. Ich wollte doch nur, dass Yamazaki und Aoki aufhören«, erklärte ich geduldig. Ich verstand nicht, warum meine Lehrer so entsetzt waren. Jedenfalls gab es eine Klassenkonferenz, und meine Mutter musste in die Schule kommen.
Beim Anblick meiner Mutter, die sich mit todernstem Gesicht, unablässig Entschuldigungen murmelnd, vor den Lehrern verbeugte, wurde mir klar, dass ich etwas sehr Schlimmes getan hatte. Aber warum das so war, konnte ich nicht begreifen.
Etwas Ähnliches geschah, als eine Lehrerin während einer Unterrichtsstunde einen hysterischen Anfall bekam und mit dem Klassenbuch auf ihr Pult eindrosch. Alle winselten, baten sie um Verzeihung und flehten sie an aufzuhören.
Da sie sich auch auf unsere inständigen Bitten hin nicht beruhigte, lief ich nach vorn und zog ihr mit einem Ruck Rock und Strumpfhose herunter, um sie zum Schweigen zu bringen. Erschrocken hörte die junge Lehrerin auf zu schreien und fing an zu weinen.
Der Lehrer aus der Klasse nebenan kam angerannt, und als ich ihm erzählte, ich hätte mal im Fernsehen gesehen, wie eine erwachsene Frau sich beruhigt habe, als man ihr die Kleidung herunterriss, gab es wieder eine Klassenkonferenz.
»Ach, Keiko, was gibt es denn da nicht zu verstehen?«, klagte meine Mutter auf dem Heimweg und legte verzagt die Arme um mich. Sie hatte erneut in die Schule kommen müssen. Anscheinend hatte ich wieder einmal etwas Schlimmes angestellt, auch wenn ich nicht verstand, was so schlimm daran sein sollte. Meine Eltern waren am Ende ihrer Weisheit, liebten mich aber dennoch nicht weniger. Weil sie so bekümmert waren und ich nicht wollte, dass sie sich immer wieder bei allen möglichen Leuten entschuldigen mussten, beschloss ich, mich außerhalb meines Zuhauses möglichst still zu verhalten. Ich tat nur noch, was die anderen taten, folgte allen Anweisungen und stellte so gut wie jede eigene Lebensäußerung ein.
Die Erwachsenen schienen erleichtert, als sie merkten, dass ich nur noch das Nötigste sprach und nicht mehr eigenmächtig handelte.
Dass ich so still war, entwickelte sich in der Oberschule natürlich zu einem eigenen Problem. Dennoch schien mir Schweigen das beste Mittel zu sein, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Es war einfach die vernünftigste Strategie. Auch wenn in meinem Zeugnis jedes Mal stand, ich solle »mehr Freundschaften schließen und im Freien spielen«, beschränkte ich meine Kommunikation weiterhin auf das Nötigste.
Anders als ich war meine zwei Jahre jüngere Schwester Asami ein ganz »normales« Kind. Dennoch ging sie mir nicht aus dem Weg, im Gegenteil, sie hing sehr an mir. Immer wenn meine Mutter sie wegen einer Kleinigkeit ausschimpfte, was sie bei mir nie tat, fragte ich sie nach dem Grund ihres Ärgers und setzte ihrer Predigt damit meist ein Ende. Asami war mir dankbar, weil sie glaubte, ich hätte sie verteidigt. Außerdem hatte ich kein Interesse an Süßigkeiten oder Spielsachen und verschenkte alles regelmäßig an Asami.
Wie gesagt, war meine Familie stets liebevoll besorgt um mich. Immerzu fragten sich meine Eltern, wie sie mich »heilen« könnten.
Ich weiß noch, dass ich immer überlegte, wie ich mich bessern könnte, wenn ich sie beratschlagen hörte. Einmal fuhren wir sogar mit dem Auto in einen anderen Ort zu einer Beratung. Anfangs mutmaßte der Berater natürlich, dass bei uns zu Hause etwas nicht stimmte, doch mein Vater war ein heiterer und gelassener Mensch und hatte als Bankangestellter ein gesichertes Einkommen, und meine Mutter war, wenngleich ein wenig kleinmütig, eine liebe Frau. Auch meine jüngere Schwester war mir zugetan. Also empfahl der Berater meinen Eltern etwas Unverfängliches wie: »Sie sollten sie sehr lieb haben und gut auf sie aufpassen«, und meine Eltern erzogen mich weiter besorgt und mit viel Liebe.
Zwar schloss ich keine Freundschaften, aber weil ich so konsequent den Mund hielt, gelang es mir, die Schule zu überstehen, ohne sonderlich gemobbt zu werden.
Auch als ich nach dem Abschluss auf die Universität ging, änderte sich nichts. Meine Freizeit verbrachte ich grundsätzlich allein, persönliche Unterhaltungen führte ich nie. Schwierigkeiten wie damals in der Grundschule hatte ich nicht mehr, dennoch waren meine Eltern weiterhin besorgt um mich. Ich fand überhaupt keinen Anschluss an die Gesellschaft und wuchs in der Vorstellung heran, »unheilbar« zu sein.
Am 1. Mai 1998, als die Filiale des Smilemart in Hiiro-chō eröffnete, war ich in meinem ersten Studienjahr.
Ich weiß noch genau, wie ich das kleine Geschäft kurz vor seiner Eröffnung entdeckte. Ich hatte mich auf meinem einsamen Rückweg von einer Uni-Festivität – natürlich hatte ich mich mit niemandem angefreundet – verlaufen und irrte nun durch ein mir unbekanntes Büroviertel.
Auf einmal merkte ich, dass nirgendwo ein Mensch zu sehen war. Alles war wie leergefegt. Die Straße mit den weißen sauberen Gebäuden wirkte wie eine aus Zeichenpapier gefertigte Kulisse. Eine Geisterstadt, in der es nur Gebäude gab und in der sonntags außer mir wohl niemand unterwegs war.
Überwältigt von der Verlorenheit, die ich an diesem bizarren Ort empfand, rannte ich auf der Suche nach dem U-Bahnhof los. Als ich endlich das U-Bahn-Schild sah und erleichtert darauf zusteuerte, fiel mir das verglaste Erdgeschoss eines der weißen Bürogebäude auf. Es sah fast aus wie ein Aquarium.
An einer Scheibe hing ein Plakat mit der Aufschrift Neueröffnung! Smilemart am Bahnhof Hiiro-chō – Mitarbeiter gesucht! Ich spähte ins Innere, aber es war niemand zu sehen. Anscheinend waren die Arbeiten noch im Gange, denn die Wände waren hier und da mit Plastikplanen abgedeckt und die weißen Regale leer. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass in diesem kahlen Raum ein Convenience Store – ein Konbini – entstehen sollte.
Eigentlich bekam ich genug Geld von zu Hause, dennoch war ich an einem Job interessiert. Also notierte ich mir die Telefonnummer von dem Plakat. Am nächsten Tag rief ich an und wurde nach einem kurzen Vorstellungsgespräch als Ladenhilfe eingestellt.
Als ich in der Woche darauf zum vereinbarten Schulungstermin in den Smilemart kam, wirkte er schon etwas mehr wie ein Convenience Store. Die Regale mit den Haushaltsartikeln, Schreibwaren, Taschentüchern usw. waren bereits ordentlich eingeräumt.
Außer mir hatten sich noch mehr Aushilfen versammelt, die sich wie ich etwas dazuverdienen wollten. Studentinnen, junge Gelegenheitsarbeiter, etwas älter wirkende Hausfrauen – insgesamt standen etwa fünfzehn unterschiedlich gekleidete Personen verschiedenen Alters ein wenig unbehaglich herum.
Kurz darauf tauchte ein Schulungsleiter von der Firma auf und verteilte die Uniformen. Wir schlüpften hinein und machten uns einer Checkliste folgend zurecht. Lange Haare waren zurückzubinden, Uhren und Schmuck abzulegen, und im Nu wurde aus der eben noch bunt zusammengewürfelten Schar eine Gruppe »Ladenangestellter«.
Als Erstes übten wir die Begrüßung und den dazu passenden Gesichtsausdruck. Laut Anweisung mussten wir die Mundwinkel zu einem Lächeln hochziehen und mit geradem Rücken in einer Reihe stehend »Herzlich willkommen!« rufen. Der Schulungsleiter prüfte nacheinander jeden einzelnen, und wenn jemand zu leise oder zu verkrampft lächelte, hieß es sofort: »Noch einmal, bitte!«
»Frau Okamoto, nicht so schüchtern. Freundlicher lächeln! Herr Aizaki, etwas lauter! Bitte noch einmal! Frau Furukura, ja, sehr gut! Genau so, immer schön munter!«