
Aus dem Amerikanischen und
mit einem Nachwort von
Daniel Schreiber
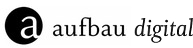
James Leo Herlihy, geboren 1927 in Detroit, Michigan, schrieb Drehbücher und Roman und arbeitet als Schauspieler. Er schaffte gleich mit seinem Debütroman »All Fall Down« (1960) den großen Durchbruch. 1965 folgte »Midnight Cowbow«, das von John Schlesinger mit Dustin Hoffmann als Ratso Rizzo verfilmt wurde und drei Oscars gewann. Herlihy starb 1993 an einer Überdosis Schlaftabletten.
Daniel Schreiber, Kunstkritiker, Essayist und Übersetzer, hat in Berlin und New York studiert. Sein Buch »Susan Sontag. Geist und Glamour« war die erste Biografie über die bekannte amerikanische Intellektuelle und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Er ist Autor der hochgelobten Essaybände »Nüchtern. Über das Trinken und das Glück« und »Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen«. Schreiber lebt in Berlin.
Der Kultroman über Liebe und Einsamkeit
Joe Buck wächst bei einer Gruppe von Prostituierten auf, sieht dort den Cowboys zu, die abends im Schoß der Frauen Gitarre spielen. Eines Tages beschließt er, all sein Geld zusammenzunehmen und sich echte Cowboy-Stiefel zu besorgen.
James Leo Herlihy erkundet die Untiefen unseres Verlangens nach Ruhm, Sex und Geld, aber die Geschichte von Joe Buch und Ratso Rizzo erzählt auf berührende Weise von einem viel stärkeren Bedürfnis: einem anderen Menschen nah zu sein.
Midnight Cowboy zählt zu den besten Roman der amerikanischen Nachkriegsliteratur. Der gefeierte Autor Daniel Schreiber ermöglicht es mit seiner Neuübersetzung nun erstmals die ganze sprachliche und emotionale Wucht dieses Romans auf Deutsch zu erleben.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Aus dem Amerikanischen und
mit einem Nachwort von
Daniel Schreiber
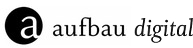
Inhaltsübersicht
Über James Leo Herlihy
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Auf der Suche nach James Leo Herlihy
Impressum
In seinen neuen Stiefeln war Joe Buck eins fünfundachtzig groß, und die Welt sah anders aus. Als er den Laden in Houston verließ, fühlte sich sein ganzer Unterkörper wie neu an: Eine Kraft, deren Existenz er vorher noch nicht einmal geahnt hatte, erfüllte seine Beckengegend und schenkte ihm eine neue Perspektive auf das Leben. In seinem Hintern und seinen Beinen setzten sich ganz neue Muskeln in Bewegung, und ihm wurde bewusst, dass er in einer völlig anderen Haltung über den Bürgersteig ging als zuvor. Die Welt war jetzt da unten und er hier oben, an ihrer Spitze, und der Raum dazwischen wurde von einem schönen, fremden Tier beherrscht, von ihm selbst, von Joe Buck. Er war mächtig. Er triumphierte. Nun konnte es losgehen.
»Es kann losgehen«, sagte er zu sich selbst, aber dann fragte er sich, was er damit eigentlich meinte.
Joe wusste, dass er alles andere als ein großer Denker war, und er wusste auch, dass es ihm am besten gelang, über etwas nachzudenken, wenn er vor einem Spiegel stand. Also suchten seine Augen die Umgebung nach etwas ab, in dem er sich spiegeln konnte. Ein paar Meter weiter sah er ein Schaufenster. Klick-klack, klick-klack machten seine Stiefel auf dem Asphalt und wollten damit sagen: Ich hab’ die Macht, Macht, Macht. Als er näher an die Glasscheibe herantrat, kam ihm dieser neue und doch irgendwie vertraut wirkende Mann entgegen, mit breiten Schultern, voller Stolz, cool und schön. O Gott, bin ich froh, dass wir beide zusammengehören, sagte er zu seinem Spiegelbild – wenn auch nicht laut – und dann, hey, was soll dieser ganze Scheiß mit dem Losgehen? Was soll denn eigentlich losgehen?
Und dann erinnerte er sich wieder.
Als er ins H tel zurückkehrte – ein Hotel, das nicht nur keinen eigenen Namen hatte, sondern dem auch noch das o in seiner Leuchtschrift abhandengekommen war –, dachte er, wie absurd es ist, dass jemand, der so reich, stark und sexy war wie er, in solch einer namen- und bedeutungslosen Absteige gelandet war. Er lief die Treppen zum zweiten Stock hoch, nahm dabei zwei Stufen auf einmal und eilte zum Wandschrank, aus dem er einige Sekunden später mit einem großen Paket in der Hand wieder auftauchte. Er befreite es von seinem braunen Packpapier und legte den schwarz-weißen Pferdelederkoffer, der sich darin befunden hatte, auf das Bett.
Er verschränkte seine Arme, trat einen Schritt zurück, schaute sich den Koffer an und schüttelte vor Ehrfurcht den Kopf. Die Schönheit dieses Dings bewegte ihn jedes Mal. Das Schwarz des Leders war so schwarz, das Weiß so weiß und das ganze Ding war so lebensecht und weich, dass er das Gefühl hatte, im Besitz eines wahren Wunders zu sein. Er schaute erst, ob seine Hände schmutzig waren, und strich dann über das Leder, als wollte er es saubermachen. Aber natürlich war das nicht nötig, mit seiner Handbewegung wollte er lediglich die Möglichkeit zukünftigen Schmutzes verhindern.
Joe machte sich daran, einige andere Schätze, die er in den vergangenen Monaten angesammelt hatte, aus ihrem Versteck zu holen: sechs nagelneue Westernhemden, neue Hosen (ein Paar aus schwarzer Gabardine, ein anderes aus schwarzer Baumwolle), neue Unterwäsche, Socken (sechs Paar, immer noch in ihrer Zellophan-Verpackung), zwei Seidentaschentücher, die er sich um den Hals binden würde, einen Silberring aus Juárez, ein tragbares Transistor-Kofferradio, das ohne auch nur eine Andeutung störenden Rauschens Radiosender aus Mexiko-Stadt empfangen konnte, einen neuen elektrischen Rasierapparat, vier Packungen Camel und ein paar Juicy-Fruit-Kaugummis, Toilettenartikel, einen Stapel alter Briefe usw.
Dann ging er unter die Dusche und kehrte in sein Zimmer zurück, um sich für die Reise frisch zu machen. Er rasierte sich mit seinem neuen Rasierapparat, säuberte diesen und legte ihn wieder in den Koffer zurück. Er spritzte etwas Florida Water auf sein Gesicht, unter seine Achseln und in seinen Schritt, kämmte sich eine centgroße Portion Brylcream-Pomade ins Haar, das damit fast so aussah, als sei es schwarz. Er frischte seinen Atem mit einem neuen Juicy-Fruit-Kaugummistreifen auf, um diesen dann wieder auszuspucken, schmierte seine neuen Stiefel mit einem besonderen Lederpflegemittel ein, zog sich ein neues Sieben-Dollar-Hemd über (schwarz, mit weißer Paspel, es schmiegte sich so eng an seinen schlanken Oberkörper und seine breiten Schultern, als wäre es eine zweite Haut), band sich ein blaues Taschentuch um den Hals, arrangierte die Stulpen seiner an den Oberschenkeln engen Hose aus Whipcord mit einer coolen Nachlässigkeit, so dass sie zum Teil in den satt glänzenden Stiefeln steckten und zum Teil nicht, und ging dabei sicher, dass man noch seine goldbraunen Knöchel aufblitzen sah, und schließlich zog er sich ein cremefarbenes Sportsakko aus Leder über, das so weich und geschmeidig war, dass es sich geradezu lebendig anfühlte.
Jetzt wollte Joe das Ergebnis seiner Bemühungen würdigen. Während er sich frisch machte, nahm er nur selten sein Spiegelbild in Augenschein. Er erlaubte sich nur, sich etwa auf den Flecken Haut, den er zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Rasierapparat bearbeitete, zu konzentrieren oder auf den Teil seines Haars, den er gerade mit dem Kamm in Form brachte, und so weiter. Er wollte seine Fähigkeit, sich als Ganzes wahrzunehmen, nicht strapazieren. In gewisser Hinsicht benahm er sich wie eine Mutter, die ihr Kind für eine Audienz bei irgendeiner wichtigen Person vorbereitet, deren Urteil über das Schicksal des Kindes entscheidet. Als er sich in Schale geworfen hatte und es an der Zeit war, den Eindruck zu begutachten, den er nun hinterlassen würde, drehte Joe Buck dem Spiegel daher tatsächlich den Rücken zu, ging ein paar Schritte von diesem weg, kreiste rückwärts mit den Schultern, um seinen steifen Rücken zu lockern, nahm ein paar sehr tiefe Atemzüge, machte schnell zwei, drei Kniebeugen und schüttelte seine Arme und Beine aus, bis die Gelenke knackten. Dann verlagerte er sein Gewicht auf einen Fuß und nahm die lässige Haltung ein, die für ihn ohnehin zu so etwas wie einer Gewohnheit geworden war, da er glaubte, das wirke attraktiv. Er rief sich ein bestimmtes Bild vor Augen, wie meistens das eines hübschen, naiven Mädchens, das ihn bewunderte, lächelte dieses Mädchen in Gedanken mit dem Ausdruck einer nicht ganz aufrichtigen weisen Nachsicht an, steckte sich eine seiner Camels in den Mund, zündete sie an und steckte einen Daumen in seinen tiefsitzenden, breiten Ledergürtel. Dann war er endlich bereit, einen frischen Blick auf sich selbst zu werfen, drehte sich schwungvoll um und schaute in den Spiegel, als hätte ihn jemand, der sich dahinter versteckt hatte, plötzlich bei seinem Namen gerufen: Joe Buck!
An diesem Tag, dem Tag seiner Reise, gefiel es Joe ganz besonders, was er dort sah: Er mochte den süßen, mysteriösen und gefährlichen Teufel, der ihn im schmutzigen Spiegel des H tel-Zimmers überraschte. Im Spiegel konnte er auch sehen, wie sein herrlicher Koffer hinter ihm auf dem Bett lag, und in der Gesäßtasche seiner Hose konnte er das flache Bündel mit den Geldscheinen spüren, zweihundertvierundzwanzig Dollar, mehr als er jemals besessen hatte. Und vor allem hatte er den Eindruck, dass er im Besitz seiner selbst war, dass er sich wohl in seiner Haut fühlte, wie er so dastand in seinen neuen Stiefeln, er, der über seine Muskeln und seine Fähigkeiten herrschte, der über diese ganze Schönheit, Kraft und Jugend, über diesen ganzen Saft verfügte, er, der die besten Karten für den schillernden Höhenflug seiner Zukunft gekauft hatte – und dieser Eindruck schien ihn beinahe zu überwältigen.
Früher, es war gar nicht so lange her, war ihm im Spiegel immer ein nachdenklicher, ängstlicher und einsamer Mann begegnet, der sich selbst überhaupt nicht gefiel. Doch dieser Mann war jetzt verschwunden, Joe hatte ihn komplett aus dem Weg geräumt und schaute jetzt einem neuen Mann ins Gesicht. Wäre diese ganze Herrlichkeit auch nur ein bisschen größer gewesen, hätte er es nicht ertragen können und wäre vor Verwunderung zusammengesackt. Es war jetzt schon schlimm genug. Wenn er das unfassbare Glück, er selbst zu sein – genau zu diesem Zeitpunkt, genau an diesem Ort, an dem er sich ohnehin nur auf Durchreise befand –, auch nur einen Augenblick länger auskostete, würde er alles durch einen Heulanfall ruinieren, glaubte er.
Also packte er seine Sachen zusammen und ließ das H tel für immer hinter sich.
Über der Tür der Sunshine Cafeteria hing eine große gelbe Sonne mit einer darin eingelassenen Uhr (zwanzig vor sieben), und auf dem Ziffernblatt der Uhr stand ZEIT, ETWAS ZU ESSEN geschrieben.
Als Joe das Café betrat, spielte sich folgende Szene vor seinem inneren Auge ab:
Er geht ins Sunshine. Sein Chef, ein Mann mit rosigem Gesicht und einem schmutzigen grauen Anzug, steht an der Tür und hält seine Taschenuhr in seiner rechten Hand, während er den Zeigefinger seiner linken Hand hochhält und damit vor Joes Nase umherwackelt. »Deine Schicht fängt um vier an, von vier bis Mitternacht, verstanden?«, schreit er ihn an. Die Gäste des Lokals halten inne und schauen von ihren Tellern zu ihnen hoch. Joe greift sich ein Ohr des rosigen Manns und zerrt ihn an den erstaunten Kunden vorbei in die Spülküche. Eine Reihe der Köche, Kellnerinnen und Küchenhilfen hören auf zu arbeiten und schauen dabei zu, wie er den rosigen Restaurantchef gegen den Geschirrspüler drückt. Joe lässt sich Zeit und zündet sich eine Zigarette an und stellt einen Fuß auf den großen Geschirrkorb, die Stiefel sehen hervorragend aus. Dann bläst er seelenruhig den Rauch seiner Zigarette in die Luft und sagt: »Irgendwas an dieser Geschirrspülmaschine stört mich. Stört mich schon sehr lange. Jawohl. Und zwar frage ich mich die ganze Zeit, ob dieser Geschirrspüler nicht in dein’n Arsch passt. Also, bück dich jetzt mal.« – »Was, ich soll mich bücken, was? Hast du sie nicht mehr alle?«, wehrt sich der rosige Mann. Joe bleibt ruhig, was ihn noch bedrohlicher wirken lässt, schaut unter seinen dunklen Augenbrauen hervor und sagt: »Hast du eben behauptet, ich hab’ sie nicht mehr alle?« – »Nein, nein, nein, ich meinte nur …« – »Jetzt bück dich«, sagt Joe. Der Mann bückt sich, und Joe sieht die Geldbörse, die aus der Gesäßtasche des Mannes hervorschaut. »Ich nehm’ mir mal mein Gehalt«, sagt er, während er sich das Geld aus dem Portemonnaie nimmt, »und genehmige mir auch ’nen kleinen Bonus.« Er steckt sich das große Geldscheinbündel in seinen Jockstrap und verlässt den Laden, während alle ihn mit großen Augen und zutiefst beeindruckt anschauen. Aber keiner traut sich, ihn aufzuhalten oder ihm auch nur zu folgen. Und Tatsache ist, dass der rosige Mann sogar noch ein paar Tage nach Joes Abgang in seiner gebückten Haltung stehen bleibt, um auch ganz auf Nummer sicher zu gehen.
Das war, was Joe sich vorstellte. Das ist, was wirklich geschah:
Er überquerte geräuschvoll die Straße, ging durch die Drehtür in die Sunshine Cafeteria, stolzierte mit seinem neuen Körper an den Tischen vorbei und begab sich durch eine Tür, auf der NUR FÜR PERSONAL stand. Hinter dieser Tür gab es keine Klimaanlage, drinnen war es heiß und dampfig. Er ging durch eine weitere Tür und gelangte in die Spülküche. Dort füllte ein Schwarzer mittleren Alters einen Geschirrkorb mit schmutzigem Geschirr und stellte diesen auf das Förderband, das zur Geschirrspülmaschine führte. Dann lächelte er Joe zu und wies nickend auf einen Stapel von Drahtkörben voll Geschirr, der sich vom Fußboden der Küche erhob. »Kümmer’ dich um den Scheiß, ja?«, sagte er.
Joe stand neben dem Mann und sagte: »Hör zu, also, ’s sieht so aus, als würd’ ich mich auf den Weg Richtung Ostküste machen.« Er zündete sich eine Zigarette an.
Der Mann schaute auf Joes Koffer: »Kommst nicht zur Arbeit?«
»Nee, denk’ nicht, wollt’ nur tschüss sagen und dir erzählen, dass ich an die Ostküste abhau’.«
»Die Ostküste?«
»Ja, zum Teufel, ja. Dachte, ich sag’ tschüss und schau’ mir das Ganze hier noch mal an.«
Die Tür öffnete sich, und eine dicke Frau mit einem fleckigen Gesicht schaute herein und schrie mit voller Kraft: »Tassen!« Dann schloss sie die Tür wieder und war verschwunden.
Der Schwarze streckte Joe die Hand entgegen. »Na dann, auf Wiedersehen.« Sie schüttelten sich die Hände, und einen Augenblick lang hatte Joe keine Lust, die Hand des anderen Mannes loszulassen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund fühlte er sich, als würde er sich am liebsten eine Schürze überziehen und an die Arbeit machen, aber das stand nicht zur Debatte. »Was zum Teufel mach’ ich bloß hier, was?«
»Jawohl«, sagte der Mann und schaute auf seine Hand, die Joe immer noch umschlossen hielt. »Was wirst du dort machen, an der Ostküste?«
»Frauen«, sagte Joe. »Ostküstenfrauen. Sie ham’ Ostküstenfrauen dort, und die sind immer bereit, dafür zu zahlen.«
»Zahlen wofür?« Der Mann hatte sich schließlich von Joes Hand befreit.
»Die Männer drüben sind fast alle Schwuchteln«, sagte Joe, »und so müssen sich die Frauen kaufen, was sie brauchen. Sind froh, wenn die dafür zahl’n können, weil sie’s anders sowieso nicht bekommen.«
Der Schwarze schüttelte seinen Kopf. »Muss eine schöne Scheiße sein, dort drüben.« Er nahm sich einen neuen Geschirrkorb vor und füllte diesen mit Tassen.
»Jawohl, ’ne schöne Scheiße. Ich werd’ mir ’ne goldene Nase verdienen dran. Hab’ ich recht oder hab’ ich recht?«
»Keine Ahnung. Ich hab’ keine Ahnung, was da abgeht.«
»Wie meinst du das? Ich hab’s dir doch gerade erklärt.«
»Ja, ja, ich weiß, bin mir trotzdem nicht so sicher.«
»Na dann, hat keinen Sinn, hier weiter abzuhängen. Muss mich auf den Weg machen. Oder?«
Joe Buck, in voller Cowboy-Montur, wusste plötzlich, dass er alles andere als ein Cowboy war. Er stand da mit halboffenem Mund, so dass man das Weiß seiner großen, leicht hervorstehenden Zähne sehen konnte, seine blauen Augen waren auf das Gesicht des älteren Mannes gerichtet. »Papa«, schienen sie zu sagen, »ich mache mich jetzt auf den Weg, um mein Glück zu suchen, und bin gekommen, um mir deinen Segen zu holen.« Aber natürlich war der arme Schwarze nicht Joes Vater. Und Joe war genau genommen auch nicht der Sohn von irgendjemandem. Also verließ er die Spülküche. Das Lokal schuldete ihm einen Tageslohn, aber er hatte gerade keine Nerven dafür, sich auf ein Gespräch mit dem rosigen Mann einzulassen, der Chef des Sunshine war. Außerdem wusste er, dass er dem Typen nie im Leben sagen würde, dass er sich die Geschirrspülmaschine in den Arsch stecken soll.
Er ging durchs Café und trat nach draußen auf den Bürgersteig. Es war schon Abend, ein angenehmer Abend, es war eindeutig Frühling, und es dauerte nicht lange, bis er sich wieder wohl fühlte, nicht zuletzt weil die Geräusche seiner Absätze ihm Auftrieb gaben, während er in Richtung Busbahnhof ging. In Gedanken war er ohnehin schon Tausende Meilen weit entfernt. Er dachte daran, wie er die Park Avenue in New York City entlanglaufen würde. Wie reiche Frauen aus ihren Fenstern schauen und schwach werden würden, weil sie einen Cowboy auf der Straße sehen. Ein Butler tippt ihn an die Schulter, ein surrender Fahrstuhl bringt ihn in eine Penthouse-Wohnung, eine goldene Tür öffnet sich. Die Wohnung ist vollständig mit einem Teppich aus weichem braunen Flor ausgelegt. Die Dame des Hauses trägt nichts als knappe Höschen und darüber ein durchsichtiges schwarzes Negligé. Als sie Joe Buck sieht, wird ihr Atem schwer, so überwältigt ist sie von seinem Anblick. Vor Lust schaudernd und ohne auch nur eine Minute zu verlieren, wirft sie sich auf den weichen Fußboden. Ihr Körper wartet schon auf ihn, und die Säfte ihrer Weiblichkeit fließen ihm entgegen. Sie haben keine Zeit, sich auszuziehen, er muss sie sofort haben. Der Butler händigt ihm einen Scheck aus, auf dem sich eine ausladende Unterschrift befindet und die Zeile für den Betrag offen gelassen ist, damit er sie nach eigenem Belieben ausfüllen kann.
Auf dem Busbahnhof in Houston stand eine Jukebox. Als Joe in seinen Bus einstieg, hörte er, wie die Stimme einer stattlichen, dicken Westküstenfrau über »das Rad des Glücks, das sich dreht und dreht und dreht« sang, und er schien ihm, dass sie damit alle hiesigen Hengste an die Ostküste schickte, um dort so richtig aufzuräumen. Mit seinem schiefen, strahlend weißen Lächeln auf den Lippen suchte sich Joe einen Platz und glaubte plötzlich etwas über das Schicksal zu wissen, das er nicht in Worte fassen konnte. Aber er genoss dieses Wissen, auch ohne Worte dafür zu haben: das Wissen, dass man sich zum Teil seiner Zeit machen kann, auf eine Art und Weise, die einem Besitz über die Welt und alles, was dazugehört, verschafft. Und dass es, wenn es so weit ist, eine Art Klick gibt und dass nach diesem Klick die Jukebox nur das spielt, was man gerade hören muss, dass alles um einen herum, selbst der Greyhound-Bus, so funktioniert, wie es einem am besten passt. Man betritt den Bahnhof und fragt: »Wann fährt der nächste Bus nach New York City?«, und der Mann am Schalter sagt: »Sofort«, und man steigt in das Ding ein, und das ist alles, was man tun muss.
Die Welt ist Musik, und du bist ihr Rhythmus. Dir, dem Rhythmus, gehört die Welt. Du musst noch nicht einmal mit den Fingern schnippen, denn du gibst den Takt an, und wenn du an die ganzen Ostküstenfrauen denkst, vervollständigt das dicke Weib aus der Jukebox nur deine Gedanken und singt, dass sich jemand »sehnt, sehnt, sehnt«, denn das ist genau das, was eine Frau an der Ostküste macht. (Selbstverständlich, meine Dame, das, wonach Sie sich sehnen, ist gerade in den Bus gestiegen, ich bin auf dem Weg!) Es gibt einen Sitzplatz für dich, zwei, um genau zu sein, einen für deinen Hintern und einen für deine Füße, und du musst dafür noch nicht einmal reserviert haben, denn die ganze Welt ist für dich reserviert. Und genau in der Sekunde, in der du deinen Pferdelederkoffer auf die Gepäckablage schwingst, legt der Busfahrer den Gang ein und verlässt pünktlich den Bahnhof. Vielleicht nicht pünktlich, was den Fahrplan betrifft, aber pünktlich aus deiner Sicht. Denn du bist der Fahrplan. Und dieser Bus, er fährt los.
Nun war Joe Buck, als er in jenem Greyhound-Bus den Westen Amerikas hinter sich ließ, um an der Ostküste sein Glück zu suchen, schon siebenundzwanzig. Allerdings hatte er nicht mehr Lebenserfahrung gesammelt als ein junger achtzehnjähriger Mann, in mancher Hinsicht sogar noch weniger.
Er war bei verschiedenen blonden Frauen aufgewachsen. Die ersten drei hatten sich um ihn gekümmert, bis er sieben war; sie waren jung und hübsch gewesen.
Im Haus der drei blonden Frauen herrschte immer ein großes Kommen und Gehen, und er war sich nie ganz sicher, wer von ihnen eigentlich wer war. Immer mal wieder schien es so, als könnten sie alle seine Mutter sein – er nannte sie Mama soundso und Mama soundso –, aber später erfuhr er, dass zwei von ihnen lediglich Freundinnen seiner richtigen Mutter waren, die sich eine Wohnung mit ihnen teilte. Aber die blonden Frauen waren alle nett zu ihm, machten ihm Geschenke, schmusten viel mit ihm, und er konnte tun und lassen, was er wollte. Und eine von ihnen sang viel, wenn sie zu Hause war: Wonder When My Baby’s Comin’ Home, The Tumbleweed Song, Accentuate the Positive, The Lady in Red, He Wears a Pair of Silvery Wings und andere Songs. Wenn Joe Buck heute an jene Zeit zurückdachte, wurde ihm bewusst, dass er eigentlich immer geglaubt hatte, die Sängerin des Hauses sei seine Mutter gewesen.
Damals gab es einen Krieg, und einige der blonden Frauen hatten irgendetwas damit zu tun. In langen Hosen, mit Kopftüchern auf dem Kopf und einer Brotbüchse in der Hand gingen sie zu allen möglichen Tageszeiten aus dem Haus. Manchmal unternahmen sie Busreisen nach Houston oder Detroit, und Joe konnte sich erinnern, dass er in diesen Städten auch eine Zeitlang gelebt hatte. Egal, wo sie sich befanden, immer bekamen sie Besuch von Männern in Uniformen, die eine Weile dablieben und dann wieder davonzogen. Einige der Männer wurden von den Frauen als ihre Ehemänner bezeichnet, aber Joe konnte sich nicht daran erinnern, dass ihm einer von ihnen jemals als sein Vater vorgestellt worden war. (Später ging er davon aus, dass er ein uneheliches Kind war.)
Irgendwann, es war ein Tag, an dem der Himmel außergewöhnlich ruhig und weiß war, wurde er zu einer vierten blonden Frau gebracht, die in Albuquerque in New Mexico wohnte. Von diesem Zeitpunkt an sollte er die anderen drei Frauen nicht wiedersehen. Immer wenn er an sie dachte, kam ihm jener besondere, weißwolkige Himmel wieder in den Sinn und er stellte sich vor, dass sich die drei blonden Frauen irgendwo hinter den weißen Wolken versteckten.
Bei der vierten blonden Frau handelte es sich um seine Großmutter, ein albernes und dünnes kleines Wesen namens Sally Buck. Obwohl sie so dünn war, war sie hübscher als die drei anderen Frauen zusammen. Sie hatte riesige graue Augen, und ihre Wimpern waren kohlrabenschwarz und so dicht, dass sie aussahen, als wären sie mit Wachs überzogen. Nur ihre jämmerlichen wulstigen Knie konnten einen zum Weinen bringen. Vielleicht verfügt jeder Mensch, den man liebt, über etwas, das einen zum Weinen bringt, wenn man länger darüber nachdenkt, und im Fall von Sally Buck waren das für Joe ihre erbärmlichen, traurigen und knochigen Knie. Sally betrieb einen Schönheitssalon und war deshalb zehn bis zwölf Stunden am Tag nicht zu Hause, was dazu führte, dass der unglückliche Junge, wenn die Schule vorbei war, seine Nachmittage in der Gesellschaft verschiedener Putzfrauen verbrachte. Diese Frauen waren niemals blond, und sie trugen auch keine lavendelfarbenen oder blassgrünen oder zitronengelben Kleider; und außerdem kam es ihm so vor, dass sie ihn niemals wirklich anschauten, aber selbst wenn sie das getan hätten, hätten sie das mit ihren überaus gewöhnlichen Augen tun müssen, mit Wimpern, so dünn, dass man sie kaum erkennen konnte.
An Sonntagen erging es ihm nicht viel besser. Normalerweise traf sich Sally dann mit Männern. Sie hatte eine Schwäche für Männer, vor allem für solche, die im Freien arbeiteten, und viele ihrer Beaus waren Rancher und trugen Cowboyhüte. Diese großen Cowboytypen mit ihren breiten Schultern und ihrer gesunden Gesichtsfarbe fanden die zierlich hübsche Sally unwiderstehlich. Sie war von Kopf bis Fuß in Kleidung aus hauchzarten Stoffen gehüllt, trug Parfum und Nagellack, die Männer hingegen trugen Leder, waren muskelbepackt und rochen nach Mist, der Gegensatz hatte für beide Parteien etwas Erregendes. Manchmal nahm Sally Joe auf eines ihrer Dates mit, er mochte und bewunderte einige von Sallys Männern, aber nur einer von ihnen schenkte ihm wirklich Aufmerksamkeit, auf eine Weise, die nicht gespielt war.
Dieser Mann hieß Woodsy Niles. Sein Bart war blau, seine Augen leuchteten und er zeigte Joe Buck, wie man auf einem Pferd reitet oder eine Steinschleuder bastelt. Er brachte ihm auch bei, wie man Kautabak kaut, Zigaretten raucht und seinen Pimmel so hält, dass man in einem hohen Bogen pisst, höher als man selbst. Woodsy Niles gehörte zu den Menschen, die immer glücklich wirkten, und er machte alles auf seine ganz eigene genüssliche und schmissige Art, was sich sogar darin äußerte, wie er ging. Selbst sein Gang schien die Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, dass man keinen Augenblick auf dieser Welt verbringen durfte, ohne ihn zu genießen. Selbst solch einfache Handlungen, wie durch einen Raum zu gehen oder das Tor zu einem Tiergehege zu öffnen, machten ihm Spaß. Er sang auch jede Menge Lieder, dieser Woodsy Niles, sang sie mit einer guten, männlichen Stimme und spielte dazu auf der Gitarre. Wenn sie auf seiner Ranch übernachteten, wachte Joe manchmal um drei Uhr morgens auf, weil diese Lieder aus dem Zimmer, in dem Woodsy und Sally schliefen, drangen. Der Junge hatte immer gedacht, Woodsy sei einfach mitten in der Nacht aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, er sei zu stark, zu schön und zu herb, um seine Zeit mit so etwas Profanem wie Schlaf zu verschwenden, und ließe seine überschüssige Energie dann ab, indem er ein paar Zeilen aus The Last Roundup sang. Er sang die git alongs auf eine Art, die Sally zum Lachen brachte, und wenn er zu der Stelle kam, die von einem Ort im Himmel handelte, an dem die verlorenen Schäfchen eingesammelt und gebrandmarkt werden, wurde es Joe ganz schwer ums Herz, aber auf eine merkwürdig schöne Weise, und er musste sich zwingen, nicht aufzustehen und sich zu den beiden attraktiven Menschen im Schlafzimmer zu gesellen. Das war eine der ersten Sachen, die Joe darüber lernte, was man machen muss, wenn man mit einer Frau die Nacht verbringt: Man singt ihr etwas vor. Das schien eine ganz famose Sache zu sein, und zudem hatte auch das ganze Haus noch etwas davon.
Aber es war unausweichlich, dass Sally sich mit diesem beeindruckenden Mann zerstreiten oder dass irgendetwas anderes zwischen den beiden vorfallen würde – früher oder später fiel in ihren Beziehungen immer etwas vor. Joe blieb zurück und sehnte sich nach Woodsy, als wäre er sein verlorener Vater. Es war sicherlich seiner Zeit mit Woodsy Niles zu verdanken, dass Joe damit begann, sich selbst als eine Art Cowboy zu sehen.
Nach dem Ende dieser Liebesaffäre setzte eine hektische Zeit ein, in der Sally den Jungen sonntags mit in die Kirche nahm. An diesen Morgen in der Kirche gefiel ihr am besten, dass man sich in der Öffentlichkeit zeigen und auch am helllichten Tag herausputzen konnte. Sonst verbrachte sie den ganzen Tag im Schönheitssalon und hatte kaum Gelegenheit, sich zum Beispiel in den hübschen Hüten zu zeigen, die sie besaß. Und der Junge stand ihr auch gut; jeder, den sie trafen, sagte, sie sähen wie Mutter und Sohn aus – eine Illusion, die sie nicht nur um Jahre, sondern gleich um eine ganze Generation jünger zu machen schien.
Aber für Joe hatten diese Kirchgänge eine ganz andere Bedeutung: Nach der regulären Messe zogen sich die Erwachsenen für Kaffee und Kuchen in das Souterrain zurück, während die Kinder im Obergeschoss Religionsunterricht bekamen. Dieser Unterricht führte dazu, dass Jesus den Platz in Joes Herzen einnahm, der zuvor Woodsy Niles gehört hatte. Eine junge Dame mit freundlichen Augen voller Wärme und Humor brachte ihm bei, dass Jesus ihn liebte. Vor der Klasse stand immer eine Staffelei, auf der sich ein Gemälde befand, das Jesus zeigte, wie er mit einem Jungen spazieren ging. Man konnte nur die Rückseite des Kopfs des Jungen sehen, aber Joe hatte das Gefühl, dass er selbst und niemand anderes dieser Junge war. Im Unterricht sang man auch Lieder, Lieder über Jesus, darüber, wie er an deiner Seite geht, mit dir spricht und dir erklärt, dass du eines seiner Schäfchen bist. Und eines Tages erzählte die junge Lehrerin von den Ereignissen an einem bestimmten, schrecklichen Freitag im Leben dieses sanften bärtigen Mannes und verteilte dann kleine, farbige Bildchen von ihm, die sie behalten durften. Auf diesem Bild sah Jesus ihn direkt an, und seine Augen schienen zu sagen: »Weißt du, ich habe jede Menge Elend erlebt und habe in meinem Leben schlimm gelitten, aber es ist echt ein Trost, einen Cowboy wie dich zum Freund zu haben.« Oder etwas in der Art. Etwas jedenfalls, das Joe das Gefühl gab, eine starke, persönliche Bindung zum Leiden zu haben, das in diesen Augen zum Ausdruck kam und das in ihm den Wunsch weckte, dieses Leiden irgendwie zu lindern. Während er sich das Bild anschaute, fiel ihm auf, dass Jesus ohne seinen Bart ein so markantes Gesicht wie Woodsy hätte, und er begann sich zu fragen, ob zwischen den beiden Männern nicht noch andere Ähnlichkeiten bestehen könnten. Einige Nächte lang legte er einen Pfropfen Kautabak und eine Packung Camel vor das Jesusbild, das er auf seine Kommode gestellt hatte, und schaute jeden Morgen nach, ob jemand in der Nacht gekommen war, um eine zu rauchen oder etwas Kautabak zu kauen. Doch er fand immer alles unverändert vor. Und es dauerte nicht lange, bis er den Glauben daran vollends verloren hatte, dass es jemanden gab, der an seiner Seite ging, mit ihm sprach und ihm erklärte, dass er eines seiner Schäfchen sei. Jesus reihte sich bei den Menschen ein, die Joe niemals wiedersehen würde. Zusammen mit den drei blonden Frauen und Woodsy versteckte er sich irgendwo hinter den weißen Wolken im Himmel.
Der sommerliche Überschwang der Kirchenbesuche fand sein Ende, als sich Sally Buck einen neuen Beau anlachte, einen Fernsprechmechaniker. Er kam eines Nachmittags in ihren Salon, um ein Telefon anzuschließen, und sein breiter Ledergürtel, in dem seine schweren Werkzeuge steckten, saß tief um seine Hüften. Sally bekam große Augen, als sie ihn sah, und als der Mechaniker zu seinem Lastkraftwagen zurückkehrte, war er ihrem hübschen, kleinen grauäugigen Charme schon verfallen.
Im folgenden Jahr bekam Joe seine Großmutter kaum zu Gesicht. Er bekam überhaupt kaum jemanden zu Gesicht. In jenem Herbst seines vierzehnten Lebensjahrs wurde er von einer schweren Antriebslosigkeit in Besitz genommen, und noch vor Thanksgiving hatte er aufgehört, zur Schule zu gehen. Er war nicht mehr in der Lage, die nötige Energie aufzubringen, bis dorthin zu gelangen und dann nicht einzuschlafen. Auch einige andere Jungs mit einem ähnlichen Naturell wie Joe, Jungs, mit denen man nicht wirklich reden konnte, blieben in jenem Jahr nach und nach der Schule fern. Zwar blieben andere Schüler dem Sozialleben der Einrichtung erhalten, aber auch das konnte Joe nicht aus dem Haus locken, schließlich war er nie wirklich Teil jenes Soziallebens gewesen. Es war nicht so, dass ihn irgendjemand nicht gemocht hatte, aber es hatte auch niemand wirklich Notiz von ihm genommen. Er war einfach der Junge mit den großen Vorderzähnen gewesen (manchmal wurde er auch »Kaninchen-Buck« genannt), der Junge, der kaum etwas sagte, seine Hausaufgaben nie gemacht hatte und es immer irgendwie schaffte, sich auf eine Bank ganz hinten im Klassenzimmer zu setzen. Von Zeit zu Zeit suchten Beamte, die die Aufgabe hatten, Schulverweigerer zurück in die Schule zu holen, Sally in ihrem Salon auf, aber das hatte nie zur Folge, dass sie oder die Beamten wirklich etwas unternahmen, und Joe konnte machen, was er wollte. Er stand gegen Mittag auf, kämmte sich oft seine Haare, rauchte Zigaretten, aß Erdnussbutter und Sardinen und sah dabei zu, wie sich Abertausende Meter Film auf dem Fernsehgerät in Sally Bucks Wohnzimmer abspulten. Er ließ den Fernseher von zwölf bis weit nach Mitternacht laufen. Die Wahrheit war, dass er sich verwirrt und orientierungslos fühlte, wenn er das Gerät eine Zeitlang nicht in seiner Nähe hatte. Er brauchte die Bilder, die der Fernseher ausspuckte, brauchte sie dringend, und noch mehr war er auf die Geräusche angewiesen, die aus ihm drangen. Sein eigenes Leben machte kaum Geräusche, und er hatte den Eindruck, dass in der Stille etwas wirklich Bedrohliches lag: Es verbargen sich Feinde in ihr, die man nur mit lauten Geräuschen vertreiben konnte.
Außerdem waren im Fernsehen jede Menge blonde Frauen zu sehen, und jede von ihnen ähnelte den Frauen aus seinem eigenen Leben. Es kam ihm so vor, als befänden sie sich in jeder Postkutsche, jedem Planwagen, jedem Saloon und jedem Gemischtwarenladen, man musste nur lange genug warten: Die Schwingtür öffnete sich auf einmal oder irgendwann wurde der Vorhang beiseitegeschoben, und Claire Trevor, Barbara Stanwyck oder Constance Bennett erschien auf dem Bildschirm und sah, für jeden klar ersichtlich, so wie eine der blonden Frauen aus, die er so gut kannte. Und wer könnte denn schon der große Mann sein, der dort hoch im Sattel ritt, das Gesicht der Sonne zugewandt, mit einer markanten Kinnpartie, in der alles Gute und Gerechte zum Ausdruck kam, der Mann, der vor Härte, Kraft und Lebenswillen geradezu zu bersten schien und von allen möglichen Schauspielern gespielt werden konnte, egal ob es sich dabei nun um Tom Mix oder um Henry Fonda handelte? Nun, das konnte niemand anderes als Joe Buck selbst sein. In einem gewissen Sinne zumindest.
In der Zeit seiner Fernsehabhängigkeit geschah etwas Erstaunliches mit ihm. Tag für Tag und Stück für Stück und Gesichtszug um Gesichtszug wurde er so groß, stark und hübsch wie einer jener Fernsehcowboys. Eines Tages, der Sommer war gekommen und vergangen und dann wieder gekommen, entdeckte Joe, als er im Fluss schwamm, plötzlich, dass er sich nun selbst in einem Männerkörper bewegte. Er stieg aus dem Wasser, schaute an sich herunter und sah, wie sich unter den Schlammspritzern auf seinen starken Männerbeinen ein schimmernder, neuer Mann abzeichnete. Die Muskulatur seines Körpers und seiner Arme war nun voll ausgeformt, und auf seiner Brust und seinen Gliedmaßen war ein durchaus vorzeigbarer dunkler und maskuliner Haarwuchs zu verzeichnen. Diese plötzlichen Entdeckungen versetzten ihn in einen Zustand ungeheurer Aufregung, und er eilte auf seinem Fahrrad nach Hause, um sich die Sache in Sallys Schlafzimmerspiegel genauer anzuschauen. Ihm fiel auf, dass sich auch sein Gesicht verändert hatte: Die Konturen waren markanter geworden, und irgendwie hatte es sein Mund geschafft, genau die richtige Größe für seine großen Zähne zu erreichen, so dass aus ihnen ein glänzend, weißer körperlicher Vorzug geworden war.
Mit dem, was er im Spiegel sah, war er so zufrieden, dass er sich anzog, um durch das Viertel, in dem Sally und er wohnten, zu stolzieren, da er dachte, dass auch anderen Leuten auffallen würde, was mit ihm passiert war, und sie diese Entwicklung genauso bemerkenswert finden würden wie er. (Niemandem fiel etwas auf.) Dann besuchte er Sally in ihrem Schönheitssalon. »Ach du meine Güte, Schätzchen«, sagte sie, »diese Klamotten sehen ja schrecklich an dir aus, die sind dir viel zu klein geworden.«
»Nee«, widersprach er, »sind nicht kleiner als vorher.«
Sie sagte: »Oh, das sind sie wohl«, und gab ihm Geld, damit er sich neue Kleidung kaufen konnte.
Ein paar Stunden später marschierte Joe voller Stolz in einer leuchtend blauen Hose und einem orangenen Jackett durch die Straßen von Albuquerque. Seine rotbraunen Lederschnürschuhe hatten beschlagene Absätze. Sally sagte, die Farben würden sich vielleicht etwas beißen. »Aber du siehst wirklich süß aus. Hast du schon eine Freundin?«
Als er wieder zu Hause war, schaute er sich so lange im Spiegel an, dass seine überbeanspruchten Augen weh taten und sich anfühlten, als wären sie entzündet. Er fragte sich, was aus der Freude geworden war, die er noch vor ein paar Stunden beim Blick in den Spiegel gespürt hatte. Der neue Mann war immer noch da, seine ganze Schönheit noch intakt, aber irgendwie haftete dem Wunder, das er sah, jetzt etwas Säuerliches an, irgendwie war sein Hochgefühl abgeflaut und einem Gefühl des Elends gewichen. Und plötzlich wusste er auch, warum. An diesem Tag war etwas Entsetzliches über ihn gekommen: Ihm war bewusst geworden, wie einsam er war.
Joe hatte noch nie einen Freund gehabt, und er hatte keine Ahnung, was er tun musste, um sich mit jemandem anzufreunden. Er versuchte es, indem er sich eine Person aussuchte, die er mochte, und sich dann in der Hoffnung, dass sich eine Freundschaft entwickeln würde, besonders häufig in deren Nähe aufhielt. Er probierte diese Methode an folgenden Leuten aus: der Witwe des Lebensmittelhändlers, zwei Tankstellenwarten, dem Mädchen, das sich in der Rio Pharmacy um die Zahlungsanweisungen kümmerte, einem alten Schuhmacher aus einer Einwandererfamilie und einem Platzanweiser im World-Kino. Aber keiner schien zu begreifen, was er eigentlich von ihnen wollte. Nach und nach begann er zu verstehen, dass man sich mit einem Menschen auch unterhalten musste, wenn man eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen wollte. Aber Joe hatte selten wirklich etwas zu sagen, und wenn er gelegentlich ein paar Worte aus seinem Inneren hervorkramte, zeigten sich seine Zuhörer davon in der Regel unberührt und seine Bemühungen waren umsonst. Er war einfach nicht besonders gut im Reden. Seine besten Unterhaltungen führte er mit Sally, aber selbst diese Gespräche fanden vor allem zwischen Tür und Angel statt. Zum Beispiel, wenn er auf dem Badewannenrand saß und ihr dabei zusah, wie sie sich im Spiegel über dem Waschbecken schminkte. Der größte Teil ihrer Aufmerksamkeit kam dabei der anspruchsvollen Aufgabe zu, ihr Gesicht gut zwanzig Jahre jünger aussehen zu lassen, als es war, für ihren Enkelsohn blieb da nicht viel übrig.
Im Herbst, bevor er siebzehn wurde – seine Stimmung war von eben jenem Hunger nach Zuneigung und irgendeiner menschlichen Bindung geprägt –, verirrte er sich eines Abends in das World-Kino und begann ein kurzes, vergnügliches und verheerendes Verhältnis mit einem Mädchen namens Anastasia Pratt.
Der Name Anastasia Pratt war, obwohl das Mädchen selbst erst fünfzehn war, so etwas wie eine Legende unter den jungen Leuten Albuquerques. Solche Legenden beruhen selten allein auf Fakten: Ein Teil ihrer Entstehung verdankt sich in der Regel einem gewissen Erfindungsreichtum. Aber Anastasia Pratt verhielt sich seit ihrem dreizehnten Lebensjahr so, dass sich die Vorstellungskraft ihrer Umwelt in einer Art Schockstarre befand. Auch ein notorischer Schwätzer hätte ihr Auftreten nicht skurriler oder unglaublicher wirken lassen können, als er ohnehin war.
Man nannte sie Schnurschlag-Annie, ein Name, der auf die ordentliche Schlange verwies, in die sich die Jungs einreihen mussten, bis sie sie in der halben Stunde, in der sie ihnen ihren Körper zur Verfügung stellte, zügig befriedigen konnte.
Hinter der Leinwand des World-Kinos befand sich ein großer Raum, in dem die Buchstaben für die Leuchttafeln des Kinovordachs, die Uniformen für die Platzanweiser, Handtücher, Seife und alle möglichen anderen Vorräte und Gerätschaften aufbewahrt wurden. In einer Ecke des Raumes lagen Teppichreste, die von der letzten Renovierung des Kinos übrig geblieben waren. In dieser Ecke entstand die leibhaftige Legende von Anastasia Pratt. Sie mühte sich auch in verschiedenen Wohnzimmern, Schlafzimmern und geparkten Autos ab oder nachts auf dem Gelände von Schulen und bei gutem Wetter sogar unter freiem Himmel an bestimmten Highways in der Wüste. Aber es war dieser Stapel von Teppichresten im Lagerraum des World-Kinos, auf dem Anastasias Dienste am häufigsten und auch von den meisten Jungs in Anspruch genommen wurden.
Sie war weder hübsch noch unattraktiv, sondern wirkte eher wie ein ganz normales Schulmädchen, so normal, dass dieses Auftreten angesichts ihres tatsächlichen Verhaltens fast schon einstudiert wirkte. Sie trug die übliche Schulmädchenkleidung – Röcke, Blusen, Pullis, Söckchen und schwarz-weiße Lederhalbschuhe. Sie hatte kastanienbraune Haare, die sie glatt nach hinten kämmte und mit einer Haarspange zusammenhielt. Sie trug so gut wie kein Make-up, zupfte sich lediglich ein wenig die Augenbrauen und trug ein bisschen Lippenstift auf. Tagsüber sah man sie immer allein zur Schule gehen oder von dort kommen, die Schulbücher unter den Arm geklemmt und scheinbar so offenherzig, unbedarft und leicht verunsichert, wie es die meisten jungfräulich heranwachsenden Einzelgänger sind. Es gab keinen Grund, Anastasia Pratt eines zweiten Blickes zu würdigen, es sei denn, man wusste über ihre nächtlichen Aktivitäten Bescheid. Aber wenn man darüber Bescheid wusste, war der Gegensatz zwischen dem, was man sich vorstellte, und dem, was man sah, erstaunlich. Ein jugendlicher Witzbold beschrieb sie mal als Jungfrau Jekyll und Fräulein Hyde.
Trotz des Rufs des Mädchens gab es mindestens drei Menschen, die nichts von ihren Aktivitäten wussten. Zwei von ihnen waren natürlich ihre Eltern; ihr Vater war ein strenger, arbeitsamer und permanent gereizter Bankangestellter und ihre Mutter eine Truth-Church-Pianistin mit dünnen Lippen und verschlagenen Augen. Bei der dritten unwissenden Person handelte es sich bis zu einem gewissen Freitagabend im Oktober um Joe Buck.
Sie begegneten sich beim Wasserspender des Kinos. Joe ließ ihr den Vortritt und betätigte den Wasserhahn für sie. Sie trank, schaute ihn dankbar an und lächelte. Er lächelte zurück. Und sie sagte: »Möchtest du neben mir sitzen?«
Sie setzten sich an den Rand der Zuschauerreihen im oberen Drittel des Saals. Anastasia lehnte ihr Knie sofort an das von Joe und begann, es auf eine unverkennbar herausfordernde Weise hin und her zu bewegen. Plötzlich saßen sie Hand in Hand im Kino. Gerade als Joe anfing, sich über den Schweiß zu sorgen, der sich in seiner Handfläche sammelte, nahm sie seine Hand und führte sie zu ihren Schenkeln. Dann nutzte sie kühn ihre eigene Hand, um das Ausmaß seiner Erregung zu prüfen. Es war beträchtlich, und sie nahm sein Gesicht in ihre Hände und bat ihn, sie zu küssen. Joe hatte überhaupt nichts dagegen, es war nur so, dass er in der ganzen Aufregung nicht daran gedacht hatte. Aber in ihrer Bitte lag solch eine Dringlichkeit, solch eine Verzweiflung, dass sie, als er sie tatsächlich küsste, so fest an seinen Lippen sog, als sonderten sie ein lebenspendendes Elixier ab. Er hatte das Gefühl, er sei einer Person behilflich, die bei einem Unfall tödliche Verletzungen erlitten hatte, aber noch nicht tot war.
Eine Horde Jungs kam den Gang herunter und setzte sich hinter Joe und Anastasia Pratt.
Einer von ihnen sagte: »O Gott, Anastasia Pratt ist hier.«
»Machst wohl ’nen Witz«, sagte ein anderer.
Ein dritter fragte: »Wer ist der Typ?«
»Er küsst sie.«
»Ha, guckt mal, da küsst jemand Anastasia Pratt.«
»Wer ist das noch mal? Wer ist der Typ, der Annie küsst?«
»Hey, Annie, wen hast du denn da?«
Anastasia drehte sich um und sagte mit winselnder Stimme: »Halt den Mund. Bitte haltet den Mund. Lasst mich doch auch mal, ja?«
»Dich mal lassen? Ich lass’ dich gleich mal.«
»Hier, Annie, guck mal, ich hab’ was für dich.«
»Ich auch, Annie, wie gefällt dir der? Soll ich damit ein paarmal gegen deinen Sitz hauen? Bringt Glück.«
Joe begriff nicht, was gerade passierte. Er hatte hier im Kino viele Paare gesehen, die miteinander rummachten, aber man hatte sie immer in Ruhe gelassen. Er hatte Angst und war ziemlich durcheinander. Augenscheinlich hatte er in seiner ganzen Unerfahrenheit einen Fehler begangen, hatte aber nicht die leiseste Ahnung, worin dieser Fehler bestanden haben könnte. Und noch weniger wusste er, wie man sich in solch einer Situation am besten verhielt.
Einer aus der Gang stand auf, lehnte sich über die Sitzreihe und erkannte Joe Buck, weil er mit ihm zusammen auf der Grundschule gewesen war. »Ha, das ist Buck. Joe Buck«, erklärte er und setzte sich wieder.
Joe erkannte keine der Stimmen und hatte Angst, sich umzudrehen.
»Hey, Joe«, flüsterte eine dieser Stimmen plötzlich. »Wenn du mit Anastasia Pratt knutschst, schluckste am besten gleich ’ne ganze Apotheke, kein Witz. Hat schon jeden Schwanz in Albuquerque im Mund gehabt.« Die Stimme hatte nichts Feindseliges an sich, vielmehr klang sie freundlich und ein wenig mahnend. Joe drehte sich um und erblickte einen kleinen, dunklen Italiener, den er noch aus der Schule kannte. Er hieß Bobby Desmond.
Anastasia Pratt stand auf und stürmte den Gang zwischen den Sitzreihen hinunter. Die Jungshorde folgte ihr. Bevor er mit den anderen mitlief, hielt Bobby Desmond kurz inne, tippte Joe an die Schulter und sagte: »Na los, komm schon.«
Joe stand auf und folgte ihnen. Hinten im Saal standen sechs Jungen, alle noch im Schulalter, und versperrten dem Mädchen den Ausgang. Anastasia flehte sie halbherzig an, sie durchzulassen. Ein großer, schlaksiger blonder Junge mit pickligem Gesicht und einer großen Klappe sagte: »Hey, Annie, Gary Amberger ist hinten, und er möchte dich unbedingt sehen.«
»Ist er nicht«, sagte Annie, aber ihre Augen schienen zu sagen: »Wirklich? Gary?«
»Na dann ist er’s nicht. Ich geh’ und sag’ ihm, dass er nicht da sein soll.«
»Nee, ich sag’ doch, er ist nicht da«, antwortete Anastasia.
Und dann strömten sie alle, die Jungs und Anastasia Pratt, der Reihe nach einen der Gänge an der Seite des World-Kinos entlang und bewegten sich auf das rote Ausgangsschild links neben der Leinwand zu. Joe, der einfach Bobby Desmond folgte, befand sich am Ende der Reihe. Während sie durch den beiseitegeschobenen Vorhang unter dem Schild hindurchgingen, hörte er die Stimme irgendeiner Hollywoodschauspielerin aus den Lautsprechern, die verkündete: »Ich sage dir, diese Situation ist völlig außer Kontrolle geraten. Alles, was uns übrigbleibt, ist, so zu tun, als wäre nichts passiert.«
Die Jugendlichen stiegen nacheinander eine kurze Treppe hoch und gingen dann in den Lagerraum. Jemand machte das Licht an. Anastasia fragte: »Wo ist er denn? Wo ist Gary Amberger?«
Der große blonde Junge, dessen Name Adrian Schmidt war, antwortete: »Hier drüben bei den Teppichresten, Annie, bei den Teppichresten.« Und er ging in die Ecke des Lagerraumes, auf die er gezeigt hatte, und sagte: »Hi, Gare, Anastasia ist hier.«