Die andere Schwester
Wer zu lieben wagt
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Hedda Pänke
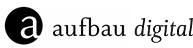
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine internationale Top-Bestseller-Autorin und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Pazifischen Nordwesten der USA und auf Hawaii.
Bei der Liebe meiner Schwester
Seit Jahren haben die Schwestern Claire und Meghann kaum Kontakt. Dann möchte Claire einen Mann heiraten, in den sie sich auf den ersten Blick verliebt hat. Davor will sie die ältere Meg unbedingt bewahren – ist sie doch selbst zu oft enttäuscht worden, als dass sie noch an Liebe glauben könnte. Ausgerechnet jetzt lernt Meg jemanden kennen, der es wert wäre, ihre Angst vor Nähe zu überwinden. Doch dann droht den Schwestern ein erneuter Verlust, und sie werden gezwungen, sich ihrer schwierigen Vergangenheit zu stellen.
Ein so kluger wie gefühlvoller Roman über zwei ungleiche Schwestern.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Die andere Schwester
Wer zu lieben wagt
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Hedda Pänke
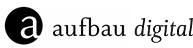
Inhaltsübersicht
Über Kristin Hannah
Informationen zum Buch
Newsletter
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Epilog
Danksagung
Impressum
Leseprobe aus: Kristin Hannah – Liebe & Verderben
Für meine Schwester Laura,
für meinen Vater Laurence.
Und – wie immer – für Benjamin und Tucker.
Ich liebe euch alle.
Wir sehen Dinge nicht, wie sie sind.
Wir sehen sie, wie wir sind.
Anaïs Nin
Wenn Liebe die Antwort ist, bitte ich darum,
die Frage neu zu formulieren.
Lily Tomlin

Geduldig wartete Dr. Harriet Bloom auf eine Antwort.
Meghann Dontess lehnte sich zurück und studierte ihre Fingernägel. Sie mussten manikürt werden. Dringend. »Wie Sie wissen, versuche ich, nicht allzu viel zu grübeln, Harriet. Das nimmt mir irgendwie die Lebensfreude.«
»Kommen Sie deshalb seit vier Jahren jede Woche zu mir? Weil Ihnen Ihr Leben so großen Spaß macht?«
»Darauf würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht hinweisen. Das spricht nicht gerade für Ihre fachliche Kompetenz. Schließlich ist es durchaus vorstellbar, dass ich zunächst völlig normal war und Sie mir nur einreden, ich wäre verrückt.«
»Sie versuchen wieder einmal, sich mit einer witzigen Bemerkung aus der Affäre zu ziehen.«
»Sie überschätzen mich. Das war nicht komisch.«
Harriet Bloom verzog keine Miene. »Ich kann auch nur sehr selten über Sie lachen.«
»Und dahin ist er, mein Traum von einer Karriere als Stand-up-Comedian.«
»Sprechen wir über den Tag, an dem Claire und Sie getrennt wurden.«
Unbehaglich rutschte Meghann auf ihrem Sessel herum und suchte nach einer schlagfertigen Antwort, mit der sie das Thema umgehen konnte. Aber es fiel ihr nichts ein. Sie wusste genau, worauf die Therapeutin hinauswollte, und das war auch Harriet Bloom klar. Wenn sie die Antwort verweigerte, würde die Frage einfach noch einmal gestellt werden. »Getrennt – was für eine nette, saubere Formulierung. Sie gefällt mir, sogar sehr, aber das Thema ist abgeschlossen.«
»Es ist immerhin interessant, dass Sie den Kontakt zu Ihrer Mutter aufrechterhalten, sich von Ihrer Schwester jedoch absolut distanzieren.«
Meghann zuckte mit den Schultern. »Meine Mutter ist Schauspielerin, ich bin Anwältin. Wir verdienen beide unseren Lebensunterhalt, indem wir uns verstellen.«
»Das heißt?«
»Kennen Sie vielleicht eins ihrer Interviews?«
»Nein.«
»Sie erzählt jedem von unserem bitterarmen, aber liebevollen Familienleben. Wir tun beide so, als wäre es wahr.«
»Sie wohnten doch in Bakersfield, als dieses angeblich bitterarme, aber liebevolle Familienleben endete, oder?«
Meghann schwieg. Harriet Bloom hatte es geschafft, sie in die schmerzliche Vergangenheit zurückzuführen wie eine dressierte Ratte.
»Claire war damals neun Jahre alt«, fuhr die Therapeutin fort. »Wenn ich mich recht erinnere, hatte sie eine Zahnlücke und in der Schule Probleme mit dem Rechnen.«
»Hören Sie auf.« Meghanns Hände krallten sich um die Armlehnen des Sessels.
Die Therapeutin sah sie an. Ihr Blick unter den dunklen Brauen war ernst und konzentriert. Die kleinen, runden Gläser der Brille vergrößerten ihre Augen. »Weichen Sie nicht aus, Meg. Wir machen Fortschritte.«
»Noch ein paar mehr dieser Fortschritte, und Sie können mich in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses einliefern lassen. Wir sollten lieber darüber sprechen, was mir das Leben wirklich schwer macht. Deshalb komme ich schließlich zu Ihnen. Mein Alltag im Familiengericht ist kaum noch zu ertragen, kann ich Ihnen versichern. Gestern fuhr allen Ernstes ein Typ mit einem Ferrari vor, um dann zu behaupten, er wäre total pleite. Dieser Mistkerl will einfach nicht für die Ausbildung seiner Tochter zahlen. Zu dumm für ihn, dass ich mitbekommen hatte, welchen heißen Schlitten er sich offenbar leisten kann.«
»Warum bezahlen Sie mich eigentlich, wenn Sie mit mir nicht über die Gründe für Ihre Probleme reden wollen?«
»Weil ich keine Probleme habe. Und es bringt absolut nichts, in der Vergangenheit zu stochern. Damals war ich sechzehn, jetzt steuere ich auf die zweiundvierzig zu. Es ist höchste Zeit, das alles ruhen zu lassen. Ich habe das Richtige getan. Mehr ist dazu nicht zu sagen.«
»Und warum haben Sie dann noch immer Albträume?«
Meghann spielte mit ihrem silbernen Armband. »Ich träume auch von Spinnen mit Oakley-Sonnenbrillen. Aber davon wollen Sie nie etwas hören. Oh, und in der letzten Woche habe ich geträumt, in einem gläsernen Raum gefangen zu sein, dessen Fußboden aus Speck bestand. Ich hörte Menschen weinen, konnte aber den Schlüssel nicht finden. Wie wäre es, wenn wir uns darüber unterhielten?«
»Das weist auf Gefühle von Isolation hin. Auf eine unbewusste Ahnung, dass sich Menschen über Ihre Handlungen aufregen oder Sie auch vermissen. Gut, reden wir über den Traum. Also, wer hat geweint?«
»Unsinn.« Meghann hätte es kommen sehen müssen. Schließlich hatte sie während des Studiums auch einen Kursus in Psychologie belegt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie in jungen Jahren als wahres Wunderkind galt.
Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Schade, Harriet. Die Zeit ist um. Ich schätze, wir müssen die Bewältigung meiner verflixten Neurosen auf die nächste Woche verschieben.« Sie stand auf und strich glättend über die Hosen ihres dunkelblauen Armani-Anzugs, obwohl auf ihnen kein Fältchen zu sehen war.
Betont langsam setzte die Therapeutin ihre Brille ab.
In einer unbewussten Geste der Selbstverteidigung verschränkte Meghann die Arme über der Brust. »Ich denke, wir sollten wirklich Schluss machen.«
»Gefällt Ihnen Ihr Leben, wie Sie es führen, Meghann?«
Damit hatte sie nicht gerechnet. »Was sollte mir daran denn nicht gefallen? Ich bin die beste Scheidungsanwältin im ganzen Staat. Ich lebe …«
»… allein.«
»… in einer piekfeinen Eigentumswohnung oberhalb von Public Market und fahre den neuesten Porsche.«
»Wie ist es mit Freunden?«
»Jeden Dienstagabend telefoniere ich mit Elizabeth.«
»Familie?«
Vielleicht war es an der Zeit, sich einen anderen Therapeuten zu suchen. Harriet hatte inzwischen mit untrüglicher Sicherheit alle ihre wunden Punkte herausgefunden. »Letztes Jahr war meine Mom eine Woche lang bei mir. Wenn ich Glück habe, besucht sie mich das nächste Mal gerade noch rechtzeitig, dass wir uns gemeinsam die Mars-Landung auf MTV anschauen können.«
»Und Claire?«
»Ich will nicht leugnen, dass meine Schwester und ich ein paar Problemchen miteinander haben. Aber das ist nichts Grundsätzliches. Wir sind einfach zu beschäftigt, um uns häufiger zu treffen.« Als Dr. Bloom schwieg, fuhr Meghann schnell fort: »Gut, gut, es bringt mich fast um den Verstand, wie sie ihr Leben vergeudet. Sie ist intelligent und hat das Zeug dazu, Karriere zu machen, aber sie scheint wild entschlossen, ihre Tage auf diesem schäbigen Campingplatz zu verplempern, den sie als Resort bezeichnet.«
»Bei ihrem Vater.«
»Ich möchte nicht über meine Schwester sprechen – und auf gar keinen Fall über ihren Vater.«
Dr. Bloom pochte mit dem Stift auf die Schreibtischplatte. »Nun gut, lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Wie lange ist es eigentlich her, dass Sie zweimal mit demselben Mann geschlafen haben?«
»Daran finden nur Sie etwas Verwerfliches. Ich mag Abwechslung.«
»So wie Sie jüngere Männer bevorzugen? Männer, die noch keinen Wunsch nach einer festen Bindung haben. Die Sie wieder abservieren, bevor sie sich von Ihnen trennen können.«
»Auch wenn ich mich wiederhole: Was ist falsch daran, sich mit jungen, sexy aussehenden Männern zu treffen? Ich sehne mich absolut nicht nach einem Häuschen im Grünen. Und an einer Familie bin ich auch nicht interessiert, aber ich mag Sex.«
»Und wie gefällt Ihnen die Einsamkeit?«
»Ich bin doch nicht einsam«, erklärte Meghann. »Ich bin unabhängig. Männer mögen nun mal keine starken Frauen.«
»Starke Männer schon.«
»Dann sollte ich vielleicht häufiger in Fitness-Center gehen statt in Bars.«
»Und starke Frauen stellen sich ihren Ängsten. Sie sprechen über die schmerzlichen Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen haben.«
Meghann zuckte sichtlich zusammen. »Tut mir leid, Harriet, aber ich muss jetzt wirklich los. Bis nächste Woche.«
Ohne sich umzusehen, verließ Meghann die Praxis.
Draußen war strahlender Sonnenschein. Erstaunlich für den so genannten Sommer in diesen Breiten. Während sich die Leute überall sonst im Juni längst am und im Wasser tummelten, im Freien grillten und zu Pool-Partys einluden, schaute man hier in Seattle üblicherweise verdrossen auf den Kalender und murrte, schließlich sei es doch Juni, verdammt noch mal …
Nur wenige Touristen waren an diesem Morgen unterwegs; man erkannte sie an den Regenschirmen, die sie unter die Arme geklemmt hatten.
Meghann holte tief Luft, überquerte die Straße und betrat den Rasen des Uferparks. Ein hoher Totempfahl begrüßte sie. Hinter ihm segelten Möwen träge durch die Luft und warteten auf ein paar Essensbrocken.
Sie kam an einer Parkbank vorbei, auf der ein Mann unter vergilbten Zeitungen schlief. Vor Meghann erstreckte sich der tiefblaue Puget Sound bis zum blassen Horizont. Sie wünschte, der Anblick könnte sie aufmuntern, ihr Kraft und Zuversicht geben wie sonst so oft. Doch heute wanderten ihre Gedanken in eine andere Zeit und zu einem anderen Ort.
Wenn sie die Augen schließen würde – was sie natürlich nicht wagte –, käme alles wieder: das Wählen der Telefonnummer, das stockende, unbeholfene Gespräch mit einem Mann, den sie nicht kannte, die lange, schweigsame Autofahrt zu der trostlosen Kleinstadt im Norden. Und am schlimmsten von allem: Sie würde wieder die Tränen sehen, die ihrer kleinen Schwester über die Wangen liefen, als sie sagte: »Ich kann nicht bleiben, Claire.«
Meghanns Finger verkrampften sich fester um das Geländer des Uferweges. Dr. Harriet Bloom irrte sich. Ein Gespräch über Meghanns verhängnisvolle Entscheidung und die einsamen Jahre, die ihr folgten, würde, ja konnte ihr nicht helfen.
Ihre Vergangenheit war keine Ansammlung von Erinnerungen, die aufgearbeitet werden konnten. Sie war wie ein übergroßer Samsonite-Koffer mit kaputten Rädern. Das hatte Meghann schon vor langer Zeit begriffen. Sie konnte ihn nur hinter sich herschleifen.

Jedes Jahr im November schwoll der Skykomish River bedrohlich an. Die Gefahr der Überflutung war allgegenwärtig. Gespannt beobachteten die Menschen in den kleinen Ortschaften am Fluss das Ansteigen der Flut und hielten Sandsäcke in Bereitschaft. Ihre Erinnerung reichte Generationen zurück. Jeder konnte Geschichten davon erzählen, wie das Wasser ins Obergeschoss des Hauses der Familie Soundso drang, durch die Flure von Grange Hall strudelte, die Ecke Spring und Azalea Street überflutete. Die Bewohner weniger gefährdeter Gegenden saßen in ihren trockenen Wohnzimmern auf der Couch, sahen sich kopfschüttelnd die Nachrichten im Fernsehen an und fragten sich, wie verrückt man sein musste, um freiwillig mit den Überflutungen zu leben.
Wenn der Wasserspiegel schließlich wieder zu sinken begann, durchlief ein kollektiver Seufzer der Erleichterung die kleine Stadt. Üblicherweise nahm er bei Emmett Mulvaney seinen Anfang, dem Apotheker, der wie gebannt vor dem einzigen Großbildschirm in ganz Hayden hockte und den Weather Channel rund um die Uhr nicht aus den Augen ließ. Er witterte bereits die kleinsten Veränderungen, die selbst den klugen Meteorologen in Seattle entgingen, und teilte seine Beobachtungen dem Sheriff Dick Parks mit, der sie prompt an seine Sekretärin Martha weitergab. In kürzerer Zeit, als man benötigte, um den Ort mit dem Auto zu durchqueren, verbreitete sich die frohe Botschaft: »Sieht so aus, als wären wir diesmal glimpflich davongekommen. Die größte Gefahr ist vorbei.« Und rund vierundzwanzig Stunden nach Emmett Mulvaneys Vorhersage stimmten auch die Meteorologen für gewöhnlich dieser Einschätzung zu.
Aber heute, an diesem herrlichen Frühsommertag, war es leicht, die herbstlichen Regenfälle zu vergessen, die die Menschen am Skykomish River vor Sorgen fast um den Verstand brachten.
Claire Cavenaugh stand am Flussufer. Ihre Stiefel steckten fast knöcheltief im weichen braunen Schlamm. Sie hatte ihre Hacke sinken lassen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wie jedes Jahr wollte sie kaum glauben, welcher Anstrengungen es bedurfte, das Resort auf die Sommersaison vorzubereiten.
Das Resort …
So nannte ihr Vater Sam Cavenaugh den Besitz von sechzehn Morgen Land. Er hatte das Grundstück vor fast vierzig Jahren für einen Apfel und ein Ei erworben, zu einer Zeit, als Hayden kaum mehr war als eine Tankstelle auf dem Weg zum Stevens Pass. Er bezog das dazugehörende baufällige Farmhaus, gab seiner Immobilie den Namen River’s Edge Resort und begann von einem Leben ohne Plastikhelm, Ohrenschützer und die Nachtschichten zu träumen, die bei seinem Job in der Papierfabrik in Everett an der Tagesordnung waren.
Zunächst arbeitete er nur in seiner Freizeit und an den Wochenenden. Mit einem Pick-up, einer Kettensäge und einem Plan, den er auf eine Papierserviette gezeichnet hatte. Unermüdlich rodete er jahrzehntealtes Strauchwerk und errichtete eigenhändig eine Reihe von Blockhütten. Inzwischen war River’s Edge ein blühendes, kleines Familienunternehmen. Es gab insgesamt acht Ferienhäuser – jedes verfügte über ein nettes Wohnzimmer, zwei Schlafräume, ein Bad und eine Terrasse mit Blick auf den Fluss.
In den letzten Jahren waren ein Swimmingpool und ein separater Vergnügungsbereich hinzugekommen. Pläne für einen Minigolfplatz und Waschautomaten warteten noch auf ihre Verwirklichung. Es war eine Ferienanlage, in die Familien Jahr für Jahr gern zurückkehrten, um dort ihre kostbaren Urlaubswochen zu verbringen.
Claire konnte sich noch gut an ihre Ankunft in River’s Edge erinnern. Die hoch aufragenden Bäume und der silbern funkelnde Fluss erschienen dem Mädchen, das in einem Wohnwagen aufgewachsen war, wie das Paradies. Von der Zeit davor waren ihr nur düstere Bilder im Gedächtnis geblieben: schäbige Trailerparks am Rande von hässlichen Ortschaften, noch hässlichere Wohnungen in heruntergekommenen Gebäuden. Und Bilder von Mama, die immer vor irgendetwas auf der Flucht zu sein schien. Mama hatte mehrmals geheiratet, aber Claire konnte sich nicht entsinnen, dass ein Mann länger als wenige Wochen geblieben wäre. Meghann war die einzige Konstante, an die Claire sich erinnerte. Ihre größere Schwester, die für alles sorgte – und dann eines Tages verschwand und Claire zurückließ.
Und jetzt, nach all diesen Jahren, war ihre Beziehung nicht nur lose, sondern praktisch nicht existent. Höchstens alle paar Monate einmal telefonierten Claire und Meg miteinander und fanden an manchen dieser Tage kein anderes Gesprächsthema als das Wetter. Dann bekam Meg unweigerlich einen anderen, wichtigen Anruf und hängte auf. Ihre Schwester verbreitete sich gern über ihre beruflichen Erfolge und hielt Claire vor, ihr Leben »auf einem lächerlichen, kleinen Campingplatz« zu vergeuden, indem sie für fremde Leute putzte. Jedes Jahr zu Weihnachten bot sie Claire an, ihr ein Studium zu bezahlen.
Als würde die Lektüre von Beowulf Claires Leben verbessern.
Jahrelang hatte Claire sich danach gesehnt, dass sie nicht nur Schwestern wären, sondern Freundinnen, aber das wollte Meghann nicht, und die größere Schwester setzte sich immer durch. Und so waren sie Meghanns Wunsch entsprechend zwei Fremde, die nur zwei Dinge gemeinsam hatten: die gleiche Blutgruppe und eine trostlose Kindheit.
Sie hob die Hacke auf und marschierte langsam zum geparkten Pick-up. Auf dem Weg fielen ihr unzählige Dinge ein, die bis zur Resort-Eröffnung unbedingt noch zu erledigen waren. Rosen mussten beschnitten und Moosbelag von den Schindeldächern entfernt werden. Und der Rasen musste dringend gemäht werden. Ein langer, nasser Winter war in einen überraschend sonnigen Frühling übergegangen, und inzwischen reichte das Gras Claire bis an die Knie. Sie nahm sich vor, George zu bitten, am Nachmittag die Kanus und Kajaks zu schrubben.
Claire warf die Hacke auf den Pick-up. Scheppernd landete sie auf der rostigen Ladefläche.
»Hey, Schätzchen. Fährst du in die Stadt?«
Claire drehte sich um und entdeckte ihren Vater auf der Veranda der Rezeption. Er steckte in einem ölfleckigen Overall und einem Flanellhemd.
Er zog ein rotes Taschentuch aus der Gesäßtasche, wischte sich über die Stirn und kam auf sie zu. »Ich beschäftige mich übrigens gerade mit der Tiefkühltruhe. Komm mir also nicht auf den Gedanken, eine neue anschaffen zu wollen.«
Es gab nichts, was er nicht reparieren konnte, dennoch hatte Claire vor, sich nach Angeboten zu erkundigen. »Brauchst du denn irgendwas?«
»Smitty hat ein Ersatzteil für mich. Könntest du es vielleicht abholen?«
»Mach ich. Wenn George auftaucht, kann er sich schon mal die Kanus vornehmen.«
»Ich werd’s ihm ausrichten.«
»Und Rita soll sich die Decken in Blockhütte sechs vorknöpfen. Da haben sich während des Winters ein paar Moderflecke gebildet.« Claire verriegelte die Ladeklappe des Pick-ups.
»Kann ich zum Abendessen mit dir rechnen?«
»Kaum. Ali hat ein Spiel im Riverfront Park. Es beginnt um fünf.«
»Ach ja. Ich werde pünktlich sein.«
Sie nickte. Natürlich würde er. Er hatte sich noch kein einziges Ereignis im Leben seiner Enkeltochter entgehen lassen.
Claire packte den Türgriff des Pick-ups und zerrte. Ächzend ging die Tür auf. Sie streckte die Hand nach dem Steuerrad aus und hievte sich auf den Fahrersitz.
Dad schlug die Tür hinter ihr zu. »Fahr mir bloß nicht zu schnell. Sieh dich vor allem an dieser vertrackten Kurve vor.«
Sie musste lächeln. Genau diesen Rat hörte sie seit zwei Jahrzehnten immer wieder. »Ich hab dich lieb, Dad.«
»Ich dich auch. Und jetzt los, bring mir meine Enkeltochter. Wenn du dich beeilst, haben wir vor dem Spiel noch Zeit, uns SpongeBob SquarePants anzusehen.«

Das Bürogebäude bot einen atemberaubenden Ausblick auf den Puget Sound und Bainbridge Island. In der Dunkelheit konnte man zwischen den Bäumen auf der anderen Seite hier und da ein paar Lichter funkeln sehen, aber am Tag wirkte die Insel unbewohnt. Nur die weiße Fähre, die im Stundentakt hinübertuckerte, wies darauf hin, dass auf dem dicht bewaldeten Eiland Menschen lebten.
Meghann saß hinter einem langen, nierenförmigen Konferenztisch. Die schimmernde Oberfläche aus Kirsch- und Ebenholz verriet Geschmack und Geld. Vor allem Geld. Einen Tisch von dieser Qualität und Beschaffenheit bekam man nicht im Sonderangebot. Er war von einem Innenarchitekten entworfen und handgefertigt – was auch auf die Wildledersessel zutraf. Für jeden, der an diesem Tisch Platz nahm und einen Blick durch die Panoramafenster auf das weite Blau warf, war die Botschaft unmissverständlich: Wer dies Büro besaß, musste verdammt erfolgreich sein.
Und so war es auch. Meghann hatte alle ihre Ziele erreicht. Als sie vor vielen Jahren mit dem Studium begann, hatte sie es gewagt, von einem besseren Leben zu träumen. Inzwischen war dieser Traum Wirklichkeit. Ihre Kanzlei zählte zu den bekanntesten der Stadt und genoss einen ausgezeichneten Ruf. Ihr gehörte eine elegante Eigentumswohnung mitten im Zentrum von Seattle (ein eklatanter Gegensatz zu dem erbärmlichen Wohnwagen, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte), und sie brauchte für niemanden zu sorgen.
Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Zwanzig nach vier.
Ihre Klientin verspätete sich.
Man sollte doch meinen, dass ein Honorar von über dreihundert Dollar die Stunde die Leute zur Pünktlichkeit anregte.
»Miss Dontess?«, kam eine Stimme über die Gegensprechanlage.
»Ja, Rhona?«
»Ihre Schwester möchte Sie sprechen.«
»Stellen Sie sie durch. Aber sagen Sie mir sofort Bescheid, wenn May Monroe eintrifft.«
»Selbstverständlich.«
Meghann nahm den Hörer ab und zwang sich zu einem liebevollen Unterton. »Claire! Wie schön, dich zu hören.«
»Du könntest ja auch mal anrufen. Oder hast du die Nummer verlegt? Wie geht es dir so? Wie lebt es sich im Geldparadies?«
»Angenehm. Und in Hayden? Warten alle noch immer gespannt darauf, dass der Fluss über die Ufer tritt?«
»Diese Gefahr ist bis zum Herbst erst einmal gebannt.«
»Gut.« Meghann stand auf und blickte zum Fenster hinaus. Unter ihr luden gewaltige orangefarbene Kräne Container auf einen Frachter. Sie zermarterte sich das Hirn, worüber sie mit ihrer Schwester reden sollte. Sie teilten die Vergangenheit, doch das war alles, was sie verband. »Und wie geht es meiner bezaubernden Nichte? Hat ihr das Skateboard gefallen?«
»Sehr sogar.« Claire lachte. »Aber manchmal solltest du vielleicht doch eine Verkäuferin um Rat fragen, Meg. Nicht jedes Kind kann schon mit fünf perfekt die Balance halten.«
»Du schon. Damals haben wir in Needles gewohnt, und ich habe dir beigebracht, wie man ohne Stützräder fährt.« Sofort wünschte sich Meghann, das nicht erwähnt zu haben. Es tat immer ein bisschen weh, sich an frühere Zeiten zu erinnern. Für eine lange Reihe von Jahren war Claire für sie mehr eine Tochter als eine Schwester gewesen, für die sie besser sorgte, als Mama es je getan hatte.
»Kauf ihr das nächste Mal einfach eine Disney-Kassette. Du brauchst nicht so viel Geld für sie auszugeben. Sie freut sich schon über Polly Pocket.«
Was immer das wieder sein mochte. Ein unbehagliches Schweigen breitete sich aus. Meghann sah auf ihre Armbanduhr, dann sprachen beide gleichzeitig.
»Und was wirst du …?«
»Freut sich Alison schon auf die Schule?«
Hastig kniff Meghann die Lippen zusammen. Sie wusste, dass Claire es hasste, wenn ihr jemand ins Wort fiel. Und ganz besonders hasste sie es, wenn Meg ein Gespräch dominierte.
»Ja. Ali ist schon wahnsinnig aufgeregt. Obwohl sie gern in den Kindergarten geht, kann sie den Herbst kaum erwarten. Dauernd redet sie davon. Manchmal kann ich sie kaum bändigen. Ständig ist sie in Bewegung, selbst nachts im Schlaf.«
Du warst genauso, hätte Meg fast gesagt, biss sich aber noch rechtzeitig auf die Zunge. Sie wünschte, die Erinnerungen verdrängen zu können.
»Was macht die Arbeit?«
»Ich kann nicht klagen. Und wie geht es auf dem Campingplatz?«
»Es ist ein Resort. In gut zwei Wochen wollen wir öffnen. Eine Familie hat sich mit zwanzig Gästen angemeldet.«
»Eine Woche ohne Telefon und Fernsehen? Warum kommt mir da nur die Titelmusik zu Deliverance in den Sinn?«
»Es gibt eben Familien, die gern zusammen sind«, entgegnete Claire spitz.
»Entschuldige. Tut mir leid. Ich weiß schließlich, wie sehr du das River’s Edge liebst. Aber hör mal«, fügte sie hinzu, als wäre ihr gerade eine Idee gekommen, »warum leihst du dir nicht von mir ein wenig Geld und baust eine hübsche Wellness-Anlage? Oder noch besser – ein schickes, kleines Hotel? Fitness-Urlaube sind unglaublich angesagt. Den nötigen Schlamm habt ihr schließlich direkt vor eurer Haustür.«
Claire seufzte laut vernehmlich. »Verdammt, Meg, du musst mich nicht ständig daran erinnern, wie erfolgreich du bist. Im Gegensatz zu mir.«
»So habe ich es doch gar nicht gemeint. Aber ich weiß nun mal, dass man ohne Kapital schlecht expandieren kann.«
»Ich brauche dein Geld nicht, Meg. Wir brauchen es nicht.«
Ein höchst überflüssiger Hinweis … »Tut mir leid, falls ich etwas Falsches gesagt habe. Ich wollte dir nur helfen.«
»Ich bin nicht mehr das kleine Mädchen, das von seiner großen Schwester beschützt werden muss, Meg.«
»Sam hat schon immer gut für dich gesorgt.« Meghann hörte selbst, wie bitter das klang.
»So ist es.« Claire schwieg kurz, holte Luft. Meghann wusste, dass ihre Schwester um Gelassenheit rang. »Ich fahre ein paar Tage an den Lake Chelan«, sagte sie schließlich.
»Oh, der jährliche Ausflug mit deinen Freundinnen.« Meghann war dankbar für den Themenwechsel. »Wie nennt ihr euch doch gleich? Die Bluesers?«
»Yeah.«
»Und ihr fahrt tatsächlich jedes Mal an den gleichen Ort?«
»Wie in jedem Sommer seit der High School.«
Meghann fragte sich, wie es sein musste, einen Kreis so enger Freundinnen zu haben. Wäre sie ein anderer Frauentyp gewesen, hätte sie vielleicht etwas wie Neid empfunden. Wie auch immer – für Ausflüge mit einer Frauentruppe hätte sie ohnehin keine Zeit. Und sie konnte sich nicht vorstellen, mit Frauen befreundet zu sein, die sie schon von der High School kannte. »Nun, dann wünsche ich dir viel Spaß.«
»Oh, den werden wir haben. In diesem Jahr will Charlotte …«
Die Sprechanlage summte. »Meghann? May Monroe ist da.«
Dem Himmel sei Dank. Ein Vorwand, das Gespräch zu beenden. Claire konnte endlos über ihre Freundinnen faseln. »Verdammt. Entschuldige, Claire, aber ich muss auflegen.«
»Macht nichts. Ich weiß, wie gern du Geschichten von meinen Versager-Freundinnen hörst.«
»Darum geht es nicht. Eine Klientin ist gerade gekommen.«
»Ja, sicher. Bis dann, Meg.«
»Bis dann.« Meghann legte den Hörer in dem Moment auf, als ihre Sekretärin Mrs Monroe in den Raum führte.
»Guten Tag, May«, lächelte Meg und ging auf ihre Klientin zu. »Vielen Dank, Rhona. Wir möchten nicht gestört werden, bitte.«
Die Sekretärin nickte, verließ das Zimmer und zog die Tür hinter sich zu.
Meghanns Klientin blieb vor dem großen Ölgemälde an der Wand stehen, einem Original von Nechita mit dem Titel »Wahre Liebe«. Die Ironie entging Meghann durchaus nicht. Hier in diesem Raum fand die wahre Liebe an jedem Tag der Woche ihr trauriges Ende.
May Monroe trug ein schlichtes schwarzes Jerseykleid und schwarze Schuhe, die seit mindestens fünf Jahren aus der Mode waren. Ihre blonden Haare waren zu einem pflegeleichten Bob geschnitten und fielen ihr glatt auf die Schultern. Ihr Ehering war ein einfacher, schmaler Goldreif.
Wer sie so sah, käme kaum auf den Gedanken, dass ihr Mann einen schicken Mercedes fuhr und seine Dienstagnachmittage regelmäßig auf dem Broadway Golf Course verbrachte. Vermutlich hatte May Monroe seit Jahren kein Geld für sich ausgegeben. Anspruchslos und bescheiden wie früher, als sie in einem Restaurant schuftete, um ihrem Mann das Zahnarztstudium zu finanzieren. Sie war kaum älter als Meghann, aber eine melancholische Resignation hatte Spuren hinterlassen. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen.
»Bitte nehmen Sie doch Platz, May.«
May Monroe zuckte zusammen und setzte sich irgendwie ruckhaft in Bewegung, wie eine Marionette. Sie hockte sich auf den Rand eines der bequemen schwarzen Wildledersessel.
Meghann ließ sich wie immer an der Stirnseite des Tisches nieder. Vor ihr lag ein Stapel Aktenordner. Sie trommelte mit den Fingern auf die Unterlagen und fragte sich, wie sie anfangen sollte. Aus Erfahrung wusste sie, dass Reaktionen auf unangenehme Nachrichten sehr unterschiedlich ausfallen konnten. Ihre Instinkte sagten ihr, dass May Monroe sich an Hoffnungen klammerte, dass sie sich mit dem Unvermeidlichen längst nicht abgefunden hatte. Obwohl ihr Mann die Scheidung schon vor Monaten eingeleitet hatte, glaubte May noch immer nicht, dass er sie auch tatsächlich durchziehen würde.
Nach diesem Zusammensein würde sie es glauben.
Meghann sah ihre Klientin an. »Wie ich Ihnen bei unseren letzten Treffen bereits andeutete, habe ich durch einen privaten Ermittler ein paar Nachforschungen über die finanzielle Situation Ihres Mannes anstellen lassen.«
»Das war sicher reine Zeitverschwendung, oder?«
Ganz gleich, wie oft sich so etwas in diesem Zimmer auch wiederholte – es wurde nicht leichter. »Nicht ganz.«
May Monroe starrte sie schweigend an, stand dann auf und trat vor das silberne Kaffeeservice auf dem Sideboard. »Okay«, sagte sie nach einer Weile, ohne sich jedoch umzudrehen. »Und was haben Sie herausgefunden?«
»Er besitzt mehr als sechshunderttausend Dollar auf den Cayman Islands. Das Konto lautet auf seinen Namen. Vor sieben Monaten hat er das Rücklagenkonto für die Abzahlung Ihres Hauses gekündigt. Möglicherweise glaubten Sie, irgendwelche Refinanzierungsunterlagen zu unterzeichnen?«
May drehte sich um. Die Kaffeetasse in ihrer Hand klirrte. »Ich kann mich nicht mehr erinnern.«
»Im Gegensatz zu ihm vermutlich. Er hat sich das Guthaben auf sein Konto überweisen lassen.«
»O mein Gott«, flüsterte May Monroe.
Meghann konnte förmlich sehen, wie Mays Welt in sich zusammenbrach. Alles Leben wich aus dem Blick ihrer grünen Augen.
Es war ein Moment, mit dem sich in diesen Zeiten viele Ehefrauen konfrontiert sahen – der Erkenntnis, dass ihre Männer ihnen fremd waren und alle ihre Träume keinen Bezug zur Realität hatten.
»Es kommt noch schlimmer«, fuhr Meghann fort und suchte vergebens nach schonenden Worten. »Er hat die Praxis an seinen Partner Theodore Blevin verkauft. Für einen Dollar.«
»Aber warum sollte er so etwas tun? Die ist doch …«
»Damit Sie nicht die Hälfte des Praxiswertes erhalten, auf die Sie sonst Anspruch hätten.«
Jetzt schienen Mays Beine ihr endgültig den Dienst zu verweigern. Abrupt sank sie auf einen Sessel und setzte ihre Tasse ab. Kaffee schwappte auf die glänzende Tischplatte. Sofort griff May nach einer Serviette. »Oh nein, entschuldigen Sie …«
Meghanns Finger schlossen sich um das Handgelenk ihrer Klientin. »Lassen Sie das. Bitte. Und Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.« Sie stand auf, schnappte sich ihrerseits ein paar Servietten und wischte die Kaffeepfütze vom Tisch. »Ich bedauere wirklich, Ihnen das alles sagen zu müssen, May. Ich erlebe so etwas leider immer wieder, und jedes Mal macht es mich ganz krank.« Sanft legte sie eine Hand auf die Schulter der Frau.
»Finden sich in Ihren Unterlagen auch Gründe dafür, warum er mir das angetan hat?«
Meghann wünschte sich, die Antwort darauf nicht zu wissen. Zögerlich griff sie in ihre Akten und holte ein Schwarzweißfoto heraus. So behutsam, als handele es sich um Sprengstoff, schob sie es May Monroe zu. »Sie heißt Ashleigh.«
»Ashleigh Stoker. Jetzt weiß ich, warum er Sarah immer so bereitwillig vom Klavierunterricht abgeholt hat.«
Meghann nickte. Wenn die Ehefrau die Geliebte kannte, war es immer noch schlimmer. »Im Staat Washington wird nicht mehr nach dem Schuldprinzip geschieden, das heißt, es braucht kein Fehlverhalten des Ehepartners nachgewiesen zu werden. Daher ist seine Affäre für die Scheidung belanglos.«
May hob den Kopf und starrte sie an. Der glasige Blick ihrer Augen erinnerte an ein Unfallopfer. »Belanglos?« Sie schloss die Augen. »Ich bin eine Idiotin.« Die Worte waren mehr gehaucht als gesprochen.
»Nein. Sie sind eine treue und loyale Frau, die einem verantwortungslosen, egoistischen Kerl zehn Jahre lang das Studium ermöglicht hat, damit er ein besseres Leben führen kann.«
»Eigentlich sollten wir ein besseres Leben haben.«
»Natürlich …«
Meg streckte den Arm aus und berührte Mays Hand. »Sie haben einem Mann voll vertraut, der Ihnen einmal geschworen hat, dass er Sie liebt. Jetzt rechnet er fest damit, dass Sie auch weiterhin die selbstlose, verständnisvolle Seele sind. Die Frau, die ihre Familie an die erste Stelle setzt und Herrn Doktor Dale Monroe das Leben so bequem wie möglich macht.«
May Monroe schien verwirrt, vielleicht sogar ein wenig eingeschüchtert. Meghann konnte das gut nachvollziehen. Frauen wie May wussten sich längst nicht mehr zu behaupten.
Aber das machte nichts. Das war schließlich ihre Aufgabe als Anwältin.
»Was werden wir unternehmen? Ich möchte den Kindern nicht wehtun.«
»Er tut ihnen weh, May. Er hat sie bestohlen. Und Sie auch.«
»Aber er ist ein guter Vater.«
»Dann muss er sich wünschen, dass sie gut versorgt sind. Wenn er auch nur einen Funken Anstand besitzt, wird er sich von der Hälfte des Familienvermögens trennen.«
May Monroe kannte die Wahrheit, die Meghann nur vermutete. Ein Mann wie Dale Monroe teilte nicht gern. »Und wenn er es nicht tut?«
»Nun, dann müssen wir ihn eben dazu zwingen.«
»Er wird außer sich sein.«
Meghann beugte sich vor. »Er? Dazu hätten wohl Sie weit mehr Anlass. Dieser Mann hat Sie belogen, betrogen und bestohlen.«
»Er ist und bleibt der Vater meiner Kinder«, entgegnete May mit einer Gelassenheit, die Meghann schier auf die Palme brachte. »Ich will keine Schlammschlacht. Vielmehr möchte ich ihm zu verstehen geben, dass er jederzeit zurückkommen kann.«
Oh, May …
Meghann wählte ihre Worte mit Bedacht. »Wir werden nichts anderes als fair sein, May. Ich habe durchaus nicht vor, jemanden auszunehmen oder über den Tisch zu ziehen, aber ich werde auch nicht zulassen, dass Sie arm und mittellos auf der Strecke bleiben. Basta. Schließlich ist er ein sehr wohlhabender Zahnarzt. Eigentlich sollten Sie Armani tragen und einen Porsche fahren.«
»Das wollte ich noch nie.«
»Und vielleicht werden Sie es auch nie tun, aber es ist meine Aufgabe, Ihnen zumindest die Chance dazu offenzuhalten. Mir ist bewusst, wie kalt und hart sich das im Moment anhört, aber wenn Sie sich bis zur Erschöpfung mit der Erziehung Ihrer Kinder abrackern, während Ihr Herr Doktor in einem schnittigen Mercedes herumfährt und die Nächte mit einer sechsundzwanzigjährigen Klavierlehrerin durchtanzt, werden Sie noch froh sein, sich etwas leisten zu können. Glauben Sie mir.«
May Monroe blickte sie an. Die Skepsis in ihren Augen war unübersehbar. »Okay.«
»Ich werde nicht zulassen, dass er Ihnen weiterhin wehtut.«
»Glauben Sie wirklich, dass mich juristische Erfolge und eine gewisse Summe Geld auf der Bank davor bewahren?« Sie seufzte. »Gut, Miss Dontess, unternehmen Sie alles, was Sie für die Absicherung meiner Kinder für nötig halten. Aber tun Sie bitte nicht so, als könnten Sie mir eine schmerzfreie Scheidung garantieren. Es tut ja jetzt schon so weh, dass ich kaum atmen kann, und dabei hat es gerade erst angefangen.«

Über dem sonnenverbrannten Präriegras ragten Windräder in den wolkenlosen Himmel. Langsam und stetig drehten sich ihre Metallflügel. Manchmal, bei günstigem Wetter, konnte man sogar das dumpfe Knacken der Rotoren hören.
Aber heute war es zu heiß, um mehr zu vernehmen als den eigenen Herzschlag.
Mit einer Dose inzwischen lauwarmer Cola stand Joe Wyatt auf der betonierten Fläche vor dem Lagerhaus.
Er blickte zu den Feldern hinüber und wünschte sich, dort zwischen den Bäumen entlanglaufen, den Duft der Erde und heranwachsender Früchte riechen zu können.
Vielleicht würde da drüben sogar ein leichter Wind wehen und die stickige Schwüle aus der Luft vertreiben. Hier brannte die Sonne geradezu gnadenlos auf das Metall des Lagerhauses herunter. Schweiß stand ihm auf der Stirn, lief ihm in Rinnsalen unter seinem T-Shirt den Rücken herunter.
Die Hitze machte ihn schon jetzt völlig fertig, dabei war es gerade einmal Mitte Juni. An den Hochsommer im Yakima Valley wagte er nicht einmal zu denken. Es war an der Zeit, die Zelte abzubrechen.
Die Erkenntnis deprimierte ihn.
Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie lange er noch ziellos von Ort zu Ort ziehen konnte. Die Einsamkeit setzte ihm zu, machte ihn zu einem ruhelosen Schatten seiner selbst. Unglücklicherweise gab es keine Alternative.
Früher einmal – und das schien Urzeiten her zu sein – hatte er gehofft, irgendwann an einen Ort zu kommen, der für ihn so etwas wie ein Zuhause werden könnte, und eine Wohnung zu mieten, statt mit einem schäbigen Motelzimmer vorliebzunehmen.
Doch diesen Traum hatte er längst aufgegeben. Er wusste es inzwischen besser. Nach einer Woche im selben Raum wurde ihm die Umgebung vertraut, er begann sich zu erinnern. Und prompt setzten die Albträume ein. Dagegen gab es seiner Erfahrung nach nur einen Schutz: Fremdheit. Wenn das Bett nicht »seins« war, wenn ein Raum unbekanntes Territorium blieb, gelang es ihm mitunter, zwei Stunden hintereinander ungestört zu schlafen. Sobald er sich aber an die Umgebung gewöhnte, eine gewisse Vertrautheit empfand und länger schlief, fing er unweigerlich an, von Diana zu träumen.
Das war nicht nur schlecht. Natürlich tat es weh, denn selbst im Traum erfüllte ihn der Anblick ihres Gesichts mit einer quälenden Sehnsucht, es gab aber auch Angenehmes – die bittersüße Erinnerung daran, wie das Leben früher war, an die Liebe, die er einst empfand. Wenn die Träume nur dort enden könnten: mit Bildern von Diana auf dem Rasen ihres Colleges oder von ihnen beiden, eng aneinandergeschmiegt im großen Bett in ihrem Haus auf Bainbridge Island.
Doch dieses Glück war ihm nie beschieden. Die Traumbilder änderten sich, wurden hässlich, unerträglich. Und meistens schreckte er aus dem Schlaf hoch – die Worte »Verzeih mir« auf den Lippen.
Seine einzige Rettung bestand darin, rastlos weiterzuziehen und nicht aufzufallen.
Er hatte in seinen Streunerjahren gelernt, sich nahezu unsichtbar zu machen. Wenn sich ein Mann anständig kleidete, regelmäßig zum Friseur ging und einen ordentlichen Job hatte, wurde er von seinen Mitmenschen bemerkt. Sie warteten neben ihm an der Haltestelle auf den Bus und verwickelten ihn hin und wieder in ein Gespräch.
Aber wenn sich ein Mann gehen ließ, wenn er Friseurbesuche aufschob, ein formloses Harley-Davidson-T-Shirt, ausgeblichene Levi’s und einen schmuddeligen Rucksack trug, übersahen ihn die Leute. Noch wichtiger: Er wurde nicht erkannt.
Hinter Wyatt schrillte die Sirene. Mit einem tiefen Seufzer betrat er das Gebäude. Die Kälte traf ihn wie ein Schlag. Schnell fühlte sich der Schweiß auf seinem Gesicht eisig an. Fröstelnd warf Wyatt seine leere Cola-Dose in einen Abfalleimer, durchquerte das Kühllager für Obst und trat wieder ins Freie.
Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sich die Hitze fast wohltuend an, aber als er die Laderampe erreicht hatte, lief ihm schon wieder der Schweiß den Körper hinab. »Wyatt«, schrie ihm der Vorarbeiter zu. »Was glauben Sie eigentlich, wo Sie sind? Bei einem gottverdammten Picknick?«
Joe musterte die lange Reihe von Lastwagen voller frisch gepflückter Kirschen. Dann betrachtete er die Männer, die mit dem Entladen der Ernte beschäftigt waren – hauptsächlich Mexikaner, die in baufälligen Wohnwagen ohne WC oder Wasseranschluss hausten.
»Nein, Sir«, antwortete er dem rotgesichtigen Vorarbeiter, dem es offenbar Freude machte, seine Arbeiter anzubrüllen. »Ich halte das hier keineswegs für ein Picknick.«
»Gut. Dann machen Sie sich endlich an die Arbeit. Ich ziehe Ihnen eine halbe Stunde vom Lohn ab.«
Früher hätte Joe den Mann bei seinem schmutzstarrenden, schweißdurchtränkten Kragen gepackt und ihm klargemacht, wie man seine Mitmenschen behandelte.
Doch diese Tage gehörten der Vergangenheit an.
Langsam schlenderte er auf den nächststehenden Laster zu und zerrte im Gehen ein Paar Schutzhandschuhe aus der Gesäßtasche.
Es war wirklich Zeit für einen Ortswechsel.

Claire stand an der Spüle in der Küche und dachte über das gestrige Telefongespräch mit Meg nach.
»Mommy, kann ich noch ein Eggo haben?«
»Wie heißt das, Alison?«, fragte Claire fast abwesend zurück.
»Darf ich bitte ein Eggo haben, Mommy?«
Claire drehte sich um und trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab. »Natürlich.« Sie schob eine Waffel in den Toaster, blickte sich um …
Und sah ihre Umgebung plötzlich mit den Augen ihrer Schwester.
Das Haus war nicht übel, zumindest nicht im Vergleich zu anderen in Hayden. Aber nicht gerade groß: drei winzige Mansardenzimmer im Dachgeschoss, ein Bad oben, ein WC unten, ein Wohnzimmer und eine Küche mit einer Essecke, deren Tisch auch als Arbeitsfläche diente. In den sechs Jahren, in denen Claire hier wohnte, hatte sie die früher moosgrünen Wände in einem zarten Cremegelb gestrichen sowie den orangefarbenen Teppichboden herausgerissen und durch schimmernde Holzdielen ersetzt. Die ausnahmslos gebraucht gekauften Möbel hatte Claire sorgsam restauriert und neu gebeizt. Ihr ganzer Stolz war ein hawaiianisches Sofa aus Koaholz mit Polstern in einem müden Rot. Im Moment wirkte es im Wohnzimmer irgendwie fehl am Platz, aber das würde sich ändern, eines Tages, wenn sie auf Kauai lebte.
Für das alles hätte Meg natürlich nur ein geringschätziges Schulterzucken übrig. Meg, die nach ihrem guten Schulabschluss buchstäblich durch ihr Studium flog. Die nie auch nur den geringsten Zweifel daran ließ, dass sie Unsummen von Geld besaß, und ihrer Nichte zu Weihnachten Präsente schickte, neben denen alle anderen Geschenke unter dem Baum geradezu verblassten.
»Fertig!«
»So ist es.« Claire nahm die Waffel, bestrich sie mit Butter, schnitt sie in bissgerechte Stücke und schob ihrer Tochter den Teller zu. »Hier, bitte.«
Sofort spießte Alison mit der Gabel einen Happen auf, stopfte ihn sich in den Mund und begann wild zu mampfen.
Bei ihrem Anblick musste Claire unwillkürlich lächeln. Das war schon immer so gewesen seit Alisons Geburt. Ihre Tochter wirkte mit ihren blonden Haaren, dem blassen Teint und dem herzförmigen Gesicht wie eine Miniaturausgabe von ihr selbst. Es gab zwar keine Fotos von ihr im Alter von fünf Jahren, aber Claire wusste einfach, dass sie genauso ausgesehen hatte wie jetzt ihre kleine Tochter. Von ihrem Vater schien Alison absolut nichts geerbt zu haben.
Was Claire nur gerecht fand, denn kaum hatte er von ihrer Schwangerschaft erfahren, hatte er unverzüglich das Weite gesucht.
»Du bist noch gar nicht angezogen, Mommy. Wenn du dich nicht beeilst, kommen wir noch zu spät.«
»Ich fürchte, du hast recht.« Claire dachte an die Dinge, die heute zu erledigen waren: Sie musste die hintere Wiese mähen, die Fenster im Bad von Blockhütte drei abdichten, die Toilettenspülung in Blockhütte fünf reparieren, überprüfen, ob alle Schimmelflecke an Wänden und Decken beseitigt waren, und den Bootsschuppen in Ordnung bringen. Morgen wollten sie für eine Woche an den Lake Chelan. Es war noch früh, gerade einmal acht Uhr, sie konnte nur hoffen, alles rechtzeitig fertig zu bekommen. »Hast du vielleicht irgendwo meine Liste gesehen, Alison?«
»Sie liegt im Wohnzimmer auf dem Tisch.«
Kopfschüttelnd stand Claire auf und holte den Zettel. Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, ihn dort zurückgelassen zu haben. Manchmal fragte sie sich wirklich, wie sie ohne Alison klarkommen sollte.
»Ich möchte zum Ballett, Mommy. Oder hast du was dagegen?«
Das erinnerte Claire daran, dass auch sie sich als kleines Mädchen sehnsüchtig wünschte, eine große Ballerina zu werden. Meghann hatte diesen Traum stets unterstützt, obwohl für den Unterricht nie genug Geld da war.
Nun, das stimmte nicht ganz. Für Mamas Tanzstunden hatte das Geld gereicht, aber nicht für Claires.
Aber dann, als Claire vielleicht sechs oder sieben war, hatte Meghann eine Studienfreundin gebeten, ihrer kleinen Schwester sonnabends ein paar Unterrichtsstunden zu geben. An diese wundervollen Vormittage konnte sie sich heute noch erinnern.
Ihr Lächeln schwand.
Alison musterte sie stirnrunzelnd. »Was ist, Mommy? Darf ich zum Ballett oder nicht?«
»Früher wollte ich auch unbedingt Tänzerin werden. Wusstest du das?«
»Nein.«
»Dummerweise habe ich Füße wie Frachtkähne.«
Ali musste kichern. »Frachtkähne sind riesig, Mommy. Deine Füße sind nur ein bisschen groß.«
»Oh, vielen Dank.« Claire lachte.
»Und warum bist du keine Tänzerin geworden, sondern eine Arbeitsbiene?«
»So nennt mich nur Grandpa – Arbeitsbiene. Eigentlich bin ich stellvertretende Geschäftsführerin.«
Wie viele von Claires Entscheidungen wurde die für ihr jetziges Leben eher zufällig getroffen, ohne tiefschürfende Überlegungen. Es begann damit, dass sie an der Washington State University durchfiel, weil sie es am offenbar nötigen Fleiß fehlen ließ. Damals wusste sie nicht, dass Meghann natürlich grundsätzlich recht hatte. Eine Hochschulausbildung gab einem Mädchen vielfältige Chancen. Ohne Abschluss und ohne einen klaren Berufstraum war Claire erst einmal nach Hayden zurückgekehrt. Eigentlich wollte sie nur ein paar Wochen bleiben, um dann nach Kauai zu fliegen und Surfen zu lernen, aber Dad holte sich eine Bronchitis, die ihn für einen Monat ans Bett fesselte. Claire war spontan eingesprungen, um ihn zu entlasten. Als ihr Vater dann endlich wieder gesund genug war, um seine Arbeit wieder aufnehmen zu können, erkannte Claire, wie sehr es ihr hier am Fluss gefiel. In dieser Hinsicht wie in vielen anderen Punkten auch war sie eben ganz die Tochter ihres Vaters.
Genau wie er liebte sie ihre Tätigkeit für die Ferienanlage. Bei Sonne wie bei Regen verbrachte sie den ganzen Tag im Freien und erledigte, was an Arbeit so anfiel. Und wenn sie eine Aufgabe bewältigt hatte, wurde sie prompt mit greifbaren Ergebnissen belohnt. Die Schufterei auf diesen sechzehn Morgen am Fluss hatte etwas zutiefst Befriedigendes.
Es überraschte sie nicht, dass Meghann dafür kein Verständnis aufbringen konnte. Für ihre Schwester, die Bildung und Geld weit über alles andere stellte, war dieser »Campingplatz« nicht mehr und nicht weniger als eine Verschwendung von Talenten und Zeit.