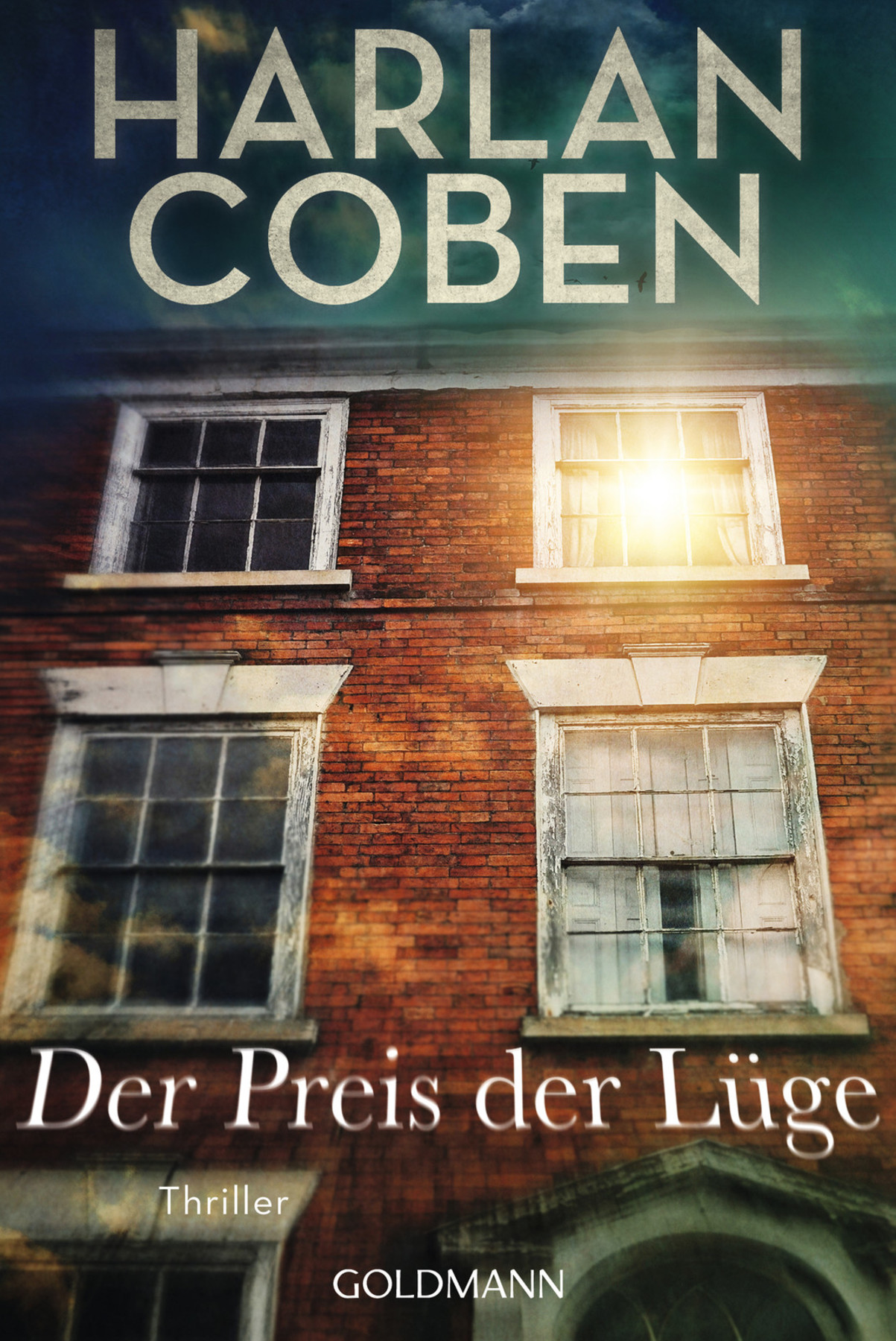
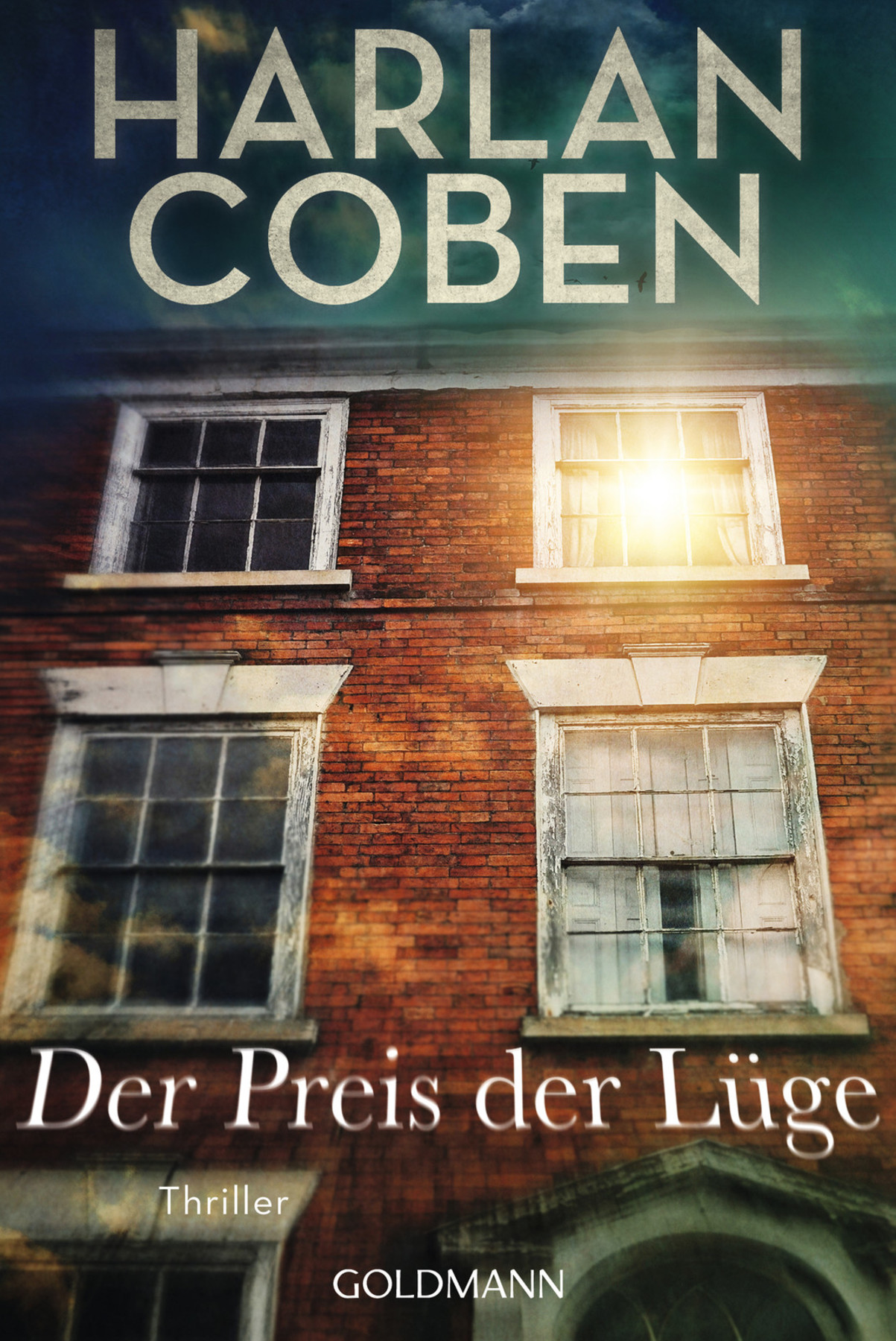
Buch
Zwei Söhne wohlhabender amerikanischer Familien werden entführt. Eine Lösegeldforderung geht ein, dann herrscht Schweigen – und die Kinder bleiben verschwunden. London, zehn Jahre später: Privatdetektiv Myron Bolitar spürt einen verstörten Sechzehnjährigen auf: Patrick, eines der Entführungsopfer von damals. Von dem anderen Jungen fehlt jede Spur. Patricks Heimkehr wirft allerdings mehr Fragen auf, als sie Antworten liefert: Wo hat er all die Jahre gesteckt? Was ist damals geschehen? Und was ist mit seinem Freund passiert? Je mehr Patrick sich in Widersprüchen verstrickt, umso dichter wird das Netz der Lügen, das sich um ihn und seine Familie zusammenzieht …
Weitere Informationen zu Harlan Coben und zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Harlan Coben

Der Preis der Lüge
Myron Bolitar ermittelt
Thriller
Deutsch
von Gunnar Kwisinski
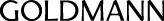





Für Mike und George
und Midlife-Bromances
1
Der Junge, der seit zehn Jahren vermisst wird, tritt ins Licht.
Ich neige nicht zu Hysterie und empfinde selten auch nur etwas, das man als Erstaunen bezeichnen könnte. In meinen über vierzig Lebensjahren habe ich schon viel gesehen. Ich bin fast getötet worden – und ich habe getötet. Ich habe Formen der Verkommenheit gesehen, die für die meisten Menschen problematisch, wenn nicht gar unbegreiflich wären, und manch einer würde wohl behaupten, dass diese Verkommenheit auch einigen meiner Handlungen zugrunde lag. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, meine Gefühle im Zaum zu halten, und, was noch wichtiger ist, meine Reaktionen in kritischen, brisanten Situationen zu kontrollieren. Ich mag schnell und gewaltsam zuschlagen, tue aber nichts ohne eine gewisse Bedachtsamkeit und Zielorientierung.
Diese Fähigkeiten, wenn man sie denn als solche wertet, haben mir und denjenigen, die mir wichtig sind, ein ums andere Mal das Leben gerettet.
Dennoch gestehe ich, dass mein Puls rast, als ich den Jungen – der inzwischen ein Teenager ist – hier erblicke. Mir dröhnen die Ohren. Unwillkürlich balle ich die Fäuste.
Zehn Jahre – und jetzt bin ich allenfalls fünfzig Meter von dem vermissten Jungen entfernt.
Patrick Moore – so heißt der Junge – lehnt an der mit Graffiti beschmierten Betonwand einer Unterführung. Seine Schultern sind gebeugt. Sein Blick schießt hin und her, bis er ihn schließlich auf den rissigen Straßenbelag vor sich richtet. Seine Haare sind kurzgeschoren – als ich klein war, nannten wir diese Frisur einen Mecki. Vor der Unterführung lungern noch zwei weitere männliche Teenager herum. Einer zieht immer wieder mit solcher Leidenschaft an seiner Zigarette, dass es wirkt, als hätte sie ihn beleidigt. Der andere trägt ein genietetes Hundehalsband und ein Netzhemd, präsentiert sich also im klassischen Outfit seines derzeitigen Gewerbes.
Die Fahrer in den darüber hinwegdonnernden Autos ahnen nicht, was unter ihnen los ist. Wir befinden uns in King’s Cross, das in den letzten zwanzig Jahren zu großen Teilen »aufgewertet« wurde, unter anderem durch die Ansiedlung von Museen und Bibliotheken, den Eurostar sowie ein Hinweisschild auf den Bahnsteig 9 ¾, auf dem Harry Potter in seinen Zug nach Hogwarts stieg. Viele der sogenannten »unerwünschten Elemente« haben diesen riskanten, ortsgebundenen Transaktionen zugunsten der relativen Sicherheit des Online-Business den Rücken gekehrt – die Nachfrage auf dem gefahrenträchtigen Straßenstrich ist stark zurückgegangen, noch so ein positiver Nebeneffekt des Internets –, wenn man sich jedoch in die tatsächlich wie idiomatisch finsteren Gassen des Viertels begibt, abseits der glänzenden, neuen Bürotürme, findet man immer noch Orte, an denen dieses lasterhafte Element in hochkonzentrierter Form weiterlebt.
Und dort habe ich den vermissten Jungen gefunden.
Ein Teil von mir – der impulsive Teil, den ich im Zaum halte – will über die Straße rennen und den Jungen schnappen. Er wäre jetzt sechzehn Jahre alt, sofern es wirklich Patrick ist und kein Doppelgänger oder ich mich irre. Alles scheint zu passen – zumindest aus dieser Entfernung. Vor zehn Jahren – wie jung er damals war, können Sie sich leicht selbst ausrechnen – hatte sich Patrick in dem extrem wohlhabenden Ort Alpine mit Rhys, dem Sohn meines Cousins, zu einem – auf dieser Bezeichnung wurde damals bestanden – »Playdate« getroffen.
Und genau dies erklärt mein Dilemma.
Wenn ich mir Patrick jetzt schnappe, einfach über die Straße renne und ihn mir greife, was wird dann aus Rhys? Einer der vermissten Jungen befindet sich in Sichtweite, ich bin aber hier, um beide zu retten. Also muss ich behutsam vorgehen. Darf nicht überhastet handeln. Ich muss Geduld haben. Ganz egal, was vor zehn Jahren geschehen ist, welche grausame Fügung der Menschheit (ich glaube nicht recht, dass das Schicksal grausam ist, da es sich bei den Übeltätern meist um Mitmenschen handelt) diesen Jungen aus der Opulenz seines Herrenhauses gerissen und in diese versiffte Unterführung geführt hat, ein Fehler von mir könnte bewirken, dass einer oder gar beide Jungs wieder verschwinden – und zwar für immer.
Ich muss auf Rhys warten. Ich werde auf ihn warten, mir beide Jungs schnappen und sie nach Hause bringen.
Vermutlich sind Ihnen inzwischen zwei Fragen durch den Kopf gegangen. Erstens: Wie kann ich mir sicher sein, dass ich mir beide Jungs schnappen kann, wenn ich sie zu Gesicht bekomme? Was wäre, werden Sie sich fragen, wenn die Jungs einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und sich wehren. Was, wenn die Entführer, oder wer auch immer für ihre Unfreiheit verantwortlich ist, versuchen würden, mich entschlossen und brutal davon abzuhalten?
Meine Antwort lautet: Machen Sie sich darüber keine Gedanken.
Die zweite Frage beschäftigt mich allerdings tatsächlich: Was ist, wenn Rhys nicht auftaucht?
Ich bin nicht so sehr der Kommt-Zeit-kommt-Rat-Typ, also hecke ich einen Plan B aus, der unter anderem darin besteht, die Umgebung genauer zu erkunden und Patrick in sicherer Entfernung zu folgen. Während ich noch an einigen Details dieses Plans feile, geht etwas schief.
Das Geschäft nimmt Fahrt auf. Und im Leben wird in Kategorien gedacht. Das ist auch in der Gosse nicht anders. Es gibt hier verschiedene Unterführungen, und in der ersten richtet sich das Angebot an heterosexuelle Männer, die weibliche Begleitung suchen. Dort herrscht der größte Andrang. Wegen der herrschenden Grundwerte, nehme ich an. Man kann noch so viel über Gender, Präferenzen und Perversionen reden, die Mehrheit der sexuell Frustrierten sind immer noch heterosexuelle Männer, die nicht genug bekommen. Alte Schule eben. Frauen mit leeren Blicken nehmen ihre Plätze an den Betonpollern ein, Autos fahren im Schritttempo vorbei, Frauen steigen ein und verschwinden, andere Frauen nehmen ihren Platz ein. Es ist fast so, als beobachte man einen Getränkeautomaten an einer Tankstelle.
In der zweiten Unterführung wartet ein kleines Kontingent von Transvestiten oder Transgender-Frauen in den unterschiedlichsten Ausformungen und Ausprägungen, und dann, ganz hinten, da wo sich auch Patrick gerade befindet, stehen die jungen Stricher.
Ich sehe, wie ein Mann in einem melonenfarbenen Hemd auf Patrick zustolziert.
Was, habe ich mich bei Patricks Ankunft gefragt, würde ich tun, wenn ein Freier seine Dienste in Anspruch nehmen will? Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass es am besten wäre, in diesem Fall sofort einzuschreiten. Es wäre die menschlichste Reaktion. Andererseits darf ich mein Ziel nicht aus den Augen verlieren, beide Jungs nach Hause zu bringen. Immerhin waren Patrick und Rhys zehn Jahre lang verschwunden. Sie haben weiß Gott was durchgemacht, und obwohl mir der Gedanke nicht gefällt, dass einer der beiden ein weiteres Mal missbraucht werden könnte, habe ich das Für und Wider bereits abgewogen und eine Entscheidung getroffen. Und es ist sinnlos, über diese Entscheidung noch weiter nachzugrübeln.
Aber Melonenhemd ist kein Freier.
Das sehe ich sofort. Freier stolzieren nicht so selbstbewusst umher. Sie gehen nicht hoch erhobenen Hauptes. Sie schmunzeln nicht. Sie tragen keine leuchtend melonenfarbenen Hemden. Die Freier, die so verzweifelt sind, dass sie hierherkommen, um ihre Triebe zu befriedigen, schämen sich entweder, oder sie fürchten, entdeckt zu werden – oder beides.
Melonenhemd hingegen stolziert in der forschen Haltung eines gefährlichen, selbstsicheren Mannes. So etwas spürt man, wenn man eine gewisse Erfahrung in solchen Dingen hat. Das Unterbewusstsein sendet einen primitiven, inneren Warnton, den man sich nicht ganz genau erklären kann. Der moderne Mensch, der häufig mehr Angst vor der Blamage hat als um seine Sicherheit, neigt dazu, diese Warnung zu ignorieren, und bringt sich so in Gefahr.
Melonenhemd sieht kurz nach hinten. Zwei weitere Männer erscheinen und flankieren ihn. Beide sind sehr groß, tragen tarnfarbene Cargohosen und Unterhemden über der glänzenden, muskulösen Brust. Die anderen Jungs in der Unterführung – der Raucher und der mit dem Nietenhalsband – fliehen, als sie Melonenhemd sehen, und lassen Patrick allein mit den drei Neuankömmlingen.
Oh, das ist nicht gut.
Patrick blickt immer noch zu Boden. Sein nahezu kahlgeschorener Kopf glänzt. Er sieht die herannahenden Männer erst, als Melonenhemd schon fast vor ihm steht. Ich gehe näher heran. Wahrscheinlich arbeitet Patrick schon länger auf der Straße. Ich überlege kurz, was das für ein Leben sein muss, aus der komfortablen Blase eines amerikanischen Vororts herausgerissen zu werden, um hier in dieser – was auch immer es sein mag – zu landen?
Im Laufe dieser Zeit könnte Patrick sich jedoch gewisse Fähigkeiten angeeignet haben. Vielleicht kann er sich aus der Sache herausreden. Vielleicht ist die Situation nicht so brenzlig, wie sie mir erscheint. Ich muss abwarten und die Situation weiter beobachten.
Melonenhemd stellt sich direkt vor Patrick. Er sagt etwas zu ihm. Ich kann es nicht verstehen. Dann holt er aus und rammt Patrick ohne Vorwarnung die Faust in den Solarplexus.
Patrick klappt zusammen, fällt zu Boden und bleibt nach Luft schnappend liegen.
Die beiden tarnfarbenen Muskelpakete treten näher heran. Ich renne.
»Gentlemen«, rufe ich.
Melonenhemd und beide Tarnhosen fahren herum. Zuerst sehen ihre Mienen aus wie die von Neandertalern, die zum ersten Mal eine fremde Stimme vernehmen. Dann verengen sich ihre Augen, als sie mich begutachten. Lächeln umspielt ihre Lippen. Körperlich bin ich keine imposante Erscheinung. Ich bin etwa mittelgroß und eher schlank gebaut, habe blonde Haare mit grauen Strähnen, bei mittleren Temperaturen habe ich einen Teint wie Porzellan, bei Kälte geht er eher ins Rötliche, und meine Gesichtszüge könnte man als grazil bezeichnen, auf eine Weise, die – so hoffe ich – attraktiv erscheint.
Heute trage ich einen handgenähten, hellblauen Anzug aus der Savile Row, eine Lilly-Pulitzer-Krawatte, ein Hermès-Einstecktuch in der Brusttasche und Bedfordshire-Stiefeletten, die vom besten Schuster bei G. J. Cleverley’s in der New Bond Street maßgefertigt wurden.
Ich bin schon ein echter Dandy, was?
Als ich auf die drei Gangster zuschlendere und bedaure, keinen Regenschirm dabeizuhaben, den ich, nur aus Effekthascherei, herumwirbeln könnte, spüre ich, wie ihre Selbstsicherheit zunimmt. Das gefällt mir. Normalerweise habe ich ein oder zwei Handfeuerwaffen bei mir, aber in England sind die Gesetze diesbezüglich sehr streng. Was mich allerdings nicht weiter stört. Das Gute an diesen strengen Gesetzen ist, dass meine Gegner höchstwahrscheinlich auch unbewaffnet sind. Ich lasse den Blick noch schnell über ein paar Körperstellen schweifen, an denen man Waffen verbergen könnte. Die Gangster mir gegenüber haben eine Vorliebe für recht enganliegende Kleidung, die den Körperbau zwar betont, unter der man eine Waffe allerdings auch kaum verstecken kann.
Vielleicht tragen sie Messer – höchstwahrscheinlich sogar –, aber gewiss keine Schusswaffen.
Messer stören mich nicht groß.
Als ich sie erreiche, liegt Patrick – sofern es sich wirklich um Patrick handelt – noch immer japsend auf dem Boden. Ich bleibe stehen, breite die Arme aus und begrüße die drei Männer mit einem einnehmenden Lächeln. Sie starren mich an wie ein Kunstwerk in einem Museum, dessen Sinn sich ihnen nicht erschließt.
Melonenhemd tritt einen Schritt auf mich zu. »Wer zum Teufel sind Sie?«
Ich lächele immer noch. »Sie sollten jetzt gehen.«
Melonenhemd sieht Tarnhose eins rechts von mir an. Dann sieht er Tarnhose zwei links von mir an. Auch ich wende mich einmal kurz in jede Richtung. Dann sehe ich Melonenhemd wieder an.
Als ich ihm zuzwinkere, schießen seine Augenbrauen in die Höhe.
»Wir könnten ihn zerschneiden«, sagt Tarnhose eins. »In kleine Stücke.«
Ich heuchle Erschrecken und drehe mich zu ihm um. »Herrje, ich hab Sie ja gar nicht gesehen.«
»Was?«
»In dieser Tarnhose. Sie verschmelzen ja förmlich mit der Umgebung. Und sie steht Ihnen wirklich ganz ausgezeichnet.«
»Sie halten sich wohl für oberschlau, was?«
»Oberschlau ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich bin schon ein helles Köpfchen.«
Alle lächeln breiter, auch ich.
Sie umzingeln mich. Ich kann versuchen, friedlich aus der Sache herauszukommen, mit ihnen reden, ihnen Geld anbieten, damit sie uns in Ruhe lassen, glaube aber aus drei Gründen nicht, dass das funktionieren könnte. Erstens würden diese Gangster verlangen, dass ich ihnen all mein Geld gebe, und dann würden sie nachsehen wollen, ob ich nicht noch weitere Wertgegenstände bei mir habe. Finanzielle Angebote bringen nichts. Zweitens haben alle Blut gewittert – leicht zu vergießendes Blut –, und sie mögen diesen Geruch. Und drittens, und das ist das Wichtigste, auch ich mag den Geruch von Blut.
Es ist so lange her.
Ich muss mir ein Lächeln verkneifen, als sie auf mich losgehen. Melonenhemd zieht ein großes Jagdmesser. Das gefällt mir. Ich empfinde keine größeren moralischen Skrupel dabei, diejenigen, die ich als bösartig identifiziert habe, Schmerzen zuzufügen. Trotzdem ist es gut, wenn ich den Menschen gegenüber, die solche Rechtfertigungen brauchen, um mich »sympathisch« zu finden, anführen kann, dass mein Gegner zuerst eine Waffe gezückt hat, es sich also um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt hat.
Trotzdem gebe ich ihnen noch eine letzte Chance.
Ich sehe Melonenhemd direkt in die Augen und sage: »Sie sollten jetzt gehen.«
Die beiden Tarnhosen mit den aufgeblähten Muskeln lachen, aber das Grinsen in Melonenhemds Gesicht schwindet. Er weiß Bescheid. Definitiv. Er hat mir in die Augen gesehen und weiß, was los ist.
Der Rest dauert nur wenige Sekunden.
Tarnhose eins kommt auf mich zu und betritt meine intime Zone. Er ist groß. Ich stehe auf Augenhöhe mit seinen eingeölten, gebräunten Brustmuskeln. Er blickt lächelnd auf mich herab, als wäre ich eine schmackhafte Leckerei, die er mit einem Bissen verschlingen will.
Es gibt keinen Grund, das Unvermeidliche hinauszuzögern.
Ich schlitze ihm mit dem Rasiermesser, das ich in der Hand versteckt habe, die Kehle auf. In einem fast perfekten Bogen spritzt Blut auf mich herab. Verflixt. Jetzt muss ich noch einmal in die Savile Row.
»Terence!«
Es ist Tarnhose zwei. Sie sehen sich ähnlich, und als ich mich jetzt auf ihn zubewege, überlege ich, ob sie Brüder sind. Er ist vor Kummer erstarrt, sodass es sehr leicht ist, ihn auszuschalten, wobei ich nicht glaube, dass eine erhöhte Kampfbereitschaft ihm viel genützt hätte.
Ich bin gut mit dem Rasiermesser.
Tarnhose zwei verendet ebenso wie sein potenzieller Bruder Terence.
Damit bleibt noch Melonenhemd, ihr geliebter Anführer, der diesen Rang höchstwahrscheinlich dadurch erlangt hat, weil er ein klein wenig brutaler und gerissener als seine gefallenen Kameraden ist. Klugerweise hat Melonenhemd seinen Angriff schon gestartet, als ich noch mit der Beseitigung von Tarnhose zwei beschäftigt war. Am Rande meines Gesichtsfelds glitzert ein Messer, das von oben auf mich heruntersaust.
Nicht klug von ihm.
So sticht man nicht auf einen Gegner ein. Es ist zu einfach, sich gegen einen solchen Angriff zu verteidigen. Der Kontrahent kann sich wegducken und so Zeit gewinnen, oder er kann den Unterarm nach oben reißen und den Stoß blocken. In Kursen zum Umgang mit Schusswaffen wird einem beigebracht, die Waffe auf die Körpermitte zu richten, damit man auch dann noch etwas trifft, wenn man nicht hundertprozentig genau gezielt hat. Man plant also die Möglichkeit ein, einen Fehler zu machen. Dasselbe gilt für den Kampf mit einem Messer. Die Stoßbewegung sollte so kurz wie möglich sein. Außerdem zielt man auf die Körpermitte, damit man den Gegner auch dann verwundet, wenn er ausweicht.
Melonenhemd tut das nicht.
Ich ducke mich und wehre den Stoß mit dem rechten Unterarm ab. Dann wirble ich mit gebeugten Knien herum und ziehe ihm das Rasiermesser über den Bauch. Ich warte nicht auf seine Reaktion, sondern richte mich auf und erledige ihn genauso wie die beiden anderen.
Wie schon erwähnt, hat das Ganze nur wenige Sekunden gedauert.
Auf dem rissigen Straßenbelag hat sich eine blutrote Lache gebildet. Sie wird immer größer. Ich gönne mir eine Sekunde, mehr nicht, um das Hochgefühl auszukosten. Das würden Sie auch tun, auch wenn Sie es sich vielleicht nicht eingestehen.
Ich drehe mich zu Patrick um.
Doch er ist weg.
Ich sehe nach links und nach rechts. Da ist er, fast schon außer Sichtweite. Ich eile ihm nach, merke aber schnell, dass das keinen Sinn hat. Er ist unterwegs nach King’s Cross Station, einem der belebtesten Bahnhöfe Londons. Er wird längst am Bahnhof sein – sich im Schutz der Öffentlichkeit befinden –, wenn ich ihn erreiche. Ich bin blutüberströmt. So gut ich mein Metier auch beherrsche, und obwohl King’s Cross tatsächlich der Bahnhof ist, von dem Harry Potter sich mit dem Zug nach Hogwarts aufgemacht hat, einen Tarnumhang besitze ich nicht.
Ich bleibe stehen, sehe mich um, überlege kurz und ziehe eine Schlussfolgerung.
Ich habe Mist gebaut.
Es wird Zeit, sich rar zu machen.
Ich habe keine Angst davor, dass jetzt auf irgendeiner Überwachungskamera zu sehen sein könnte, was ich getan habe. Das kriminelle Milieu entscheidet sich nicht ohne Grund für Orte wie diesen. Hier gibt es keine neugierigen Augen, einschließlich der digitalen und elektronischen.
Trotzdem habe ich die Sache verbockt. Nach all den Jahren, nach dieser unendlichen, fruchtlosen Suche, bin ich schließlich auf eine Spur gestoßen, und wenn ich diese Spur verliere …
Ich brauche Hilfe.
Ich eile davon und drücke die Eins auf meiner Kurzwahlliste. Die Eins habe ich seit fast einem Jahr nicht mehr gedrückt.
Er meldet sich nach dem dritten Klingeln. »Hallo?«
Obwohl ich mich gewappnet habe, ringe ich einen Moment um Fassung, als ich seine Stimme höre. Die Nummer ist unterdrückt, er weiß also nicht, wer anruft.
Ich sage: »Das heißt, ›Ich höre‹.«
Er schnappt nach Luft. »Win? Mein Gott, wo warst du die …?«
»Ich habe ihn gesehen«, sage ich.
»Wen?«
»Überleg mal.«
Nach einer sehr kurzen Pause. »Moment, beide?«
»Nur Patrick.«
»Wow.«
Ich runzele die Stirn. Wow? »Myron?«
»Ja?«
»Nimm die nächste Maschine nach London. Ich brauche deine Hilfe.«
2
Zwei Minuten bevor Win anrief, hatte Myron Bolitar nackt neben einer zum Niederknien schönen Frau im Bett gelegen. Beide hatten zur edlen Deckenvertäfelung hinaufgestarrt, nach Luft geschnappt und sich den Nachwirkungen der Ekstase hingegeben, die man nur durch … äh … Ekstase erreicht.
»Wahnsinn«, sagte Terese.
»Ich weiß, ich weiß.«
»Das war …«
»Ich weiß.«
Das postkoitale Gesäusel lag Myron einfach im Blut.
Terese schwang die Beine aus dem Bett, stand auf und ging zum Fenster. Myron sah ihr zu. Er mochte die Art, wie sie sich nackt bewegte, die selbstbewussten, pantherartig geschmeidigen Schritte. Das Apartment lag am westlichen Rand des Central Parks. Terese blickte aus dem Fenster in Richtung See und Bow Bridge. Wenn Sie je einen Film gesehen haben, in dem ein verliebtes Paar in New York über eine Fußgängerbrücke geht, kennen Sie die Bow Bridge.
»Herrgott, was für eine Aussicht«, sagte Terese.
»Genau das Gleiche dachte ich auch gerade.«
»Glotzt du mir auf den Arsch?«
»Ich sehe es eher als eine Art Observation. Ich passe darauf auf.«
»Dann willst du ihn schützen?«
»Den Blick abzuwenden wäre unprofessionell.«
»Ja, und wir müssen doch mit allen Mitteln verhindern, dass du unprofessionell wirkst.«
»Danke.«
Dann sagte seine Verlobte, die ihm immer noch den Rücken zuwandte: »Myron?«
»Ja, meine Liebe.«
»Ich bin glücklich.«
»Ich auch.«
»Das ist beängstigend.«
»Furchterregend«, stimmte Myron zu. »Komm wieder ins Bett.«
»Ehrlich?«
»Ja.«
»Mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst.«
»Oh, ich kann sie halten«, sagte Myron. Dann: »Gibt’s hier einen Lieferservice, der Austern und Vitamin E im Angebot hat?«
Sie drehte sich um, lächelte, und ka-wumm, sein Herz zersprang in tausend Stücke. Terese Collins war wieder da. Nach den quälenden Jahren voller Unsicherheit und mit langen Trennungsphasen würden sie jetzt endlich heiraten. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ein wunderbares Gefühl. Ein Gefühl, das ihm so furchtbar zerbrechlich vorkam.
Und in diesem Moment klingelte das Handy.
Beide erstarrten, als spürten sie es. Wenn alles so gut lief, hielt man gewissermaßen die Luft an, weil es einfach so weitergehen sollte. Es ging nicht darum, die Zeit anzuhalten, nicht einmal ihren Lauf zu verlangsamen, in erster Linie ging es darum, für alle Zeit in seiner kleinen Blase zu bleiben.
Das Handyklingeln brachte, um diese hundsmiserable Metapher aufzugreifen, die Seifenblase zum Platzen.
Myron sah aufs Display, aber die Nummer war unterdrückt. Teresa und er waren im Dakota Building in Manhattan. Als Win vor einem Jahr verschwunden war, hatte er Myron das Apartment zur Verfügung gestellt. Der hatte dann allerdings den größten Teil dieses Jahres in seinem Elternhaus im nahegelegenen Livingston, New Jersey, verbracht, und, soweit es in seinen Möglichkeiten stand, versucht, seinen Neffen Mickey zu erziehen. Inzwischen war sein Bruder, der Vater des Teenagers, zurückgekehrt, woraufhin Myron den beiden das Haus überlassen hatte und wieder in die Stadt gezogen war.
Das Handy klingelte ein zweites Mal. Terese wandte sich ab, als hätte sie eine Ohrfeige bekommen. Er sah die Narbe von der Schusswunde an ihrem Nacken. Wieder einmal machte sich der vertraute Beschützerinstinkt in ihm bemerkbar.
Myron überlegte einen Moment lang, ob er es klingeln lassen und hinterher die Mailbox abhören sollte, doch dann schloss Terese die Augen und nickte knapp. Beiden war klar, dass es das Unvermeidliche nur hinauszögern würde, wenn er nicht ranging.
Beim dritten Klingeln nahm Myron das Gespräch an. »Hallo?«
Nach einem seltsamen Zögern und kurzem Knistern sagte die Stimme, die er so lange nicht gehört hatte: »Das heißt: ›Ich höre‹.«
Myron versuchte, sich zu sammeln, schnappte aber trotzdem nach Luft. »Win? Mein Gott, wo warst du die …?«
»Ich habe ihn gesehen.«
»Wen?«
»Überleg mal.«
Myron ahnte etwas, aber er hatte sich nicht getraut es auszusprechen. »Moment, beide?«
»Nur Patrick.«
»Wow.«
»Myron?«
»Ja?«
»Nimm die nächste Maschine nach London. Ich brauche deine Hilfe.«
Myron musterte Terese. Ihre Augen wirkten, als wären sie zersprungen. So war es schon einmal gewesen, vor Jahren, als sie zusammen durchgebrannt waren, was ihm damals jedoch erst nach ihrer Rückkehr aufgefallen war. Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie ergriff sie.
»Das Leben ist im Moment etwas kompliziert«, sagte Myron.
»Terese ist zurück«, sagte Win.
Das war keine Frage. Er wusste Bescheid.
»Ja.«
»Und ihr heiratet endlich.«
Auch keine Frage.
»Ja.«
»Hast du ihr einen Ring gekauft?«
»Ja.«
»Bei Norman in der 47th Street?«
»Selbstverständlich.«
»Mehr als zwei Karat?«
»Win …?«
»Ich freue mich für euch beide.«
»Danke.«
»Aber ihr könnt doch nicht«, sagte Win, »ohne deinen besten Freund als Trauzeugen heiraten.«
»Ich habe meinen Bruder schon gefragt.«
»Der wird freiwillig verzichten. Die Maschine fliegt ab Teterboro. Ein Wagen steht vor der Tür.«
Win legte auf.
Terese sah ihn an. »Du musst hinfliegen.«
Er wusste nicht, ob es eine Frage oder eine Feststellung war.
»Wenn Win anruft, ist das keine unverbindliche Bitte«, sagte Myron.
»Nein«, stimmte sie zu. »Das ist es nicht.«
»Es wird nicht lange dauern. Ich komm bald zurück, und dann heiraten wir. Versprochen.«
Terese setzte sich aufs Bett. »Kannst du mir sagen, worum es geht?«
»Wie viel hast du gehört?«
»Nur ein paar Wortfetzen.« Dann: »Hat der Ring mehr als zwei Karat?«
»Hat er.«
»Gut. Also erzähl.«
»Erinnerst du dich an die Alpine-Entführungen vor zehn Jahren?«
Terese nickte. »Natürlich. Wir haben darüber berichtet.«
Sie hatte jahrelang als Moderatorin für einen Nachrichtensender gearbeitet.
»Einer der entführten Jungs, Rhys Baldwin, ist mit Win verwandt.«
»Das hast du mir nie erzählt.«
Myron zuckte die Achseln. »Eigentlich hatte ich auch nicht viel damit zu tun. Seit ich dich kenne, ist da eigentlich nichts mehr passiert. Ich hatte die Geschichte mehr oder weniger auf Eis gelegt.«
»Anders als Win.«
»Win legt nie etwas auf Eis.«
»Also hat er eine neue Spur?«
»Mehr als eine Spur. Er meint, er hätte Patrick Moore gesehen.«
»Und warum ruft er nicht die Polizei?«
»Das weiß ich nicht.«
»Du hast ihn aber auch nicht gefragt.«
»Ich vertraue seiner Einschätzung.«
»Und er braucht deine Hilfe?«
»Ja.«
Terese nickte. »Dann musst du jetzt packen.«
»Kommst du damit klar?«
»Er hat recht.«
»Womit?«
Sie stand auf. »Wir können nicht ohne deinen besten Freund als Trauzeugen heiraten.«
*
Win hatte eine schwarze Limousine geschickt. Sie stand im Torbogen des Dakota Buildings. Myron stieg ein und fuhr darin gut eine halbe Stunde zum Teterboro Airport im Norden New Jerseys. Wins Flugzeug, ein Boeing Business Jet, stand abflugbereit auf der Rollbahn. Es gab keinen Sicherheitscheck, keine Gepäckaufgabe, kein Ticket. Die Limousine hielt direkt an der Gangway. Die Flugbegleiterin, eine hübsche, junge Asiatin, empfing Myron in einer altmodischen, maßgeschneiderten Uniform, einschließlich weißer Bluse und Pagenhut.
»Schön, Sie zu sehen, Mr Bolitar.«
»Ebenso, Mia.«
Für den Fall, dass die Information nicht angekommen ist: Win war reich.
Wins richtiger Name lautete Windsor Horne Lockwood III, Teile seines Familiennamens fand man unter anderem in Firmennamen wie Lock-Horne Investments and Securities oder dem Lock-Horne-Building an der Park Avenue. Die Familie gehörte zum klassischen, alten Geldadel – dem ganz alten, klassischen Geldadel, der in pinkfarbenen Polohemden von Bord der Mayflower auf den nächsten Golfplatz geschlendert war, auf dem die besten Abschlagzeiten bereits für sie reserviert waren.
Myron zog den Kopf ein, als er mit seinen eins zweiundneunzig durch die Flugzeugtür trat. Das Innere war mit Ledersesseln, einer Couch, Holzvertäfelung, dickem grünem Teppichboden und Tapeten im Zebramuster, einem Breitbildfernseher, einer Schlafcouch und einem Schlafzimmer mit Doppelbett ausgestattet. Die Maschine hatte einem Rapper gehört, und Win hatte beschlossen, die Einrichtung nicht zu verändern, weil er sich darin »voll krass« vorkam.
So ganz allein im Flugzeug fühlte Myron sich etwas verloren, ging aber davon aus, dass er es verkraften würde. Er nahm Platz und legte den Sicherheitsgurt an. Das Flugzeug rollte zur Startbahn. Mia fing mit den Sicherheitsbelehrungen an. Den Pagenhut ließ sie auf. Wie Myron wusste, stand Win auf den Hut.
Nicht einmal zwei Minuten später waren sie in der Luft.
Wieder kam Mia zu ihm und fragte: »Kann ich Ihnen etwas bringen?«
»Haben Sie ihn gesehen?«, fragte Myron. »Wo ist er gewesen?«
»Diese Frage darf ich leider nicht beantworten«, erwiderte Mia.
»Warum nicht?«
»Win hat mich gebeten, dafür zu sorgen, dass Sie einen angenehmen Flug haben. Wir haben Ihr Lieblingsgetränk an Bord.«
Sie hielt ein Tablett mit einem Yoo-Hoo-Schokodrink in der Hand.
»Danke, aber davon bin ich ab«, sagte Myron.
»Wirklich?«
»Ja.«
»Wie bedauerlich. Vielleicht einen Cognac?«
»Ich brauche erst einmal nichts. Was dürfen Sie mir denn sagen, Mia?«
Mia. Myron fragte sich, ob das ihr echter Name war. Win hatte er gefallen. Er war mit ihr nach hinten ins Flugzeug gegangen und hatte dann voller Absicht ganz fürchterliche, zweideutige Wortspiele gemacht, wo Mia doch wie »mir« klingt: »Ich brauche etwas Zeit mit Mia«, oder »ich genieße die fleischliche Unzucht mit Mia«, oder »ich mag den Pagenhut. Er steht Mia.«
Win eben.
»Was dürfen Sie mir sagen?«, wiederholte Myron.
Mia antwortete: »Für London ist strichweise Regen vorhergesagt.«
»Na so was, wer hätte das erwartet. Ich meine, was dürfen Sie mir über Win sagen?«
»Gute Frage«, sagte sie. »Was können Sie Mia …«, sie deutete auf sich, »… über Win sagen?«
»Fangen Sie nicht damit an.«
Sie lächelte. »Das Spiel der New York Knicks wird live übertragen, falls Sie es sich ansehen wollen.«
»Ich gucke kein Basketball mehr.«
Mia sah ihn mit einem so mitleidigen Blick an, dass er sich fast abgewandt hätte. »Ich habe die Dokumentation über Sie bei ESPN gesehen«, sagte sie.
»Daran liegt’s nicht«, sagte Myron.
Sie nickte, glaubte ihm aber offenbar kein Wort.
»Wenn das Spiel Sie nicht interessiert«, sagte Mia, »hätten wir noch ein Video, das Sie sich ansehen könnten.«
»Was für ein Video?«
»Win hat mich beauftragt, Sie zu bitten, es sich anzusehen.«
»Das ist doch kein, äh …«
Win pflegte seine … äh … fleischlichen Stelldicheins zu filmen und sie sich beim Meditieren anzusehen.
Mia schüttelte den Kopf. »Die macht er nur zu seinem eigenen Privatvergnügen, Mr Bolitar. Das wissen Sie doch. Es steht auch in der Verzichtserklärung, die wir unterschreiben müssen.«
»Verzichtserklärung?« Bevor sie antworten konnte, hob er die flache Hand. »Schon gut, vergessen Sie’s.«
»Hier ist die Fernbedienung.« Mia gab sie ihm. »Sind Sie sicher, dass ich Ihnen im Moment nichts bringen kann?«
»Nein, alles okay, danke.«
Myron drehte sich zum Fernseher um, der an der Wand hing, und schaltete das Video ein. Er erwartete schon, dass Win auf dem Bildschirm erscheinen und ihm eine Art Mission-Impossible-Nachricht präsentieren würde, doch es war eine dieser True-Crime-Shows des Kabelfernsehens, in denen wahre Verbrechen aufgearbeitet wurden. Es handelte sich um einen Rückblick auf die Entführung der beiden Jungs, da sie inzwischen zehn Jahre zurücklag.
Myron lehnte sich zurück und sah sich die Sendung an. Die Auffrischung kam durchaus gelegen. Kurz gefasst war Folgendes geschehen:
Vor zehn Jahren war der sechsjährige Patrick Moore zum gemeinsamen Spielen im Haus seines Klassenkameraden Rhys Baldwin im »noblen« – die Medien benutzten dieses Wort immer – Vorort Alpine, New Jersey gewesen. Alpine lag ganz in der Nähe von Manhattan auf der anderen Seite des Hudson River. Wie nobel es genau war? Der Durchschnittspreis für ein Haus lag im letzten Vierteljahr bei über vier Millionen Dollar.
Die Eltern hatten die beiden Jungs der Obhut von Vada Linna überlassen, einem achtzehnjährigen, finnischen Au-pair-Mädchen. Als Patricks Mutter, Nancy Moore, ihren Sohn wieder abholen wollte, hatte niemand geöffnet. Sie hatte sich keine größeren Sorgen gemacht, sondern angenommen, die junge Vada wäre mit den Jungs spazieren oder ein Eis essen gegangen, etwas in dieser Art.
Zwei Stunden später war Nancy Moore zurückgekommen und hatte ein zweites Mal an die Haustür geklopft. Wieder hatte niemand aufgemacht. Sie war immer noch kaum besorgt gewesen, hatte aber Rhys’ Mutter Brooke angerufen. Brooke hatte versucht, Vada auf ihrem Handy zu erreichen, war aber direkt zur Mailbox durchgestellt worden.
Brooke Lockwood Baldwin, eine Cousine ersten Grades von Win, war angesichts dieser Nachricht sofort nach Hause geeilt. Sie hatte die Haustür aufgeschlossen. Beide Frauen hatten nach ihren Söhnen gerufen. Zuerst hatte niemand geantwortet. Dann hatten sie aus dem abgeschlossenen, zu einem großen Spielzimmer umgebauten Keller ein Geräusch gehört.
Dort hatten sie die geknebelte und auf einen Stuhl gefesselte Vada Linna entdeckt. Das junge Au-pair-Mädchen hatte eine Lampe umgetreten, um die beiden Frauen auf sich aufmerksam zu machen. Sie war verängstigt, ansonsten aber unverletzt gewesen.
Die beiden Jungs, Patrick und Rhys, waren jedoch verschwunden.
Vada war, wie sie berichtete, in der Küche gewesen, um den Jungs einen Snack zuzubereiten, als zwei bewaffnete Männer von der Veranda durch die Glasschiebetür ins Haus eingedrungen waren. Sie hatten Sturmhauben und schwarze Rollkragenpullover getragen.
Vada hatten sie in den Keller geschleppt und gefesselt.
Nancy und Brooke hatten sofort die Polizei gerufen. Beide Väter, Hunter Moore, ein Arzt, und Chick Baldwin, ein Hedgefonds-Manager, waren von ihren Arbeitsplätzen herbeizitiert worden. Danach war etliche Stunden lang nichts geschehen – es gab weder Spuren noch sonstige Hinweise, und die Entführer meldeten sich nicht. Dann hatte Chick Baldwin unter seiner Firmenadresse eine E-Mail mit einer Lösegeldforderung erhalten. Sie stammte von einem anonymen E-Mail-Konto. Der Anfang der Mail beinhaltete eine eindringliche Warnung, auf keinen Fall die Polizei einzuschalten, wenn sie die Kinder lebend wiedersehen wollten.
Dafür war es zu spät.
In der Mail wurde von den Familien verlangt, zwei Millionen Dollar bereitzuhalten, »eine Million pro Kind«. Weitere Instruktionen würden folgen. Die Brookes und die Baldwins besorgten das Geld und warteten. Nach drei quälenden Tagen kam die nächste Mail, in der die Entführer verlangten, dass Chick Baldwin – »nur Chick Baldwin« – zum Overpeck Park fahren und das Geld an einem bestimmten Ort bei den Bootsrampen hinterlegen sollte.
Chick Baldwin folgte der Aufforderung.
Das FBI hatte natürlich eine vollständige Überwachung des Parks veranlasst und behielt sämtliche Ein- und Ausgänge im Auge. Außerdem hatten sie in der Tasche einen GPS-Sender platziert, wobei diese Technik vor zehn Jahren noch nicht ganz so ausgereift gewesen war wie heutzutage.
Bis zu diesem Zeitpunkt war es der Polizei gelungen, die Entführung geheim zu halten. Die Medien hatten nichts erfahren. Auf Drängen der Polizei waren weder Freunde noch Verwandte informiert worden – auch Win nicht. Selbst die anderen Kinder der Baldwins und der Moores waren im Dunkeln gelassen worden.
Chick Baldwin hatte das Geld abgelegt und war weggefahren. Eine Stunde war vergangen. Dann eine zweite. In der dritten Stunde hatte jemand die Tasche an sich genommen, wie sich herausstellte, handelte es sich jedoch nur um einen hilfsbereiten Jogger, der sie zum Fundbüro bringen wollte.
Sonst hatte niemand versucht, das Lösegeld abzuholen.
Die Familien hatten sich um Chick Baldwins Computer geschart und auf eine weitere E-Mail gewartet. Das FBI ging derweil ein paar Theorien nach. Zuerst hatten sie sich Vada Linna, das junge Au-pair-Mädchen, näher angesehen, aber nichts gefunden. Sie war damals erst seit zwei Monaten im Land, sprach kaum Englisch und hatte nur eine Freundin. Das FBI hatte ihre E-Mails durchforstet, ihre SMS, ihre Internet-Chronik, war aber auf nichts Verdächtiges gestoßen.
Danach hatte sich das FBI die vier Eltern der Kinder angesehen. Der Einzige, mit dem sie sich etwas länger beschäftigt hatten, war Rhys’ Vater Chick Baldwin gewesen. Erstens hatte er die Mail mit der Lösegeldforderung bekommen, vor allem aber war Chick ein etwas zwielichtiger Typ. Er war in zwei Fälle von Insiderhandel verwickelt, außerdem liefen mehrere Verfahren wegen Unterschlagung gegen ihn. Manche Leute behaupteten, bei seinem Fonds handele es sich um ein Schneeballsystem. Diverse Klienten – darunter ein paar sehr einflussreiche Personen – waren verärgert über ihn.
Aber so verärgert, dass sie so etwas anzetteln würden?
Also hatte auch das FBI auf eine weitere Nachricht von den Entführern gewartet. Ein weiterer Tag war verstrichen. Dann ein zweiter. Ein dritter, ein vierter. Kein Wort. Eine Woche verging.
Dann ein Monat. Ein Jahr.
Zehn Jahre.
Nichts. Keine Hinweise auf die Jungen.
Bis jetzt.
Als der Abspann begann, lehnte Myron sich zurück. Mia stellte sich zu ihm und sah ihn fragend an.
»Jetzt hätte ich gern den Cognac«, sagte er.
»Sofort.«
Als sie zurückkam, sagte Myron. »Setzen Sie sich, Mia.«
»Lieber nicht.«
»Wann haben Sie Win das letzte Mal gesehen?«
»Ich werde für meine Diskretion bezahlt.«
Myron verkniff sich eine dumme Bemerkung. »Es gab Gerüchte«, sagte er. »Über Win, meine ich. Ich habe mir Sorgen gemacht.«
Sie legte den Kopf schräg. »Vertrauen Sie ihm nicht?«
»Ich würde ihm mein Leben anvertrauen.«
»Dann sollten Sie seine Privatsphäre respektieren.«
»Das habe ich das ganze letzte Jahr getan.«
»In dem Fall kommt es auf die paar Stunden auch nicht mehr an.«
Natürlich hatte sie recht.
»Er fehlt Ihnen«, sagte Mia.
»Natürlich.«
»Er liebt Sie, das wissen Sie doch.«
Myron antwortete nicht.
»Sie sollten versuchen, ein bisschen zu schlafen.«
Auch da hatte sie recht. Er schloss die Augen, wusste aber, dass er nicht einschlafen konnte. Ein guter Freund hatte Myron vor Kurzem dazu überredet, es mit Transzendentaler Meditation zu versuchen, und obwohl er von dem Konzept nicht vollkommen überzeugt war, halfen ihm die Einfachheit und die Ruhe in solchen Augenblicken, wenn er nicht einschlafen konnte. Er stellte die Meditations-Timer-App – ja, er hatte eine auf seinem Handy – auf zwanzig Minuten, schloss die Augen und ließ sich fallen.
Die Leute glaubten, die Meditation würde den Geist leeren. Das war Unsinn. Man konnte den Geist nicht leeren. Je mehr man versuchte, an etwas nicht zu denken, desto intensiver dachte man daran. Wenn man wirklich entspannen wollte, musste man die Gedanken zulassen. Man lernte, sie zu beobachten, ohne sie zu werten oder darauf zu reagieren. Das tat Myron jetzt.
Er dachte an das Wiedersehen mit Win, an Esperanza und Big Cyndi, an seine Mutter und seinen Vater unten in Florida. Er dachte an seinen Bruder Brad, an seinen Neffen Mickey und an die Veränderungen in ihren Leben. Er dachte an Terese, die nach langer Zeit wieder in sein Leben zurückgekehrt war, an ihre bevorstehende Hochzeit, an ihr gemeinsames Leben, an die unerwartet greifbare Möglichkeit, glücklich zu werden.
Er dachte daran, wie erschreckend zerbrechlich ihm das alles vorkam.
Schließlich landete das Flugzeug, bremste, rollte zum Gate. Als es komplett zum Stehen gekommen war, zog Mia den Hebel und öffnete die Tür. Sie lächelte breit. »Viel Glück, Myron.«
»Ihnen auch, Mia.«
»Grüßen Sie Win von mir.«
3
Der Bentley wartete auf der Rollbahn. Als Myron auf die Gangway trat, öffnete sich die hintere Tür. Win stieg aus.
Myron beschleunigte seinen Schritt und spürte, wie ihm Tränen in die Augen schossen. Am Ende der Gangway, drei Meter vor seinem Freund, blieb er stehen, blinzelte, lächelte.
»Myron.«
»Win.«
Win seufzte. »Du willst, dass dieser Moment unvergesslich wird, richtig?«
»Was wäre das Leben ohne diese Momente?«
Win nickte. Myron trat vor. Die beiden Männer umarmten sich heftig, klammerten sich aneinander, als wäre der andere ein Rettungsfloß.
Ohne die Umarmung zu lockern, sagte Myron: »Ich habe tausend Fragen.«
»Und ich werde sie nicht beantworten.« Beide ließen los. »Wir müssen uns auf Rhys und Patrick konzentrieren.«
»Natürlich.«
Mit einer Geste forderte Win Myron auf, hinten einzusteigen. Myron tat das und rutschte durch, um Win Platz zu machen. Der Bentley war eine schwarze Stretch-Limousine. Die Trennwand zum Fahrer war geschlossen. Es gab nur zwei Sitze und eine gut ausgestattete Bar, sodass man viel Beinfreiheit hatte. Die meisten Stretch-Limousinen hatten mehr Sitze. Win hielt das für überflüssig.
»Ein Drink?«, fragte Win.
»Nein, danke.«
Der Wagen setzte sich in Bewegung. Mia stand vor der Flugzeugtür oben auf der Gangway. Win ließ das Fenster herunter und winkte. Sie winkte zurück. In Wins Miene lag Wehmut. Myron starrte seinen Freund an, seinen besten Freund, seit sie sich in ihrem ersten Jahr auf der Duke University kennengelernt hatten, und fürchtete, dass Win plötzlich wieder verschwinden könnte.
Win sagte: »Sie hat einfach ein Spitzen-Hinterteil, findest du nicht auch?«
»Mhm. Win?«
»Ja.«
»Warst du die ganze Zeit in London?«
Win blickte weiter aus dem Fenster und sagte: »Nein.«
»Wo dann?«
»An diversen Orten.«
»Es gab Gerüchte.«
»Ja.«
»Sie besagten, du wärst ein Einsiedler geworden.«
»Ich weiß.«
»Unwahr?«
»Ja, Myron, unwahr. Ich habe diese Gerüchte in die Welt gesetzt.«
»Warum?«
»Später. Jetzt müssen wir uns auf Patrick und Rhys konzentrieren.«
»Du sagtest, du hättest Patrick gesehen.«
»Ich glaube schon, ja.«
»Du glaubst es?«
»Patrick war sechs, als er verschwand«, sagte Win. »Er wäre jetzt sechzehn.«
»Also hattest du keine Möglichkeit, ihn genau zu identifizieren.«
»Korrekt.«
»Also hast du jemanden gesehen, von dem du glaubst, dass es Patrick war.«
»Wieder korrekt.«
»Und dann?«
»Dann habe ich ihn verloren.«
Myron lehnte sich zurück.
»Das überrascht dich«, sagte Win.
»Das tut es, ja.«
»Du denkst: ›Das sieht dir gar nicht ähnlich‹.«
»So ist es.«
Win nickte. »Ich habe mich verkalkuliert.« Dann fügte er hinzu: »Es gab Kollateralschäden.«
Das war bei Win nie gut.
»Wie viele?«
»Vielleicht sollten wir erst einmal kurz die Rückspultaste drücken.« Win zog einen Zettel aus seinem Jackett. »Lies das.«
Win reichte ihm etwas, das wie eine ausgedruckte E-Mail aussah. Sie war an Wins privates E-Mail-Konto geschickt worden. Im Lauf des letzten Jahres hatte Myron ein halbes Dutzend Mails an diese Adresse geschickt. Er hatte keine Antwort bekommen. Der Absender war anon5939414. Der Text lautete:
Sie suchen Rhys Baldwin und Patrick Moore. Die beiden waren in den letzten zehn Jahren meistens zusammen, aber nicht immer. Sie waren mindestens dreimal getrennt. Jetzt sind sie wieder zusammen.
Es steht ihnen frei zu gehen, sie würden aber vermutlich nicht mit Ihnen kommen. Sie sind nicht mehr diejenigen, für die Sie sie halten. Sie sind auch nicht mehr diejenigen, an die sich ihre Familien erinnern. Womöglich gefällt Ihnen nicht, was Sie finden. Die beiden befinden sich am unten angegebenen Ort. Die Belohnung interessiert mich nicht. Ich werde Sie eines Tages um einen Gefallen bitten.
Keiner der beiden erinnert sich wirklich an sein vorheriges Leben. Haben Sie Geduld mit ihnen.
Ein kalter Schauer lief Myron über den Rücken. »Ich gehe davon aus, dass du versucht hast festzustellen, woher diese Mail kam?«
Win nickte.
»Und des Weiteren gehe ich davon aus, dass du nichts gefunden hast.«
»Ein VPN«, sagte Win. »Unmöglich herauszubekommen, woher oder von wem die Mail stammt.«
Myron las sie noch einmal. »Dieser letzte Absatz.«
»Ja, ich weiß.«
»Der hat irgendwas.«
»Er wirkt authentisch«, sagte Win.
»Und deshalb hast du die Mail ernst genommen?«
»Ja«, sagte Win.
»Und die angegebene Adresse?«, fragte Myron.
»Das ist ein recht kleiner, aber sehr verkommener Ort in London. Eine Unterführung, in der die unterschiedlichsten illegalen Aktivitäten stattfinden. Ich habe sie inspiziert.«
»Okay.«
»Jemand, der den Alterungsbildern von Patrick sehr ähnlich sieht, ist dort erschienen.«
»Wann?«
»Etwa eine Stunde bevor ich dich angerufen habe.«
»Hast du ihn sprechen hören?«
»Wie bitte?«
»Hat er etwas gesagt? Ich versuche herauszubekommen, um wen es sich handelt. Vielleicht hatte er einen amerikanischen Akzent?«
»Nein, ich habe ihn nicht sprechen hören«, sagte Win. »Außerdem bringt uns das nichts. Er könnte sein ganzes Leben auf der Straße verbracht haben.«
Schweigen.
Dann wiederholte Myron: »Sein ganzes Leben?«
»Ich weiß«, sagte Win. »Es bringt nichts, darüber nachzudenken.«
»Du hast Patrick also gesehen. Und was dann?«
»Ich habe gewartet.«
Myron nickte. »Du hast also gehofft, dass Rhys auch auftaucht.«
»Ja.«
»Und dann?«
»Drei Männer, die offenbar nicht gut auf Patrick zu sprechen waren, haben ihn angegriffen.«
»Und du hast sie aufgehalten.«
Zum ersten Mal umspielte ein schwaches Lächeln Wins Lippen. »Das ist halt meine Art.«
Das stimmte.
»Alle drei?«, fragte Myron.
Win zuckte lächelnd die Achseln.
Myron schloss die Augen.
»Die Männer waren übelste Verbrecher«, sagte Win. »Denen wird niemand nachtrauern.«
»War es Selbstverteidigung?«
»Ja, okay, lass es uns so nennen. Wollen wir jetzt wirklich im Nachhinein eine kritische Diskussion über meine Methoden führen, Myron?«
Er hatte recht.
»Also, was ist passiert?«
»Während ich mit besagten Gangstern beschäftigt war, ist Patrick geflüchtet. Ich habe noch gesehen, wie er im Bahnhof King’s Cross verschwunden ist. Kurz darauf habe ich dich zu Hilfe gerufen.«
Myron lehnte sich zurück. Sie näherten sich der Themse an der Westminster Bridge. Das London Eye, dieses gewaltige Riesenrad, das sich in etwa mit der Geschwindigkeit eines Gletschers bewegte, schimmerte in der Nachmittagssonne. Vor Jahren war Myron einmal damit gefahren. Er hatte sich zu Tode gelangweilt.
»Dir ist doch bewusst«, sagte Win, »dass das hier eilt.«