

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
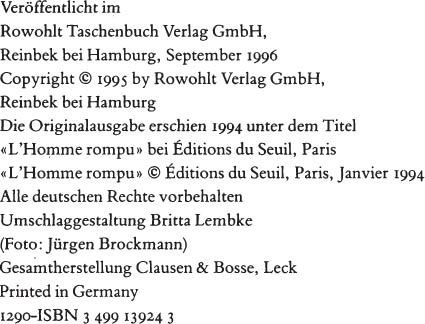
ISBN Printausgabe 978-3-499-13924-6
ISBN E-Book 978-3-688-10816-9
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-10816-9
DIESES BUCH verdanke ich Pramoedya Ananta Toer, dem großen indonesischen Schriftsteller, der heute unter Hausarrest in Djakarta lebt und nicht veröffentlichen darf.
Als ich nach Indonesien reiste, versuchte ich, ihn zu treffen, um ihn meiner Solidarität zu versichern und ihm meine Bewunderung auszudrücken. Man hat mir von einem Besuch bei ihm abgeraten. Ich hätte ihm damit schaden können.
Ich hatte dort seinen 1954 erschienenen Roman Korruption gelesen. Als Zeichen meiner Ehrerbietung und um ihm meine Unterstützung von Schriftsteller zu Schriftsteller auszudrücken, habe ich den Korrumpierten Mann geschrieben, einen Roman über die Korruption, diese Plage, die heutzutage in den Ländern des Nordens genauso alltäglich geworden ist wie in denen des Südens.
Die Geschichte spielt im heutigen Marokko. Ich möchte Pramoedya Ananta Toer damit sagen, daß die menschliche Seele unter einem anderen Himmel, Tausende Kilometer entfernt, manchmal den gleichen Dämonen nachgibt, wenn sie vom gleichen Elend zersetzt wird.
Diese ähnliche und doch andere, lokale und doch universelle Geschichte bringt uns Schriftsteller des Südens einander näher, selbst wenn dieser Süden im Fernen Osten liegt.
T.B.J.
WIE ÜBLICH ist der Bus zu spät, und als er endlich kommt, platzt er fast aus den Nähten. Ich sehe auf meine Uhr. Entweder bleibe ich bei meiner Absicht einzusteigen, wobei ich mich zwischen die anderen drängeln und einige Füße platt treten werde, oder ich gebe auf und riskiere, zu spät ins Büro zu kommen. Dabei bin ich doch immer pünktlich. Mehr aus Prinzip als aus Schrullenhaftigkeit. Mir bleiben zwei weitere Lösungen: ein Taxi nehmen – das kostet zehn Dirham, das heißt zwei Packungen Casasport bleu – oder zu Fuß gehen und außer Atem im Büro ankommen. Ich wollte das Rauchen schon lange aufgeben. In meinem Fall geht es dabei mehr um Sparen als um Schonung für die Lungen. Beim letzten Arztbesuch hat mir der Dienstarzt gesagt: «Herr Mourad, für einen Raucher wie Sie sind Ihre Lungen sauber.» Ich habe mir nur das gemerkt. Doch wenn ich lange zu Fuß gehe oder Treppen steige, gerate ich außer Atem, und das hat der Arzt nicht gesehen. Ich beschließe also, ein Taxi zu nehmen, und schwöre mir, keine Zigaretten mehr zu kaufen. Der Fahrer ist schlecht gelaunt. Er kurbelt immer wieder sein Fenster hinunter, spuckt auf die Straße und stößt Beschimpfungen aus. Ich wage nicht, ihn zu fragen, auf wen er es abgesehen hat. Der Fahrer redet vor sich hin. Dann wendet er sich mir zu und sagt: «Seit zehn Jahren fahre ich diese Taxe; stellen Sie sich vor, ich zahle immer noch ab für den, der mir die Lizenz besorgt hat. Das ist ein Hurensohn! Ich arbeite Tag und Nacht, um meine Schulden abzuzahlen. Den Hurensohn selbst sehe ich nicht mehr. Er hat sein Geld. Aber ich schulde es meinem Onkel, der es mir vorgestreckt hat. Das war die einzige Möglichkeit.»
Unterwegs mache ich meine tägliche Abrechnung: Taxi: 10 Dirham; Mittagessen: 33 Dh.; Kaffee: 5 Dh.; Zigaretten: 5 Dh.; 54 Dh. für das Geographiebuch für Wassit; und dann brauche ich mindestens 100 Dh. für den Arztbesuch der Kleinen, dazu noch die Medikamente. Kurz und gut, es reicht hinten und vorne nicht. Das ist nichts Neues. Ich weiß es, und falls ich es vergessen sollte, erinnert mich meine Frau Hlima daran.
Im Büro sagt mir der Schaouch kaum merklich guten Tag. Hier hängt die Herzlichkeit der Begrüßung nicht vom Dienstgrad ab, sondern vom Zusatzverdienst, den die Stelle abwirft. Ich bin Ingenieur. Meine Aufgabe ist es, im Rahmen der Verwaltung die Akten zu den Bauvorhaben zu bearbeiten. Ohne meine Unterschrift gibt es keine Baugenehmigung. Es ist ein bedeutender und sehr geneideter Posten. Mein genauer Titel klingt pompös: «Stellvertretender Leiter für Planung, Prospektion und Fortschritt». Zu etwas müssen mein teilweise durch Studien an einer französischen Hochschule erworbenes Ingenieurdiplom und mein Abschluß in Wirtschaftswissenschaften an der Mohammed-V-Universität von Rabat schließlich gut sein.
Mit meinem bescheidenen Gehalt bestreite ich den Lebensunterhalt meiner Familie, zahle das Schulgeld meiner Kinder, die Miete und unterstütze meine Mutter. Ich komme nicht hin. Ich lebe, dem Krämer sei Dank, auf Pump. Ich weiß, daß ich mir kein drittes Kind leisten kann.
Auch wenn ich immer wieder zu hören bekomme, daß jede Geburt ein Kapital ist, daß Gott Wege findet, die Bedürfnisse der von ihm geschaffenen Wesen zu befriedigen, ich bleibe unerbittlich, und um die Debatte zu beenden, habe ich Hlima gezwungen, sich eine Spirale einsetzen zu lassen. Da hat sie mir wütend entgegengeschleudert: «Dein Mitarbeiter, das ist wenigstens ein richtiger Mann! Er verdient weniger als du und lebt in einer prachtvollen Villa, hat zwei Autos, seine Kinder gehen auf die französische Schule, und außerdem schenkt er seiner Frau einen Ferienaufenthalt in Rom! Du dagegen schenkst mir eine Spirale, und wir essen nur zweimal in der Woche Fleisch. Das ist kein Leben. Die Ferien verbringen wir bei deiner Mutter, in diesem alten Haus in der Medina von Fes. Das nennst du Ferien. Wann wird dir endlich bewußt, wie mies unsere Lage ist?»
Meine Lage ist mehr als mies, sage ich mir. Ist es meine Schuld, daß alles teurer wird, daß die Reichen immer reicher werden und die Armen wie ich ihrer Armut verhaftet bleiben? Ist es meine Schuld, daß die Dürre die Armen weiter verarmt hat? Was tun? Stehlen? Sich das Eigentum der anderen aneignen und sie glauben lassen, Anlagen würden ihnen mehr einbringen?
Während ich darüber nachdenke, betritt mein Stellvertreter Hadj Hamid pfeifend den Raum.
– Tag, Chef! Wie war die Nacht?
– Danke, gut.
Am meisten hasse ich an diesem Menschen seine Arroganz und sein Lächeln, das unendlich viel unterstellt. Auch wenn wir nicht im selben Büro sitzen – eine gläserne Tür trennt uns –, geht mir dieses Individuum auf die Nerven. Ich mag sein süßliches Rasierwasser nicht. Um die Wirkung dieses Duftes zu verringern, muß ich die Fenster aufreißen. Ich mag auch das Geräusch seines goldenen Armbands beim Schreiben nicht. Hadj Hamid ist das Gegenteil eines kultivierten Menschen. Wahrscheinlich hat er noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen. Morgens verbringt er eine gute Stunde mit der Lektüre der marokkanischen Presse. Ich frage mich, wie man so viel Zeit mit dem Lesen so nichtssagender Zeitungen verbringen kann. Vielleicht liest er sie ja auch nicht. Und tut nur so. Spielt sich auf. Ab und zu kommentiert er mit lauter Stimme, zum Beispiel: «Saddam, das ist doch ein richtiger Mann!» Ich verspüre wirklich den Drang, zu reagieren und etwa zu sagen: «Du nennst den einen richtigen Mann, der sein Volk acht Jahre lang in den Iran zur Schlachtbank geschickt hat und dann noch alles tat, um einen Krieg mit der halben Welt herbeizuführen?» Doch ich schweige lieber. Ich habe sowieso keine Wahl. Wenn ich anfange, mit Hadj Hamid zu diskutieren, muß ich weit ausholen und nichts beiseite lassen. Jedoch gibt es Dinge, die ich bemerke und nicht zur Sprache bringen möchte, wie zum Beispiel den Besuch von Hakim, einem reichen Großgrundbesitzer, der sich mit Vorliebe in Metaphern und Andeutungen ausdrückt. Oft benutzt er Sprichwörter. Manche sind schön und rätselhaft wie dieses: «Das Minarett ist zu Fall gebracht, der Friseur wurde erhängt» oder jenes: «Küsse die Hand, die du nicht beißen kannst». Ich weiß, daß die Verhandlungen außerhalb des Büros stattfinden. Hierher kommt Hakim der Form halber, um Dokumente zu bringen oder abzuholen. Ihr Getue entgeht meinem mißlaunigen, jedoch anwesenden Auge nicht. Es gibt auch Geschenke in Form von Naturalien, Säcke Weizen, Kästen Obst oder ein Schaf zum Aïd el Kebir, dem Opferfest. All das wird der Großzügigkeit der Bauern zugeschrieben. Hadj Hamid schätzt diese Gesten sehr. Einfach so, ohne Grund. Weder angezeigt, noch denunziert. Keine vertraulichen Berichte. Jedenfalls gibt es keine Beweise. Das ist das Wesen der Korruption: sie ist nicht direkt sichtbar. Man könnte höchstens eine Falle stellen. Dazu bin ich nicht schlau genug. Ich habe keine Polizistenseele, selbst wenn mir sehr der Sinn danach steht, das Land von solchen Praktiken zu säubern. Sicher, ich bin der Boß, auch wenn ich feststellen muß, daß meine Macht bedroht ist. Sicher, ich unterschreibe die Papiere, doch es ist nicht auszuschließen, daß es geheime mündliche Verhandlungen gibt. Ansonsten müßte ich Tag und Nacht mit Hadj Hamid verbringen. Ihm nicht von der Seite weichen. Nein, das ist unmöglich. Gott sei Dank sitzen wir nicht im gleichen Büro. Er ist langweilig, eingebildet und hochnäsig. Ich erinnere mich an jenen ägyptischen Polizeibeamten, der einzog bei der Person, die er bewachen sollte. Dieses enge Zusammenleben hat ein böses Ende gefunden. Der Überwachte hat den Polizisten schließlich umgebracht. Ich möchte nicht wegen dieses schleimigen Mitarbeiters sterben. Möglicherweise ist er der einzige Mensch im ganzen Hoch- und Tiefbauamt, der sich Brillantine ins Haar schmiert. Auch das ist unerträglich. Dieser Geruch nach ranzigem Öl bringt mich auf. Vielleicht werde ich ihn eines Tages erwürgen. Jedenfalls wird er nicht befördert. Braucht er auch gar nicht. Sein Gehalt ist rein symbolisch. Die paar tausend Dirham reichen nicht für seine Europareisen und seine Omra, die kleine Pilgerreise nach Mekka, alle zwei Jahre.
Die Schaouchs mögen Hadj Hamid. Er ist großzügig, beredt, aufmerksam. Er kennt ihre Probleme, hilft ihnen, gibt ihnen abgelegte Kleider, vergißt zu den Feiertagen nie ihre Kinder. Er ist ein guter Mensch. Freitags verläßt er das Büro um elf und geht in die Moschee. An dem Tag ist er ganz in Weiß; Djellaba, Hemd, Serual, Pantoffeln, alles weiß. Nach dem Gebet geht er zum Mittagessen und erscheint mit einer guten halben Stunde Verspätung im Büro. Ich sage nichts. Ich notiere mir seine Verspätungen und die jeweiligen Daten. Man kann nie wissen. Vielleicht gibt es eines Tages ein Disziplinarverfahren gegen ihn, oder er wird sogar vor Gericht zitiert. Aber so etwas passiert so gut wie nie. Ich erinnere mich an einen meiner Vettern, der den größten Teil seines Lebens Volksschullehrer war und eines Tages Schulinspektor wurde und die Möglichkeit entdeckte, sich mit den Inspektionsberichten etwas dazuzuverdienen. Kaum hatte er begonnen sich zu bereichern, wurde er angezeigt und verhaftet. Vor dem Untersuchungsrichter versuchte er sein Benehmen zu rechtfertigen und erklärte, daß die schlechte Bezahlung der Leute die Korruption geradezu herausfordert. Er hielt einen ziemlich detaillierten Vortrag über das, was er die Schattenwirtschaft nannte, die die Löcher im Staatshaushalt stopft, und er forderte zum Schluß die Legalisierung dieses persönlichen Beitrags der Leute, um das Land weiterzubringen. Seine kluge Rede riß ihn noch mehr hinein. Er wurde zu fünf Jahren ohne Bewährung verurteilt. Drei Jahre später wurde er freigelassen, er hatte eine Wut im Bauch und verschwand. Einige sagen, er handele mit Rauschgift, andere behaupten, er sei nach Kanada ausgewandert, wo er gefälschte Perserteppiche verkaufe.
Es gibt auch jenen geheimnisvollen Besucher, einen großen kahlköpfigen Menschen, der sich Marrakchi nennt. Sobald er das Büro Hadj Hamids betritt, erhebt der sich und geht mit ihm auf den Flur. Anscheinend bereiten ihm diese Besuche wenig Freude. Danach ist er oft schlecht gelaunt. Ich glaube, daß dieser Mensch Hadj Hamid erpreßt. Zu gerne würde ich dieses Geheimnis lüften, mit ihm diskutieren und ihn eventuell als Zeugen einsetzen. Doch das ist unmöglich. Ich bin ein ruhiger Mensch. Mir geht es einzig und allein darum, in Würde die Zukunft meiner Kinder zu sichern. Ich bin zu allen Opfern bereit, doch nicht dazu, meine Prinzipien zu verletzen und wie die anderen zu handeln. Manchmal bereue ich jedoch einen kurzen Augenblick lang, das Bündel Geldscheine nicht genommen zu haben, das Herr Foulane, ein Immobilienspekulant, auf einen Kaffeehaustisch in der Stadt gelegt hatte. Es müssen bestimmt eine Million Centimes gewesen sein. Mit einer Million könnte ich ein Moped, ein Kleid für Hlima und einen Sonntagsanzug für jedes der Kinder kaufen; wir würden alle gemeinsam zum Fischessen in ein Restaurant gehen, ich würde amerikanische Zigaretten rauchen und mir vielleicht eine Montechristo Spezial Nr. 1 leisten für achtzig Dirham, den Preis zweier normaler Essen. Eine Unterschrift, eine kleine Unterschrift unten auf einer Seite würde genügen. Nein, ich bin nicht käuflich. Wütend war ich aufgestanden und aus dem Kaffeehaus gestürmt. Foulane hatte mich eingeholt: «Aber, man hat mir versichert, eine Million sei genug … Wenn Sie mehr wollen, können wir uns sicher einigen, nehmen Sie dies hier als Vorschuß, und nach der Unterzeichnung bekommen Sie den Rest …» Ich hatte ihn angesehen und dann auf den Boden gespuckt: «Ich bin nicht bestechlich.»
War ich wütend, weil jemand an meiner Redlichkeit gezweifelt hatte oder weil ich im Grunde meines Herzens bereute, so viele Skrupel zu haben? Diese Frage bohrt weiter in mir. Ich darf auf keinen Fall mit meiner Frau darüber sprechen. Sie wäre imstande, mich zur Tür hinauszuwerfen. Ihre Zornesausbrüche sind furchtbar. Sie näht in Heimarbeit, damit wir über die Runden kommen. Sie sagt oft, daß sie kein Glück hat. Alle ihre Schwestern haben begüterte Männer geheiratet und führen ein gutes Leben. Sie hat mich aus Liebe geheiratet. Wir haben uns auf der Universität kennengelernt. Kurz nach unserer Heirat wurde Hlima schwanger und konnte weder ihr Studium fortsetzen noch eine Ganztagsarbeit annehmen. Die Dinge entwickelten sich langsam, vor allem unter dem Druck der Familie, zum Schlechteren. Sie könnte mit einem Ehemann mit bescheidenem Auskommen in Frieden leben, doch ihre Umgebung paßt auf und hält sie zur Aufmüpfigkeit an. Ihr Vater sagt nichts. Er schätzt mich, kennt meine Ernsthaftigkeit und meine Ehrlichkeit. Die Mutter ist scheinheilig. Sie ist äußerst freundlich zu mir, doch sobald ich den Rücken gekehrt habe, macht sie sich über mich lustig. Sie findet mich klein, arm und farblos. Nie verpaßt sie eine Gelegenheit, mir gegenüber Bemerkungen fallenzulassen wie: «Sidi Larbi kauft ein neues Auto, ich könnte meine Tochter bitten, mit ihm zu reden, damit er Ihnen sein altes zu einem guten Preis verkauft … Was so ein Auto wohl kosten mag? Fünf, sechs Millionen, das ist doch heute kein Geld mehr!»
Dieser Sidi Larbi ist genau der Typ, den ich nicht ausstehen kann. Ein unlauterer Rechtsanwalt, der sich an Schmerzensgeld bei tödlichen Autounfällen bereichert. Er einigt sich mit den Versicherungen, gibt einen Teil an die Familien der Opfer und teilt sich den Rest mit einer Reihe von Versicherungsagenten. Sein Wohlstand ist augenfällig, und er schläft sehr gut. Er kann überall und zu jeder Zeit einschlafen. Er schlingt beim Essen, rülpst und hält schnarchend seinen Mittagsschlaf. Das Geld kommt von überall, und nichts kümmert ihn. Für ihn bin ich ein Versager, ein armer Typ, der sich dem modernen Leben nicht anpassen kann.
Es stimmt, ich konnte mich nie anpassen, wie sie sagen. Was heißt sich anpassen? Es wie die anderen machen, im richtigen Moment die Augen zudrücken, seine Prinzipien und Ideale beiseite schieben, keinen Sand ins Getriebe streuen, kurz und gut: stehlen lernen und die anderen daran teilnehmen lassen. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht einmal lügen. Ich bin nicht schlau. Ich weiß, daß ihre «Maschine» nicht mit Leuten wie mir läuft. Ich bin das Sandkorn, das hineingerät und sie zum Knirschen bringt. Ich gebe zu: mir gefällt diese Rolle. Sie ist einzigartig, selten und notwendig. Ich opfere mich auf, auch wenn meine Frau und meine Kinder es dadurch schwer haben. Darauf bin ich stolz. Daß sie sich davon nichts kaufen können, weiß ich auch. Ich will gar nicht weiter darauf herumhacken. Ich weiß nur, daß meine Schwiegermutter nicht nur scheinheilig ist, sondern daß sie in einem anderen Zusammenhang eine gute Puffmutter abgegeben hätte. Sie hat ihre Töchter ja auch nicht nach dem moralischen oder intellektuellen Status der Bewerber verheiratet, sondern nach deren finanzieller Situation. Man könnte sagen, sie verhökerte ihre Töchter an die Meistbietenden. Natürlich spielt sich das alles auf versteckte, verschleierte, indirekte Weise ab, nie offen. Nur ich werde schlecht von ihr behandelt, ich verderbe das Gesamtbild. Ich bin ihr Irrtum, der nie Aufnahme in diese Familie hätte finden dürfen. Sie hatte es ihrer Tochter gesagt, aber schließlich nachgegeben und auf meine mögliche Anpassung an die Maschine gezählt. Ich habe sie enttäuscht. Ich bleibe passiv, ruhig und rege mich nicht auf. Doch das Geschrei meiner Frau schmerzt mich. Sie versteht mich nicht. Zwischen ihr und mir gibt es keine Solidarität, keine Komplizenschaft. Wir sind arm und sollten nicht über unsere Verhältnisse leben, als seien wir reich. Das ist doch einfach, aber sie weigert sich, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Sie regt mich auf mit ihrer Manie, Vergleiche zu ziehen. Ich hasse es, wenn man das Unvergleichbare miteinander vergleicht. Zwischen Sidi Larbi und mir klafft ein Abgrund. Wir haben nichts gemeinsam.
Warum habe ich Hlima geheiratet? Das frage ich mich oft selbst. Ich versuche, in meinem Gedächtnis den verhängnisvollen Augenblick wiederaufleben zu lassen, an dem diese Entscheidung fiel. Ich bin nicht einmal sicher, daß ich mich entschied. Wahrscheinlich haben sie etwas nachgeholfen. Wie ich feststelle, trifft der Mensch oft ziemlich schnell und sogar leichtfertig eine Entscheidung von großer Bedeutung und Tragweite, ohne sich darüber im klaren zu sein, daß er sein kostbarstes Gut, seine Freiheit, und manchmal sein ganzes Leben aufs Spiel setzt. Der gleiche Mensch überlegt stundenlang, bevor er irgendeinen Gegenstand kauft, zögert bei der Wahl zwischen zwei Hemden oder zwei Krawatten, bittet einen Freund oder einen Automechaniker um Rat, bevor er sich zum Beispiel für ein Auto entscheidet.
Mir scheint, ich hatte nicht einmal das Recht zu zögern oder nachzudenken. Dazu muß man wissen, daß Hlima die älteste Tochter war und möglichst schnell unter die Haube gebracht werden mußte, um den jüngeren Schwestern den Weg freizumachen. Wir hatten uns an der Universität kennengelernt, ich liebte ihren üppigen Mund und ihre prallen Brüste. Ich träumte wie ein Kind von ihr. Ich begehrte sie. Wollte meinen Sexualtrieb befriedigen. Sie war da, verweigerte sich mir aber. Es war klar, welcher Preis entrichtet werden mußte: die Ehe, denn in ihrer Familie berührt man außerhalb der Ehe keinen Mann. Das sagte sie mir und beugte sich über mich, ihre herrlichen Brüste lugten hervor, einige Sekunden lang, dann richtete sie sich auf und sagte mir blinzelnd, daß sie meine Nase liebte. Das überraschte mich. Es war das erste Mal, daß jemand meine Nase erwähnte, an der nichts Besonderes ist. Ich fand es amüsant. Ließ mich gehen, nahm ihre Hand und führte sie an meine Lippen, wie ich es bei Cary Grant und Ingrid Bergman gesehen hatte. Das war meine romantische Viertelstunde. Ich glaubte, das Leben sei Kino. Meinen Film ließ ich auf großer Leinwand in Schwarzweiß ablaufen, mit Jazzmusik, Duke Ellington am Klavier, und mir, der ich mich Hlima mit klopfendem Herzen näherte; sie, in Großaufnahme, mit bebenden Lippen, schließt die Augen, um ihren ersten Kuß zu bekommen, läßt sich in meine Arme fallen, während ich auf die Uhr schiele, denn sie muß vor der Rückkehr ihres Vaters zu Hause sein.
Unser Kino dauerte einige Wochen. Wir konnten nirgendwo hingehen. Wir fanden für unsere Flirts in den dunklen Lichtspielsälen Unterschlupf bis zu dem Tag, an dem uns ihr großer Bruder erwischte. Da verstand ich, daß es keinen Frieden geben würde, bis ich diese Beziehung vertraglich festschrieb. Einmal, ein einziges Mal, waren wir alleine und fast nackt im Zimmer eines Freundes, der mir die Schlüssel überlassen hatte und ins Wochenende gefahren war. Sie hatte mich total erschöpft. Ich mußte mit ihr kämpfen, damit sie ihre Kleider auszog. Es gelang mir, ihr den Büstenhalter zu entreißen, doch sie behielt das Höschen an. Da war sie schon stärker als ich. Ihr Körper gab sich nicht hin, er mußte bezwungen werden, und das einzige Mittel war der legale Weg, der mich ein Leben lang an die Kette legen würde.
Als ihr Bruder mich vor der Uni erwartete, wußte ich, daß sie untereinander alles geregelt hatten. Das Kino und sogar das Zimmer meines Freundes waren ein abgekartetes Spiel gewesen. Ihr Bruder sollte uns überraschen, hatte sich aber zufälliger- oder glücklicherweise in der Etage geirrt. Doch das alles sagt mir nicht, warum ich sie geheiratet habe. Sicher, ich wollte sie besitzen, wußte aber wenig über ihre Familie.
War es Liebe? Meine Schüchternheit, meine Komplexe und meine Ernsthaftigkeit waren Hindernisse auf dem Weg zur Wahrheitsfindung. Heute weiß ich, daß ich sie begehrte. In der ersten Zeit unserer Ehe verbrachten wir viel Zeit damit, uns zu lieben. Verwunderlich war, daß sie im Bett außer Rand und Band geriet. Sie liebte mit dem ganzen Körper. Eines Tages zog sie ein islamisches erotisches Handbuch von Scheik Nafzaoui unter dem Bett hervor und beschloß, daß wir einen Monat lang alle vom Scheik beschriebenen Stellungen durchproben würden. Es waren neunundzwanzig. Das war komisch: wir liebten uns mit einem Handbuch vor Augen. Sie kannte dieses Buch auswendig und trug mir ganze Absätze daraus vor. Einige Bezeichnungen von Stellungen sind mir im Gedächtnis geblieben; ich fand sie lustig, wie zum Beispiel «der Koitus des Schmieds», «der Kamelhöcker» oder «die Archimedesschraube», usw. Warum Schmied? Zu einem bestimmten Zeitpunkt liegt die Frau auf dem Rücken, «ihre Knie beugen sich hin zur Brust, damit ihre Vulva hervorragt, der Mann vollführt die Bewegungen des Koitus und zieht sein Glied dann heraus und läßt es zwischen die Schenkel der Frau gleiten, wie der Schmied, der das glühende Eisen aus dem Feuer zieht …»
Wir vergnügten uns genausoviel bei der Lektüre wie beim Versuch, Scheik Nafzaouis Ratschläge anzuwenden. Neunundzwanzig verschiedene Arten. Eine pro Tag. Doch im großen und ganzen ähneln sie einander alle: die Frau liegt immer unter dem Mann.
Am Tag ihrer Menstruation legte sie sich auf den Bauch, schob ein Kissen unter sich, um den Hintern schön hochzuhalten und bedeutete mir, sie von hinten zu nehmen. Diese Stellung wurde im Buch nicht dargestellt. Ich glaube sogar, daß der Scheik davon abrät, sich der Frau während ihrer Tage zu nähern.
Ich weigerte mich. Ich mag keine Sodomie. An jenem Tag wandte sie sich zum ersten Mal gegen mich. Sie stand auf und sagte: «Du bist kein Mann!» Ich saß auf der Bettkante, mein Schwanz war auf seinen kleinstmöglichen Umfang zusammengeschrumpft; ich kam mir lächerlich vor und begriff, daß mein Leben sich durch diese Beschimpfung und vor allem durch meine fehlende Reaktion nach und nach zu etwas wandeln könnte, das bald der Hölle gleichkommen würde.
Am nächsten Tag versuchte ich, mit ihr über den Zwischenfall des Vortags zu sprechen. Es war verlorene Liebesmühe. Sie hatte ihre eigene Definition von Männlichkeit, und ich erfuhr bestürzt, daß körperliche Gewaltanwendung – Schläge – eines der Zeichen dafür war. Sie forderte mich also auf, sie zu schlagen, während wir uns liebten. Wir waren weit entfernt von den zarten, romantischen Küssen zwischen Cary Grant und Ingrid Bergman. Wir waren im Alltag gelandet. Sie teilte mir mit, sie sei schwanger, und ich sei während dieser Zeit gebeten, sie nicht anzufassen. Ich gebe zu, daß mir dieses Verbot entgegenkam. Ich schlief alleine im Wohnzimmer und begann, an meine Kusine Najia zu denken, die gerade ihren Mann verloren hatte.
Mit Najia war es Liebe. Ich liebte ihre Stimme, die Sanftheit ihrer Bewegungen, das Vergnügen, das sie beim Sprechen über die von ihr gelesenen Bücher verspürte, die Verschämtheit bei unseren Begegnungen. Ich sah sie fast heimlich, wenn sie meine Mutter, ihre Tante, in Fes besuchte. Sie kam mit ihrer Mutter, und während die beiden Schwestern sich unterhielten, trafen wir uns auf der Terrasse wie Kinder und plauderten. Damals war sie mit einem jungen Arzt verlobt. Sie liebte ihn. Ich wußte das und wagte nicht, ihr meine Gefühle zu gestehen. Wenn sie mir Fragen nach Hlima stellte, antwortete ich ausweichend. Ich wollte sie nicht in meine Geschichten hineinziehen. Ich hätte beharrlich sein können und sie vielleicht geheiratet, doch meine Mutter sagte mir, sie sei meine «Milchschwester»; sie habe sie während der Krankheit ihrer Schwester gestillt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Jedenfalls wurde das als Hauptgrund angeführt. Vielleicht wollten die beiden Schwestern keine Heirat zwischen Vetter und Kusine und benutzten diese Ausrede, um jeden Versuch eines Verhältnisses zu unterbinden.
Sie sieht ihren Vater, der eine zweite Frau geheiratet hat, nur selten.
Wenn ich wieder an Najia denke, wird mir das Ausmaß des Irrtums klar, den ich beging, als ich Hlima heiratete, die mit einem Rohling oder einem bestechlichen Mann glücklicher geworden wäre.
Ich erinnere mich an die ersten Jahre, als ich meinen Dienst in dem dem Wirtschaftsministerium unterstellten Bauamt antrat. Hlima schlug mir als erste vor, eine Kommission für jede von mir unterzeichnete Akte zu verlangen. Das führte zu einer unserer heftigsten Auseinandersetzungen. Zuerst versuchte ich, ihr zu erklären, daß die Korruption ein Krebs sei, der das Land zerfrißt, und daß meine Erziehung, meine Moral und mein Gewissen sich diesen Praktiken entschieden entgegenstellen. Sie sagte mir zum zweiten Mal, ich sei kein Mann! Diesmal lachte ich. Das ertrug sie nicht und begann, mir Gegenstände an den Kopf zu werfen. Um ihrer Hysterie Einhalt zu gebieten und sie zu beruhigen, sah ich in ihr eine Art Feuersbrunst, stürzte ins Bad, füllte einen Eimer mit Wasser und goß ihn über ihr aus. Das wirkte sofort. Ihr ganzer Körper war naß, sie setzte sich auf den Boden und weinte leise vor sich hin. Sie stammelte Dinge wie: «Ich sage dir das zu deinem Besten, zum Besten deines zukünftigen Sohnes, wenn du arm bleiben willst, ist das deine Sache, ich mag die Armen nicht …»
Damals waren wir nicht arm; wir lebten bescheiden. Ich dachte manchmal daran, die Arbeit zu wechseln. Mit meinem Ingenieurdiplom hätte ich eine Anstellung bei einer Privatfirma finden können. Dafür brauchte man Beziehungen, mußte einflußreiche Leute kennen, zu ihren Kreisen zählen, zu ihrer Klasse gehören. Deshalb versuchte ich es erst gar nicht. Das lag nicht an mangelndem Ehrgeiz, sondern eher an meiner Schüchternheit. Doch im Umgang mit denen, die bestechen, bin ich nie schüchtern gewesen. Darin liegt mein ganzer Stolz. Mein Widerstand war stets lückenlos. Wenn ich mich einem Menschen gegenübersah, der mich zu kaufen versuchte, wurde ich stark und mutig. Ich hielt ihm keine Moralpredigten. Ich erhob mich und setzte ihn wortlos an die Luft. Der Mensch machte sich rücklings davon, und ich setzte mich gelassen wieder hin und arbeitete weiter. So kam ich zu dem Ruf, ein «Mann aus Eisen» zu sein. Doch für die anderen war ich «Sandkorn».
Einmal habe ich zum Zeitvertreib in ein Heft die verschiedenen Weisen notiert, auf die man mich zu bestechen versuchte. Da gab es den, der einen Besitztitel auf meinen Schreibtisch legte. Ein Grundstück am Stadtrand. Dann der Direktere, der am Vorabend des Aïd