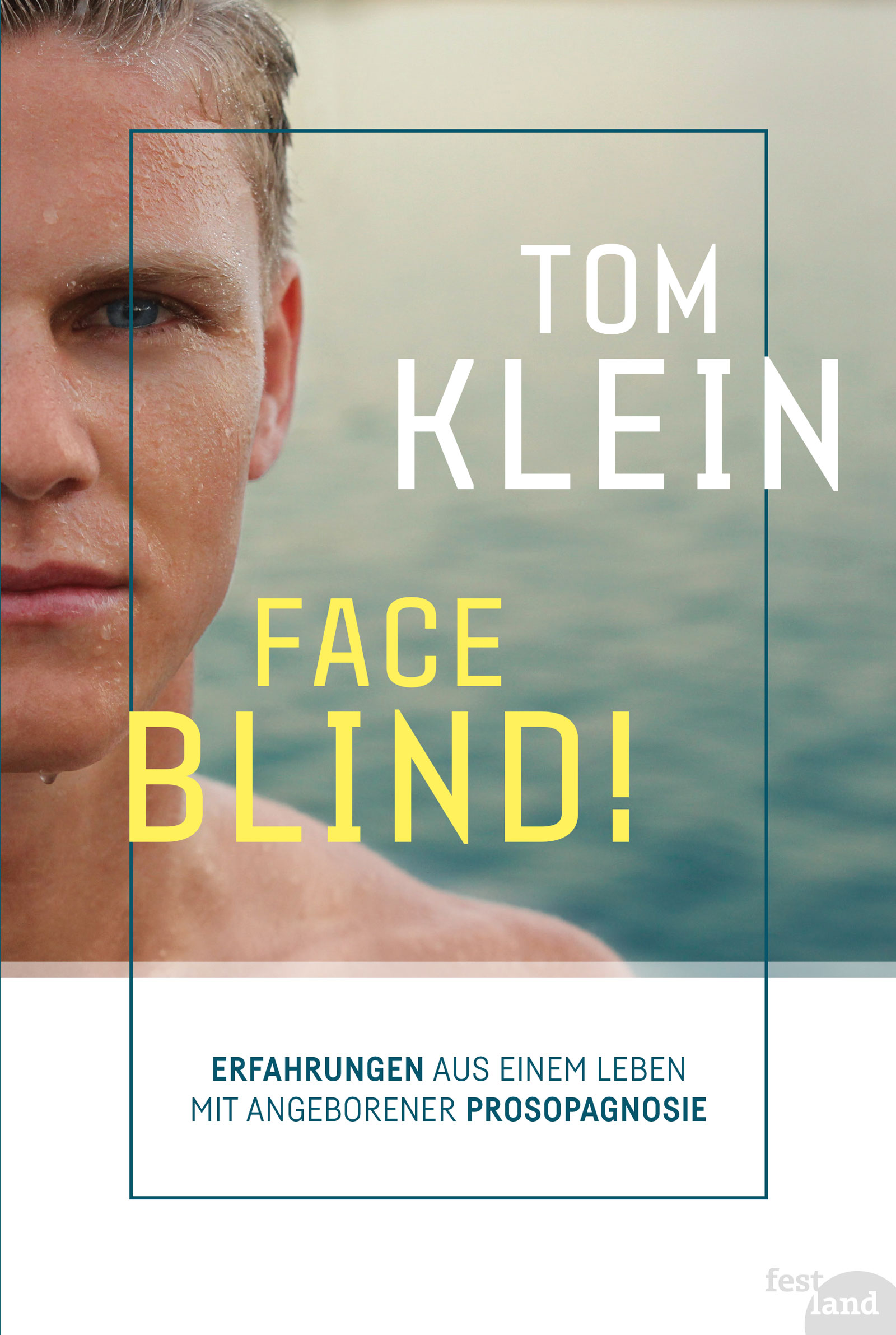
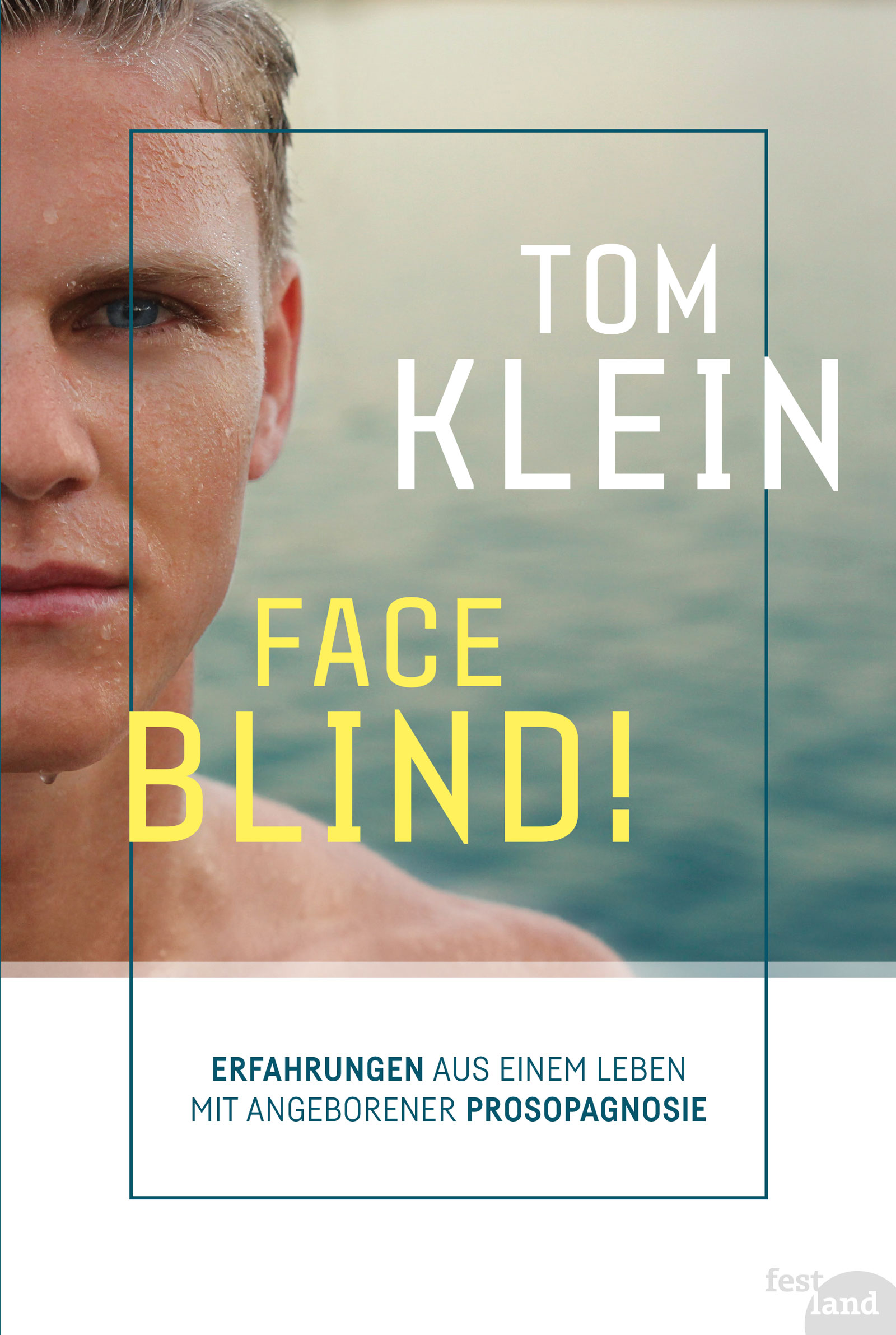
Face Blind!
Erfahrungen aus einem Leben
mit angeborener Prosopagnosie
von
Tom Klein
Dieses Buch ist meiner Frau gewidmet,
ohne die ich bis heute nicht wüsste,
dass ich gesichtsblind bin.
TOM
KLEIN
ERFAHRUNGEN AUS EINEM LEBEN
MIT ANGEBORENER PROSOPAGNOSIE
FACE
BLIND!
www.festland-verlag.com
© Copyright Festland Verlag e.U., Wien 2016
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, insbesondere die des Drucks, des Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, der Veröffentlichung im Internet, der Übersetzung, der Reproduktion oder Nutzung in irgendeiner Form, auch in Teilen, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Verlag.
Genehmigungen zur auszugsweisen Verwendung in Kleinauflagen als Lehrmaterial werden üblicherweise kostenlos gewährt, müssen jedoch auch vorab schriftlich mit Angaben über die Art der Lehrveranstaltung und die Auflagenhöhe eingeholt werden.
Umschlaggestaltung und Satz: Thomas Wukovits, Wien
Umschlagfoto: Christopher Campbell, www.unsplash.com
Gedruckt und gebunden in Ungarn, Interpress
ISBN 978-3-9504121-8-5
Wichtige Hinweise:
Die in diesem Buch vorgestellten Informationen sind sorgfältig recherchiert und wurden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Dennoch übernehmen Autor und Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Anwendung oder Verwertung der Angaben in diesem Buch entstehen. Insbesondere kann das Lesen dieses Buches weder Arztbesuch noch Psychotherapie ersetzen und ist auch nicht für Diagnosezwecke geeignet.
Um die Privatsphäre der in diesem Buch vorkommenden Personen zu wahren, wurden Namen und Orte teilweise verändert.
Vorwort
»Du solltest ein Buch schreiben!« Diesen Satz habe ich in meinem Leben schon dutzende Male gehört. Meistens habe ich auf diesen Vorschlag die Gegenfrage gestellt, worüber denn ausgerechnet ich schreiben sollte. Wie selbstverständlich bekam ich von verschiedensten Gesprächspartnern in verschiedensten Situationen die immer gleiche Antwort: »Ja über dein Leben!«
Irgendwie war Familie, Freunden und Bekannten klar, dass mein Leben alles andere war als durchschnittlich. Dieses Gefühl habe auch ich jahrelang mit mir herumgetragen. Jedoch konnte niemand so genau sagen, was anders war.
Sicher habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt. Auf der Welt bin ich viel herumgekommen. Seit meiner Kindheit erzähle ich gerne über meine alltäglichen Erlebnisse. Wenn ich damals vom Spielen nach Hause kam, hatte ich immer zuerst das Bedürfnis, zu berichten. Dieses Mitteilungsbedürfnis in meinem engeren persönlichen Umfeld hat einerseits damit zu tun, dass ich intensiven Kontakt zu Menschen mag und von Natur aus sehr kommunikativ bin. Andererseits fühlte ich mich oft missverstanden, und hatte permanent das Bedürfnis, einiges richtigzustellen.
Für mich waren das aber noch keine ausreichenden Gründe, ein Buch zu schreiben. Wer sollte sich denn für mein Leben interessieren? Schließlich hat jeder Mensch seine eigenen Erlebnisse und sein eigenes Umfeld mit sämtlichen dazugehörenden Verpflichtungen. Die Welt wird immer schnelllebiger und die meisten Zeitgenossen hetzen von einem Termin zum nächsten. Ich dachte, nur Omas haben noch die Muße, sich für Geschichten zu interessieren. Vor allem, wenn es in ihrem eigenen Leben ruhiger wird. Aber die wollen logischerweise Geschichten von ihren eigenen Enkelkindern.
Trotzdem sah ich mich immer wieder mit dem Vorschlag »Du solltest ein Buch schreiben!« konfrontiert. Spätestens seit meinem geisteswissenschaftlichen Studium ist mir bei Literatur ein gewisses Niveau wichtig. Und nach meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium war mir klar, dass auch Effizienz eine Rolle spielt. Wer Zeit und vielleicht sogar Geld in ein Buch investiert, hat verdient, nach der Lektüre schlauer zu sein als vorher. Ein gutes Buch braucht also ein klares Thema. In Zeiten, in denen Reiseberichte, Fitnesstipps, Diätratgeber und Ähnliches den Buchmarkt überschwemmen, wollte ich mich dort nicht einreihen. Schließlich war all das schon im Überfluss vorhanden.
Laut meinen Mitmenschen sollte mein Leben das Thema sein. Diese Antwort zeigte mir, dass das Thema eines solchen Buches irgendwie in mir zu liegen schien. Das Thema war ich selbst.
Im Alter von 40 Jahren hat sich herausgestellt, dass ich unter Prosopagnosie leide. Umgangssprachlich wird dieses Phänomen auch als Gesichtsblindheit bezeichnet. Als ich erstmals mit diesem Verdacht konfrontiert wurde, hielt ich das für einen Scherz. Von Gesichtsblindheit hatte ich bis dahin nie gehört. Natürlich sind die Begabungen der Menschen unterschiedlich. Der eine hat ein gutes Zahlengedächtnis, der andere ist sehr musikalisch … Was sollte also schon besonders daran sein, dass sich manche Leute besser an Personen erinnern als andere?
Nach einer ersten Internetrecherche habe ich mir stichpunktartige Notizen gemacht, was in meinem Leben dazu passen könnte. Dennoch traute ich dem Internet nur wenig. Wer beginnt, nach Krankheiten zu googeln, fühlt sich danach im Regelfall wie ein Häufchen Elend.
Für mehr Klarheit musste also eine professionelle Einschätzung her. Um eine Diagnose zu erhalten, habe ich diese kleine Auflistung noch etwas verschönert und chronologisch sortiert. Ich war es geradezu gewohnt, missverstanden zu werden. Deshalb war es mir bei diesem Thema umso wichtiger, dass sich Ärzte oder Psychologen ein möglichst genaues Bild von mir machen konnten.
In den Wochen nach der Untersuchung wurde mir Stück für Stück klar, wie weitreichend mein Problem war und vor allem wie sehr es – über Jahre unentdeckt – mein Leben geprägt hat. Plötzlich setzten sich viele Geschichten aus meinem Leben wie Teile eines Puzzles zusammen. »Darüber könnte ich nun wirklich ein Buch schreiben«, habe ich im Scherz zu meiner Frau gesagt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: »Mach das. Fang an, alles aufzuschreiben!«
Ich war jedoch überzeugt, dass Leser Erfolgsgeschichten der Sorte »Vom Bauernsohn zum Gouverneur« bevorzugen oder wahlweise Ratgeber, die ihnen ohne besondere Anstrengungen ein perfektes Leben versprechen, ganz nach dem Motto »In sechs Wochen zum Traumbody«. Für wen sollte ich also schreiben?
Während mir diese Frage durch den Kopf ging, erhielt ich überraschend eine E-Mail von der freundlichen Psychologin, die mich untersucht hatte. Sie fragte an, ob sie meine Notizen, die ich ihr überlassen hatte, anonymisiert veröffentlichen dürfe. Erfahrungen von Betroffenen seien von anderer Qualität als Fachtexte außenstehender Experten.
So ist in mir die Idee gereift, tatsächlich ein Buch zu schreiben. Sicher können meine Erfahrungen für Betroffene interessant sein, die sich vielleicht teilweise darin wiederfinden. Am meisten liegt mir jedoch am Herzen, dass Familienangehörige, Erzieher und Lehrer aufmerksam werden, wenn bei einem jungen Menschen Anzeichen für Gesichtsblindheit vorliegen.
Eine mäßig ausgeprägte, angeborene Gesichtsblindheit ist grundsätzlich keine schlimme Krankheit. Da sie aber nach heutigem Kenntnisstand nicht heilbar ist, muss der Betroffene lernen, damit umzugehen. Im Internet findet man häufig den Vergleich zu Farbenblindheit. Wenn sie im Kindesalter rechtzeitig diagnostiziert wird, ist sie eher unproblematisch. Wenn das Kind aber nicht lernt, auf andere Weise rote und grüne Ampeln voneinander zu unterscheiden, kann es im Alltag gefährlich werden. Und wenn ein farbenblindes Kind – nichts von seiner Beeinträchtigung ahnend – im späteren Leben Tätowierer von Beruf wird, kann das ungeahnte Probleme nach sich ziehen. Genauso entscheidend ist es, dass Gesichtsblindheit frühzeitig bemerkt wird.
Dieses Buch ist ein im Wesentlichen chronologisch aufgebauter Erfahrungsbericht, der zeigen soll, wie sich Gesichtsblindheit quasi unbemerkt durch mein Leben gezogen hat. Natürlich sind das meine ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Mit meiner subjektiven Sichtweise möchte ich keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Sicher erlebt jeder Betroffene seine Gesichtsblindheit je nach Ausprägung und Umfeld ganz individuell und hat bewusst oder unbewusst eigene Strategien entwickelt, wie er damit umgeht.
Ebenso wenig ist es mein Ziel, wissenschaftliche Publikationen zum Thema Prosopagnosie wiederzugeben oder diesen gar Konkurrenz zu machen. Aus neuropsychologischer Sicht wird Prosopagnosie derzeit immer noch erforscht. Denjenigen, die sich dafür interessieren, empfehle ich, sich mit der entsprechenden Fachliteratur zu beschäftigen. Bewusst habe ich mich entschieden, im Folgenden die umgangssprachliche und für die breite Leserschaft leichter nachvollziehbare Bezeichnung »Gesichtsblindheit« zu verwenden.
Beim Schreiben der folgenden Episoden habe ich mich anhand meiner Erinnerungen um größtmögliche Authentizität bemüht, möglichst spontan und ganz nach dem Motto »Keep it simple!«.
Vorwort
der Neuropsychologin Dr. Denise Soria Bauser
Ein Gesicht sagt mehr als tausend Worte
Gesichter spielen in der zwischenmenschlichen Interaktion eine zentrale Rolle. Sie liefern uns Informationen über die Identität unseres Interaktionspartners, über dessen Geschlecht, Alter, Intentionen und Emotionen.
Wie wichtig es ist, andere Personen anhand des Gesichts zu erkennen, wird einem erst bewusst, wenn man diese Fähigkeit nicht bzw. nicht mehr besitzt. Stellen Sie sich vor, Sie werden tagtäglich von Personen mit Namen angesprochen, die Sie offensichtlich kennen, Ihnen sind diese Personen aber vollkommen fremd, zumindest im ersten Moment. So etwas passiert Personen mit Prosopagnosie (Gesichtsblindheit) ständig.
Der Begriff »Prosopagnosie« stammt aus dem Griechischen: »Prosop« (Gesicht) und »Agnosie« (Nichterkennen). Diese Bezeichnung ist etwas missverständlich, da Personen mit Prosopagnosie durchaus erkennen können, ob es sich bei einem wahrgenommenen Objekt um ein menschliches Gesicht handelt oder nicht. Ihre Schwierigkeiten bestehen vielmehr darin, dass sie nicht erkennen können, um wessen Gesicht es sich handelt. In ihren Augen sehen alle Gesichter irgendwie gleich aus.
Betroffene haben häufig keine Schwierigkeiten damit, Personen anhand anderer Informationsquellen wie der Stimme, der Art, sich zu bewegen, der Frisur oder auch des sozialen Kontextes zu erkennen. Demnach handelt es sich auch nicht um eine Schwäche des Gedächtnisses. Ebenso wenig liegt die Ursache der Prosopagnosie in einem mangelnden Interesse an anderen Personen, in Unaufmerksamkeit, niedriger Intelligenz oder schwachen sozialen Kompetenzen. Es handelt sich vielmehr um ein Defizit, das selektiv bei der Verarbeitung von Gesichtern auftritt.
In diesem Zusammenhang stellt sich aus wissenschaftlicher Sicht die Frage, was die Verarbeitung von Gesichtern so besonders macht bzw. inwiefern sich die Gesichtsverarbeitung von der Verarbeitung anderer Objekte unterscheidet. Gesichter werden anhand spezieller Mechanismen und innerhalb spezifischer Gehirnregionen verarbeitet. Während andere Objekte merkmalsbasiert verarbeitet werden, integrieren wir alle Merkmale eines Gesichts automatisch in eine ganzheitliche Repräsentation. Zudem existieren im menschlichen Gehirn mindestens zwei Regionen, die auf die Verarbeitung von Gesichtern spezialisiert sind.
Als Neuropsychologin hatte ich das Glück, in den letzten Jahren zahlreiche Personen mit angeborener Prosopagnosie kennenzulernen. Viele Betroffene haben mir beispielsweise berichtet, dass sie sich jahrelang gefragt haben, warum Filme so produziert werden, dass sich das Aussehen, d.h. die Kleidung oder Frisur der einzelnen Figuren ständig verändert, sodass man sie nicht wiedererkennen kann. Eine Betroffene hat mir berichtet, dass sie immer davon ausgegangen sei, mit Hut oder Mütze würde man sie nicht erkennen, da sie andere Personen auch nicht erkennt, wenn diese eine Kopfbedeckung tragen.
Personen mit angeborener Prosopagnosie ahnen nicht einmal ansatzweise, wie gut Nichtbetroffene andere Personen anhand des Gesichts erkennen können. Sie gehen oft Jahre – viele sogar ihr Leben lang – davon aus, dass ihre Mitmenschen ähnliche Schwierigkeiten haben. Deshalb reagieren nicht wenige sehr überrascht, wenn ich ihnen erkläre, dass Personen ohne Prosopagnosie innerhalb von Sekunden in der Lage sind, Gesichter zu lernen und verlässlich wiederzuerkennen.
Das Erscheinungsbild der Prosopagnosie ist sehr heterogen, d.h., das Ausmaß variiert von Betroffenem zu Betroffenem. Unklar ist bislang, ob diese Unterschiede teilweise darin begründet sind, dass die Betroffenen unterschiedlich effiziente Kompensationsstrategien anwenden, dass diese im experimentellen Setting mehr oder weniger gut greifen oder dass die einzelnen Betroffenen tatsächlich unterschiedlich stark beeinträchtigt sind.
Da Prosopagnosie eine weitgehend unbekannte Erkrankung ist, wissen die meisten Betroffenen und auch viele Fachleute gar nicht, dass es ein selektives Defizit bei der Verarbeitung von Gesichtern gibt. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Personen mit der Vermutung, dass sie Schwierigkeiten mit der Gesichtsverarbeitung haben, nicht wissen, an wen sie sich wenden können, um Gewissheit zu bekommen. Aus diesem Grund existieren bislang auch keine verlässlichen Daten über die Häufigkeit der angeborenen Variante der Prosopagnosie. Sicher scheint nur, dass es aufgrund dieser Unwissenheit eine hohe Dunkelziffer gibt.
Andere Personen ausschließlich an ihrem Gesicht zu erkennen, ist leider keine Fähigkeit, die man erlernen oder trainieren kann. Deshalb ist Prosopagnosie weder heilbar noch behandelbar. Jegliche Versuche, die Leistung von Betroffenen durch bestimmte Trainingsmethoden zu verbessern, sind meines Wissens bislang gescheitert. Auch der Versuch, den Betroffenen diverse Alternativen an die Hand zu geben, mit Hilfe derer sie Personen besser wiedererkennen können, ist bisher erfolglos geblieben. Eine mögliche Erklärung hierfür liegt meiner Meinung nach darin, dass Menschen mit angeborener Prosopagnosie über Jahre selbst zu Experten für Mechanismen geworden sind, die ihnen am besten helfen, andere Menschen wiederzuerkennen. Meinen Beobachtungen nach variieren diese Methoden von Person zu Person.
Ich werde oft gefragt, welchen Sinn die Erforschung und die Diagnose der Prosopagnosie hat, wenn aufgrund fehlender Therapie- und Trainingserfolge keine positiven Konsequenzen für die Betroffenen zu erwarten sind. Meine Antwort lautet: Bei den Betroffenen besteht ein großes Interesse daran, endlich die Ursachen für ihre Probleme zu finden. Meiner Erfahrung nach empfinden viele Betroffene Erleichterung, wenn sie endlich einen Namen, also die Diagnose für ihr Problem haben und wissen, dass sie mit diesen Schwierigkeiten nicht alleine sind. Deshalb habe ich mich sehr über die Idee von Herrn Klein gefreut, einen Bericht über sein Leben mit Prosopagnosie zu schreiben. Ich bin mir sicher, dass viele Betroffene sich eher in seinen Erfahrungen als in wissenschaftlichen Abhandlungen über dieses Thema wiederfinden. Zudem wünsche ich mir, dass die Prosopagnosie bekannt wird, sodass etwa auch Pädagogen sie als mögliche Ursache für die Probleme mancher Kinder in Erwägung ziehen. Damit würden diese Kinder mit mehr Verständnis und Unterstützung rechnen können.
Dr. Denise Soria Bauser
Arbeitsgruppe klinische Neuropsychologie,
Ruhr-Universität Bochum
HALLO PAPA!
Es war Ende der 1970er Jahre in einer mittelgroßen süddeutschen Stadt. Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus in einem ruhigen, naturnahen Ortsteil. Meine Mutter hatte ihren Beruf aufgegeben, um sich voll und ganz um die Familie zu kümmern. In der warmen Jahreszeit war ich am liebsten draußen im Garten. Mit meinem Bobby-Car düste ich über den kurz gemähten Rasen den Hang hinunter. Vom Balkon des Nachbarhauses dröhnten die Hits von Boney M. Das war der Soundtrack eines heißen Sommers.
Für mein Alter war ich erstaunlich gut zu Fuß. Von den weiten Spaziergängen mit meiner Oma konnte ich nicht genug bekommen. Für mich waren das echte Entdeckungstouren.
Meine anderen Großeltern lebten in Stuttgart in einer Altbauwohnung. Ich liebte die Besuche dort. Diese Wohnung kam mir riesig vor. Die Räume waren hoch und der Keller war der tiefste, den ich je gesehen hatte. In diesem muffeligen Luftschutzkeller waren allerlei alte Spielsachen versteckt.
In der Stadt war dieser Sommer noch heißer. Schon während der Autofahrt dorthin hatte ich mich auf meine Lieblingslimonade gefreut, die es nur bei den Großeltern gab. Da im Kühlschrank keine einzige Flasche mehr davon zu finden war, reagierte ich mit kindlicher Enttäuschung. Aber ich hatte Glück. Kurzerhand bekam ich Kleingeld, um mir eine Flasche zu kaufen. Neben der Erfrischung freute ich mich auch auf die kleine Sammelfigur, die bei jeder Flasche dabei war. Kleinigkeit, was Kinder freut.
Außerdem war es spannend. Ganz alleine durfte ich mich in die Häuserschlucht zwischen den Altbauten begeben. Die Luft war stickig und die Hitze strahlte von den Hauswänden zurück. Ich war so fasziniert, dass ich hier gerne noch mehr erkundet hätte. Aber ich hatte versprochen, vorsichtig zu sein, auf fahrende Autos zu achten und auf direktem Weg zurückzukommen.
Mit der kühlen Limonade in der einen Hand und dem Wechselgeld in der anderen machte ich mich auf den Rückweg und genoss den glühenden Asphalt unter meinen Füßen. Die Erfrischung wollte ich mir für die Wohnung aufheben.
Plötzlich sah ich auf der anderen Straßenseite meinen Vater entgegenkommen. Für mich war er unverwechselbar: Er war schlank, sonnengebräunt und trug einen schwarzen Vollbart.
»Hallo Papa!«, rief ich erfreut. Der Mann auf der anderen Straßenseite zeigte jedoch keine Reaktion. Wahrscheinlich hatte er mich wegen den fahrenden Autos nicht gehört. Also brüllte ich lauter und fing an zu winken: »Hallooo! Paaapaaa!«
Ich überlegte, ob ich zu sehr getrödelt hatte. Eine Minute für ein kleines Gespräch mit der Kassiererin sollte doch noch drin sein. Wahrscheinlich machten sich die Erwachsenen Sorgen um mich und suchten schon nach mir.
Im gefährlichen großstädtischen Straßenverkehr konnte ich unmöglich auf die andere Seite. Ich winkte und schrie lauter. Als der Mann endlich meine Rufe vernahm, schaute er mich verstört an und entfernte sich mit schnellen Schritten. Meine Freude über die eben erstandene Limonade war verflogen.
Ich beeilte mich, um in der Wohnung als Erstes über den Vorfall zu berichten. »Papa ist doch hier. Er ist die ganze Zeit hier gewesen«, bekam ich als Antwort.
Ich war mir sicher, dass ich meinen Vater getroffen hatte. Aber warum war er vor mir weggelaufen? Und wie war es möglich, dass er bei meiner Rückkehr bereits in der Wohnung war? Er war schließlich in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. Mir blieben lauter Fragen.
Trotz meines ehrlichen und detaillierten Berichts hatte ich keine Chance. Diese Verwechslung wurde von allen als kindliche Fantasie abgetan. Nur ich wusste, dass mir dieser Mann wirklich begegnet war.
Man hätte mir auch einfach erklären können, dass schlanke Männer mit Vollbart Ende der 1970er Jahre keine Seltenheit waren. Zumindest nicht in der Großstadt.
Da ich keine Erklärung für diesen Vorfall fand, träumte ich als Kind noch oft davon. Vielleicht hat der fremde Mann mit dem Vollbart genauso darunter gelitten. Auch wenn damals noch keine Talkshows mit Vaterschaftstest existierten.
Dieses lange zurückliegende Ereignis, an das ich mich noch gut erinnere, deutet darauf hin, dass meine Gesichtsblindheit angeboren ist.
SO EIN KINDERGARTEN
Ich war im Kindergartenalter und liebte es, im Garten zu spielen. Seit ich vom Kinderarzt einen kleinen Ameisenbär aus Kunststoff bekommen hatte, spielte ich Ameisenbär und perfektionierte meine Technik, Ameisen direkt mit dem Mund aus dem Sandkasten aufzusaugen. Außerdem mochte ich alle Arten von Rollenspielen mit Kindern aus dem Haus. Wie es damals in Mode war, spielte ich gerne Cowboy. Von einem Supermanheft inspiriert, stellte ich mir mein eigenes Kostüm zusammen: Eine blaue Schlafanzughose und mein roter Bademantel als Umhang genügten. Da ich auch gerne mit den Mädchen spielte, beteiligte ich mich an ihren Vater-Mutter-Kind-Spielen, bei denen ich am liebsten das Kind war.
»Spiel doch lieber mal die Rolle des Vaters«, versuchte mich mein Vater auf den richtigen Weg zu bringen, »dann kannst du mehr entscheiden als in der Rolle des Kindes. Das ist doch viel besser für dich.« »Aber wenn ich das Kind spiele, helfen mir die Spieleltern, mich zurechtzufinden. Das ist viel wichtiger«, argumentierte ich. Für meinen Vater schien eine solche Reaktion nicht nachvollziehbar.
Auch die dunkelhäutige Babypuppe meiner Schwester hatte es mir angetan. »Wenn du wüsstest, wie schwer es Menschen anderer Hautfarbe in unserer Gesellschaft haben …«, wurde ich aufgeklärt. »Aber ich habe es doch auch schwer«, antwortete ich in kindlicher Naivität. »Wenigstens sieht man schokobraune Kinder sofort!« Da ich Schwarze nur als Babypuppe kannte, war das damals jedoch eine rein theoretische Überlegung.
Gerne ging ich auch mit meiner Mutter fort. Im Gegensatz zu anderen Kindern, die wegrannten, sich versteckten und gar nicht mehr nach Hause wollten, blieb ich möglichst immer an ihrer Seite. Die Tatsache, dass sie im Gegensatz zu meinem Vater eher unscheinbar war, machte es mir nicht leicht. Es war mir schon einmal passiert, dass ich sie verloren hatte. Dann musste ich überlegen, wie sie aussah. Also besser immer in ihrer Nähe bleiben. Trotz ihrer unauffälligen Erscheinung hatte sie jedoch ein besonderes Merkmal. Da sie aus Niedersachsen stammte, sprach sie ein wunderschönes und ruhiges Hochdeutsch. In unserer Nachbarschaft sprachen hingegen alle anderen im lokalen Dialekt. Solange ich meine Mutter sprechen hörte, wusste ich also, dass sie in der Nähe war. Aus Sorge, verloren zu gehen, hatte ich mir schon früh unsere Telefonnummer eingeprägt. Ich weiß sie noch heute.
Den Kindergarten hasste ich. Weil er nicht weit von unserem Wohnort entfernt war, konnte ich alleine zu Fuß dorthin gehen. Auf dem Weg machte ich erstmals mit der Frage »Was guckst du so?« Bekanntschaft. Was für eine Frage? Natürlich guckte ich, wer die anderen waren. Ich hatte gar nicht geahnt, dass in der Gegend so viele Kinder wohnten, die ich noch nicht kannte. »Guck nicht so blöd!«, und schon wurde ich verprügelt. Wenn ich mal wieder mit Nasenbluten nach Hause kam, wusste ich weder, warum man mich geschlagen hatte, noch, wer daran beteiligt gewesen war. Normalerweise kannte ich diese Kinder gar nicht. Und da sie wild herumrannten, konnte ich sie auch nicht identifizieren.
Warum ich in den Kindergarten sollte, verstand ich nicht. Anfangs erkundete ich die Spielsachen dort. Aber das konnte nicht der Grund sein. Schließlich gab es zuhause genug zum Spielen. Aus meinem Zimmer hatte ich eine perfekte Aussicht auf die Baustelle gegenüber und ich konnte alles mit meinen Playmobilfiguren nachbauen. Auch an Kindern in meinem Alter mangelte es in der Nachbarschaft nicht. Gerne spielte ich mit den beiden Mädchen aus unserem Haus und dem Nachbarhaus. Eine hatte dunkle Haare und die andere war blond. Für mich waren sie also leicht zu unterscheiden.
Im Kindergarten tobten alle wie die Wilden. Und wenn ihre Eltern in der Nähe waren, waren sie plötzlich wieder brav. Irgendwie komisch. Vielleicht waren sie so gerne hier, weil sie daheim immer nur stillsitzen mussten und nichts durften.
Bald hatte ich meine Lieblingsspielzeuge gefunden, mit denen ich mich jeden Morgen in eine ruhige Ecke zurückzog. Die gemeinsame Frühstückspause hasste ich hingegen. Die Erzieherin predigte uns vor jedem Essen, dass wir dankbar sein müssten, hier gemeinsam mit den anderen essen zu dürfen. So ein Blödsinn. Wofür sollte ich denn hier dankbar sein? Dafür, dass ich mit unerzogenen fremden Kindern hier abgestellt wurde? Dafür, dass ich hier keinen kannte? Dafür, dass mich diese tobende Horde absichtlich beim Spielen störte? Dafür, dass ich immer wieder grundlos verprügelt wurde?
Da ich das Pflichtprogramm schnellstmöglich hinter mich bringen wollte, entwickelte ich beim Spielen eine immer größere Effizienz. Das heißt, ich wurde jeden Vormittag früher fertig, räumte meine Spielsachen zurück und legte mich in der Ecke auf den Boden. Dem wilden Treiben meiner Altersgenossen konnte ich nicht folgen. Es war geradezu Stress für mich. Auf dem Rücken liegend, schaute ich an die Decke und versuchte zu entspannen. Ich wollte nur noch nach Hause.
Wenn die Erzieherin endlich zum Aufräumen aufforderte, wusste ich, dass ich es fast überstanden hatte. Ich hatte ja sowieso schon alles weggeräumt, was mich betraf. Allerdings ließ mich die Frau immer deutlicher spüren, dass sie mich nicht mochte. Kurz vor Schluss gab es immer irgendeinen schlecht Erzogenen, der Kisten mit Spielzeug wieder ausschüttete. Und dann ließ mich die Erzieherin alleine alles wieder einräumen. Bei aller Geduld, mir reichte es!
Im Elterngespräch erklärte die Verantwortliche meiner Mutter, dass ich blöd sei. Diese Vorwürfe konnte meine Mutter
allerdings in keiner Weise nachvollziehen. Schließlich war ich in gewohntem Umfeld ein normales, unauffälliges Kind. Ich hatte früh das Laufen und das Sprechen gelernt, war gut zu Fuß und hatte einen ausgeprägten Entdeckergeist. Meine Eltern ließen es also darauf ankommen und ich wurde getestet. Um den täglichen Qualen des Kindergartens zu entkommen, gab ich mein Bestes. Und das Resultat folgte: »Er ist vorzeitig schulreif. Im Kindergarten langweilt er sich zu Tode!« Ich war erleichtert und meine Eltern waren froh, dass die unverschämte Kindergartentante Lügen gestraft worden war. Dass ich gesichtsblind war, ahnte nach wie vor niemand.