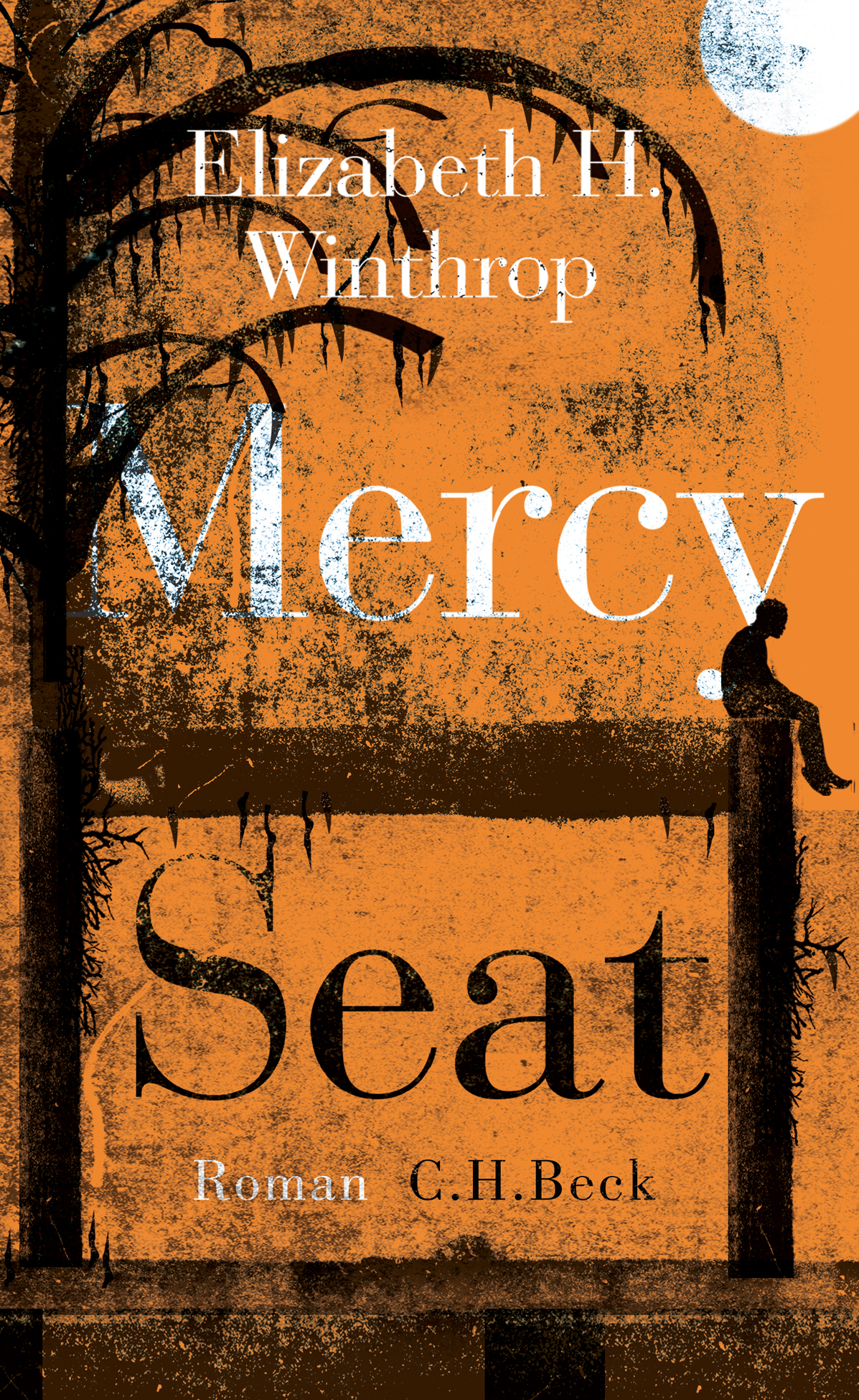
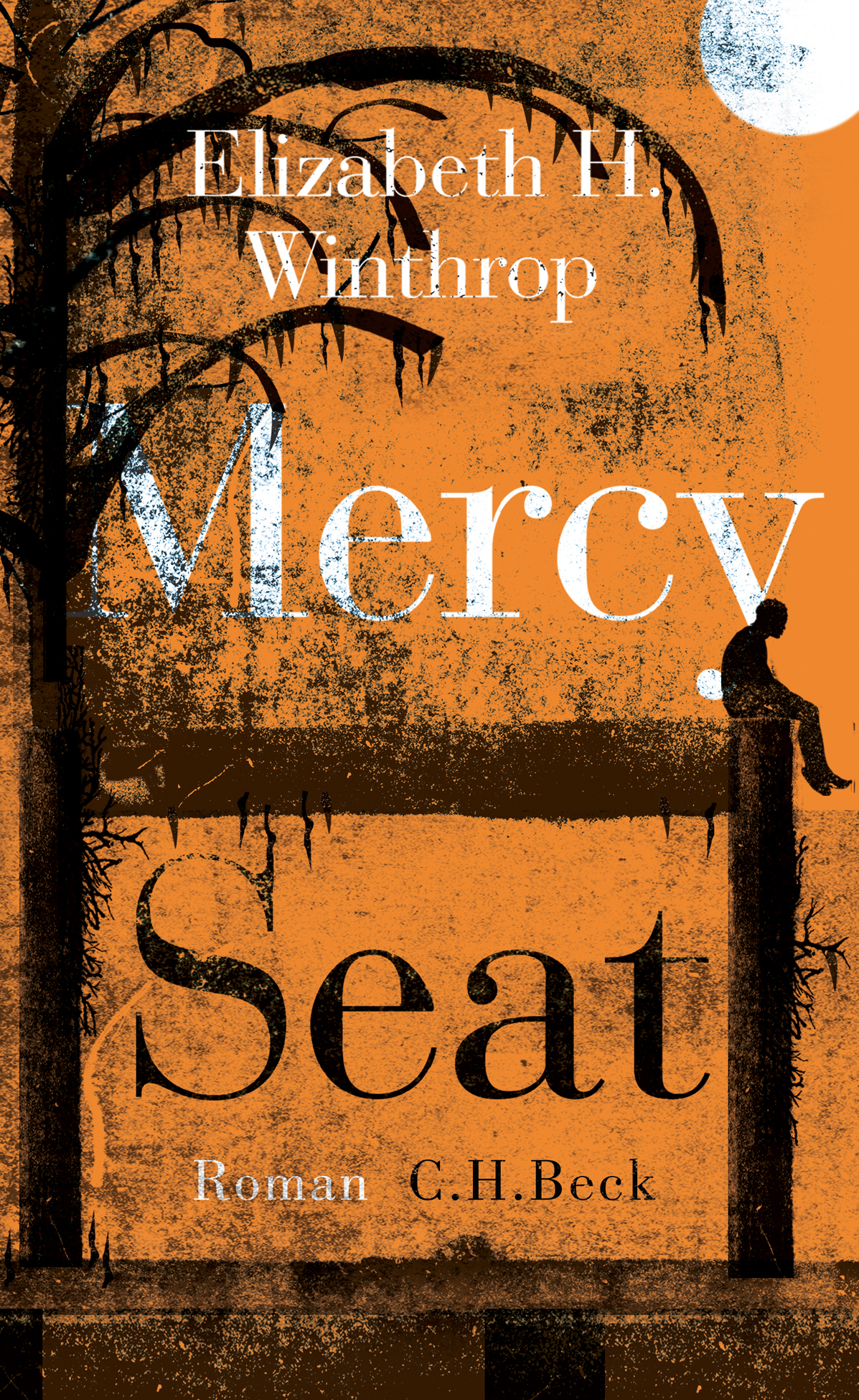
MERCY SEAT
ROMAN
Aus dem Englischen
von Hansjörg Schertenleib
C.H.Beck
Louisiana, die 1940er-Jahre, ein elektrischer Stuhl wird in die kleine Stadt St. Martinville gebracht für die geplante Hinrichtung eines jungen Schwarzen namens Will, der ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll. In Wirklichkeit ist sie seine Geliebte gewesen, die sich aus Verzweiflung umgebracht hat und ihm nun nicht mehr helfen kann. Alle wissen, dass das Todesurteil ein Skandal ist, aber sogar Will selbst hat aus Trauer und Schuldgefühlen innerlich eingewilligt, und weiße Wutbürger drohen dem zweifelnden Staatsanwalt mit der Entführung seines Sohnes. Nach einer wahren Begebenheit, psychologisch fein und in einer an William Faulkner erinnernden multiperspektivischen Intensität erzählt Elizabeth H. Winthrop die tragischen Ereignisse bis zum überraschenden Ende. Ein meisterhaftes Buch, das man nicht mehr aus der Hand legt und das niemanden kaltlassen wird.
Elizabeth H. Winthrop, 1979 geboren, lebt mit ihrer Familie in Massachusetts. Sie studierte englische und amerikanische Literatur an der Harvard University und erwarb ihren Master of Fine Arts in Fiction an der University of California in Irvine. Sie hat Erzählungen und bislang drei Romane veröffentlicht.
Hansjörg Schertenleib lebt in Suhr in der Schweiz und in Maine. Er ist Schriftsteller und veröffentlichte u.a. Gedichte, Theaterstücke, Kinderbücher, Erzählungen, Novellen und Romane, für C.H.Beck übersetzte er bereits Romane von Eoin McNamee und Kenneth Cook.
TEIL EINS
LANE
DALE
ORA
DALE
LANE
WILL
FRANK
WILL
FRANK
HANNIGAN
GABE
HANNIGAN
NELL
POLLY
GABE
NELL
POLLY
HANNIGAN
NELL
LANE
ORA
DALE
ORA
DALE
FRANK
WILL
LANE
FRANK
GABE
LANE
WILL
HANNIGAN
TEIL ZWEI
LANE
ORA
DALE
POLLY
NELL
GABE
HANNIGAN
WILL
POLLY
FRANK
GABE
LANE
WILL
DALE
ORA
FRANK
ORA
DALE
LANE
WILL
POLLY
NELL
GABE
FRANK
DALE
FRANK
TEIL DREI
LANE
POLLY
WILL
HANNIGAN
GABE
NELL
FRANK
GABE
WILL
ORA
POLLY
WILL
HANNIGAN
POLLY
ORA
LANE
GABE
WILL
TEIL VIER
HANNIGAN
NELL
GABE
POLLY
GABE
HANNIGAN
FRANK
DALE
LANE
WILL
Als Lane aus dem Tankstellenhäuschen tritt, wartet der Hund schon auf ihn. Er hockt im Staub der Kreuzung, wachsam, gespannt, die Ohren aufgestellt, japsend, die schwarze Zunge steif zwischen den pumpenden Kiefern. Mit seinen sehnigen Muskeln und den sorgenvoll hochgezogenen Brauen sieht er aus wie ein Pitbull-Mischling und erinnert Lane an die Hündin, die er als Kind hatte, bis sein Vater sie eines Tages in den Zuckerrohrfeldern hinter dem Haus erschoss, weil er verflucht noch mal keinen Hund durchfütterte, der bei häuslichen Streitigkeiten die Partei der Frau ergriff. Die Hündin war nicht gleich gestorben; Lane hatte sie verarztet, so gut er konnte, hatte ihr draußen im Schuppen ein Lager bereitet, Futter und Wasser gebracht und sich um ihre Wunden gekümmert, bis sie nach einigen Tagen verschwunden war, wahrscheinlich um irgendwo zu sterben.
Der Hund erhebt sich flink aus dem Staub, als er Lane bemerkt, dreht sich im Kreis und folgt ihm zum Truck hinüber, der im einzigen schattigen Fleck unter einem Baum geparkt ist. Lane bleibt stehen und dreht sich um. Er betrachtet den Hund, dann das Tankstellenhäuschen, einen flachen, weißen Betonziegelbau, der in der Hitze der Kreuzung brütet. Wegen der Nachmittagssonne sind die verbeulten Jalousien hinuntergezogen, die abgesplitterten Lettern des Texaco-Logos, die auf die Scheibe gemalt sind, stehen als Schatten auf dem zerschlissenen Segeltuch darunter. Lane fragt sich, ob der Hund ein Streuner ist oder zu den Leuten hier gehört, zu der schwarzhaarigen Frau hinter der Theke, die sein Geld wortlos entgegengenommen hat, zu dem Mann, der eben durch das Werkstatttor der Garage tritt, die Hemdsärmel über die von Schmierfett schwarz verdreckten Arme aufgekrempelt. Lane vermutet, dass sie verheiratet sind; er hat durch die Tür hinter der Verkaufstheke Wohnräume erspäht und den Duft von geschmortem Fleisch gerochen.
Lane räuspert sich. «Gehört der Ihnen?», ruft er.
Der Mann spuckt aus, während er zur Zapfsäule hinübergeht, an der ein Auto wartet, und schüttelt den Kopf.
Lane wirft dem Hund ein Stück des Dörrfleisches zu, das er von dem Geld gekauft hat, das ihm Captain Seward zugebilligt hat, und geht weiter auf den Truck zu, einen leuchtend roten 1941er International Harvester. Lane findet, dass an dem Truck irgendwie alles rund aussieht: Mit seinen behäbigen runden Kotflügeln, runden Rück- und Vorderlichtern wirkt er, als sei er erstaunt. Und vielleicht wäre er das tatsächlich, wenn er wüsste, welche Fracht sich im Blechauflieger befindet, der auf die Ladefläche montiert ist. Lane hat zugesehen, wie sie den hölzernen Stuhl mit der geraden Rückenlehne in Angola aufgeladen haben, der ohne die Lederriemen für die Arme und die hölzerne Schiene, die zwischen den Vorderbeinen verläuft, harmlos wirken würde. Der Anblick hat Lane erstaunt; er hat einen neumodischen Apparat aus Metall mit Kabeln und Knöpfen erwartet. Dass der Stuhl schlicht und einfach wie ein Stuhl aussieht, beunruhigt Lane; er findet seine Schlichtheit zutiefst unheilvoll.
Er öffnet die Tür des Trucks und klettert hinters Lenkrad.
Seward auf dem Beifahrersitz hat eine Zigarre zwischen den dicken Lippen, die nicht brennt. Er ist ein schwerer, kinnloser Mann mit einem Nacken, der so dick ist, dass es scheint, als sitze sein Kopf nicht darauf, sondern wachse daraus hervor wie bei einem Sittich.
Seward sieht Lane flüchtig über den Schalthebel hinweg an. «Hab schon gedacht, du hast dich aus dem Staub gemacht», sagt er. Die Zigarre wippt zwischen seinen Lippen, während er redet.
Lane betrachtet die leeren Felder rundum, die Schotterstraßen, die sie unterteilen und zielstrebig nach Osten, Westen, Norden und Süden führen. «Wo soll man denn hier hin?»
Der Captain deutet auf den Beutel Dörrfleisch. «Zufrieden?»
Als Antwort bietet Lane Seward ein Stück Fleisch an. Der fette Mann pflückt die Zigarre aus seinem Mund und atmet aus, als habe er einen Zug genommen. «Zu heiß, um was zu essen», sagt er, trotzdem nimmt er Lane das Dörrfleisch aus der Hand und reißt ein Stück mit seinen Eckzähnen heraus.
Es mag zu heiß sein, um zu essen; aber als sie angehalten haben, damit der Captain sein krankes Bein ausstrecken konnte, hat Lane trotzdem erklärt, hungrig zu sein, genau wie er behauptet hatte, die Toilette benutzen zu müssen, als sie an der letzten Tankstelle vorbeigefahren waren. Er sitzt seit sechs Jahren und träumt von Dingen wie Dörrfleisch, M & M’s, Porzellan unter seinen Schenkeln. Nun, da er als Freigänger aus dem Knast ist, um den Captain und seinen Stuhl zu chauffieren, will er Dörrfleisch, solange es möglich ist. Er will es wollen; diese Erkenntnis lässt den Geschmack der Freiheit bitter schmecken. «Für Dörrfleisch ist es nie zu heiß, wenn du jahrelang nichts als Schleimsuppe gekriegt hast», sagt Lane, obwohl er mit dem Stück, das er sich nimmt, nur spielt, indem er das zähe Fleisch zwischen den Fingern dreht. Schließlich wirft er es dem Hund zu, der vor der offenen Tür des Trucks hockt. «Erinnert mich an den Hund, den ich als Kind hatte», sagt er.
Der Captain grunzt. «Als du ein Kind warst. Und jetzt bist du ein Mann oder was?»
Lane erwidert nichts. Er ist vierundzwanzig Jahre alt. Er sieht zu, wie der Hund das Dörrfleisch frisst, dann tut er so, als wolle er nach dem Tier treten. «Blöder Hund!», sagt er, als der Hund zurückweicht. «Blöder Hund!» Er knallt die Tür zu, und der Captain und der Freigänger sind erneut unterwegs.
Dale füllt den Tank des wartenden Autos und sieht zu, wie der Truck auf der Straße Richtung Süden verschwindet. Der Truck wirbelt eine Staubwolke auf, die als langsam sich wieder auflösende Säule hinter ihm aufragt. In der Trockenperiode, die seit Wochen anhält, ist nicht ein Tropfen Regen gefallen.
Er senkt den Blick, während er den Tank füllt; um seine Hand schimmert Benzindunst. Die Ziffern am Zähler der Zapfsäule ticken langsam nach oben, bis sie mit einem Klicken bei fünfundzwanzig stehen bleiben, weil er den Hebel loslässt. Er hängt die Zapfpistole zurück und schraubt den Tankdeckel zu.
«Fünfundzwanzig», sagt er und beugt sich durch das offene Fenster ins Auto. Drei glänzende Gesichter sehen ihn an: Vater, Mutter und, auf der Bank zwischen ihnen, ein kleines Mädchen, Leute vom Land, in einem Wagen, den sie sich geliehen oder hart verdient haben. Im Fond liegt ein Säugling in einem Körbchen und schläft.
Der Fahrer lässt die Münzen in Dales ausgestreckte Hand fallen, die so schmutzig vom Öl ist wie die Hand des Mannes von der Erde der Felder. «Das reicht bis Houma, würd ich mal sagen?»
«Sollte es.» Dale richtet sich auf. Er steckt die Hand mit den Münzen darin in die Hosentasche und sieht zu, wie der Wagen in die immer noch wabernde Staubwolke davonfährt. Dann geht er in der brütenden Hitze über den Platz auf das Häuschen zu. Der Hund hat sich im Schatten der Eiche niedergelassen, dort wo der Truck geparkt hatte; er gehört nicht zu ihnen, aber nach knapp zwei Wochen, die er sich nun bei ihnen herumtreibt, ergibt es sich so. Sie sind keine Hundehalter, noch nie gewesen. Ora sagt, sie kann nicht anders, als ihn zu füttern, solange er hier ist, auch wenn Dale ihr erklärt hat, dass er genau deswegen hier bleibt, weil sie ihn füttert.
Die Glocke über der Ladentür schrillt, als er eintritt. Im Innern ist es genauso heiß wie im Freien, aber wenigstens gibt es hier einen Ventilator. Ora sitzt auf einem Hocker hinter dem Tresen, ihr schwarzes Haar klebt ihr feucht an der Wange. Sie sieht erwartungsvoll von ihrer Zeitschrift zu ihm auf, und Dale begreift, er hat ihr nichts zu geben, nichts zu sagen; er ist nur reingekommen, um eben reinzukommen. Er streicht sich mit der Hand durch die Haare, die steif von Schweiß und Staub sind, und lehnt sich gegen den Kühlschrank. «Riecht gut», sagt er.
«Mmm.»
Dale sieht seine Frau an; sie erwidert seinen Blick mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck.
«Wildbret?», fragt er.
Sie schaut wieder in ihre Zeitschrift. «Schwein.»
«Der Vielfraß ist schon ne ganze Weile tot.»
«Mmm.»
«Kühl genug für dich? Ich kann den Ventilator näher ranrücken», bietet er ihr an.
«Mir geht’s gut.» Sie schaut nicht auf.
«Hab die Zündkerzen im Truck ausgewechselt», sagt er, «hoffe, es nützt was.»
Sie sieht ihn fragend an.
«Der Motor hatte Fehlzündungen», erklärt er.
Es interessiert sie nicht, und sie guckt wieder in die Zeitschrift.
Dale klopft sich wegen Zigaretten auf die Brusttasche und stellt fest, dass er die Schachtel in der Werkstatt liegengelassen hat. Er kratzt sich am Kopf und sieht seine Frau ebenso aufmerksam an, wie sie in die Zeitschrift starrt, ohne dass sich ihre Blicke über die Seiten bewegen.
Schließlich schaut sie auf. «Was?»
«Was was?», gibt er zurück.
Sie klappt die Zeitschrift zu und steht auf. «Fleisch ist bald gar», sagt sie, tritt in den Wohnbereich und schließt die Tür hinter sich.
Dale reibt sich die Augen. Er stößt sich vom Kühlschrank ab, geht zur Tür hinüber, bleibt vor der Scheibe stehen und starrt in die Ferne, wo sich der Highway in einem schimmernden Trugbild verliert.
In der Küche dreht Ora die Herdplatte hinunter und eilt, ohne auch nur stehen zu bleiben, den Deckel hochzuheben und in den Topf zu sehen, zur Hintertür mit dem Fliegengitter. Bevor Dale letzte Woche Filzblättchen in den Rahmen geklebt hat, ist die Tür immer mit einem vertrauten Geräusch zugefallen. Die neue Stille ist Ora unangenehm; sie wirkt lauter, als es das Schlagen von Holz auf Holz, dessen Echo über die Felder rollte, je gewesen ist. Der schwarze Junge draußen in den Baumwollreihen hat immer hochgeschaut, wenn er das Geräusch hörte, und hat sie in der Tür stehen sehen; jetzt ahnt er ihre Anwesenheit nicht, geht durch die Reihen, pflückt Baumwolle und steckt sie in einen Jutesack.
Sie lässt sich auf den drei Holzstufen nieder, die von der Hintertür in den staubigen Hinterhof hinunterführen, der an das Feld grenzt. Laut und elektrisch wie Rasseln lärmen Zikaden in der Baumwolle. Sie fragt sich, ob Dale immer noch am Kühlschrank lehnt und auf die Stelle starrt, an der sie gesessen hat, als gäbe ihm die Leerstelle vielleicht doch noch die gewünschte Antwort. Die Frage, wo Tobe sein könnte, gestattet sie sich nicht. Seit Wochen ist kein Brief mehr aus Guadalcanal gekommen. Dale und sie reden nicht darüber. Ihr ist bewusst, dass die Abwesenheit ihres Sohnes nach all den Jahren die gleiche Art Spalt zwischen sie getrieben hat wie seine Ankunft in ihrem Leben vor achtzehn Jahren. Damals hatten sie sich beide heimlich ihr altes Leben zurückgewünscht, dessen Verlust sie sich gegenseitig unausgesprochen vorwarfen; heute warten sie auf Post und Neuigkeiten vom Pazifik, jeder in seinem eigenen ängstlichen Schweigen gefangen.
Lärmendes Vogelgezänk lässt sie aufblicken; ein Sperling jagt einen Falken quer über das Feld. Sie hört ein Auto, das auf der anderen Seite des Hauses auf dem Highway vorbeizischt, gleich darauf kann sie sehen, wie es auf der Straße nach Osten kleiner und kleiner wird. Manchmal findet Ora es eigenartig, an einer Kreuzung zu leben, wo nahezu jeder, den sie sieht, irgendwohin unterwegs ist, während es in ihrem Leben keinen anderen Ort mehr gibt, an den sie noch müsste. Als Tobe jünger war und mit ihr hinter der Ladentheke saß, bevor er alt genug war, um die Zapfsäule zu bedienen oder Dale in der Werkstatt zu helfen, erfanden sie immer Geschichten zu den Leuten, die in den Laden kamen: die Frau mit Hut hatte Geburtstag und war unterwegs nach New Orleans; die Familie mit den Zwillingsbabys zog nach Kalifornien; der Mann mit dem Taschentuch floh vor der Justiz. Sie erfindet keine Geschichten mehr; sie denkt bloß nach.
Der Junge auf dem Feld hat das Ende der Reihe beinahe erreicht; er trägt kein Hemd und glänzt vor Schweiß, ist neun, vielleicht zehn Jahre alt. Er gehört zu den vielen Schwarzen, die in der Nähe in den winzigen Pachthütten wohnen und ihr Leben führen, als gäbe es ihre Tankstelle gar nicht. Sie brauchen kein Benzin und holen ihre Lebensmittel an der Verpflegungsstelle der Plantage ein paar Meilen entfernt. So läuft es, seit Dale die Tankstelle vor zwanzig Jahren von seinem Onkel geerbt hat und sie von New Orleans hier hoch gezogen sind. Als sie die Tankstelle übernahmen, war Ora sicher gewesen, dass sich die Dinge ändern würden. Sie hatte die Vorstellung gehabt, dass sie zu einer Art Treffpunkt werde, einem Ort, um sich die Zeit zu vertreiben, wie der Dorfladen in Natchez, wo sie aufgewachsen ist. Doch Dale hat diese Vorstellung nicht geteilt, er teilt sie noch immer nicht, und nichts hat sich verändert. Das «Nur für Weiße»-Schild, das Dales Onkel aufgehängt hatte, hängt noch immer an der Tür. Es hat Oras Gefühl der Isolation nur noch weiter verstärkt, von einer ganzen Gemeinschaft umgeben und doch vollkommen von ihr getrennt zu sein. Und Tobes Abwesenheit hat dieses Gefühl noch verschlimmert.
Spontan ruft sie nach dem Jungen, zum Teufel mit Dale. Er blickt hoch, als er Oras Stimme hört, und lässt die Hände an seine Seiten sinken, die eine ist leer, die andere hält den Sack umklammert. Er wartet ab. Ora schleudert ihre Sandalen weg und geht durch den Staub an den Rand des Feldes. Er beobachtet sie misstrauisch.
«Hungrig?», fragt sie ihn.
Er gibt keine Antwort.
«Ich hab Schweineschmorbraten auf dem Herd», sagt sie, «zu viel. Willst du eine Schüssel voll?»
«Nein, Ma’am.» Der Junge wirft einen Blick über die Schulter, quer über das Feld, wo andere Pflücker in der Ferne arbeiten.
«Du hast keinen Hunger?», fragt sie.
Er zuckt mit den Achseln. Die Schulterblätter unter seiner dunklen Haut stechen wie Vogelknöchel hervor.
«Wie wär’s mit Schokolade?»
Die Augen des Jungen flackern. Er lehnt nicht ab.
Ora greift nach der Schachtel Milch-Duds in ihrer Tasche, die sie nur halb leer gegessen hat. Sie schüttelt ein paar Milch-Duds in ihre Handfläche und sieht den Jungen an: ja?
Er stellt seinen Sack ab und läuft zum Feldrand, wo Ora steht. Sie lässt die Süßigkeit in seine ausgestreckte Hand fallen; er betrachtet die kleinen braunen Bälle mit verhaltenem Interesse.
«Probier einen.»
Er steckt sich eines der Bällchen in den Mund; als er kaut, erscheint ein Ausdruck der Überraschung auf seinem Gesicht. «Ist gar keine Schokolade», sagt er.
«Ist Karamell drin.»
Der Junge schluckt. «Schokolade wie die hab ich noch nie gegessen.»
Ein Ruf schallt über das Feld; der Junge dreht sich um und schaut in die Richtung. Dann wendet er sich erneut Ora zu und sieht sie an, als warte er auf ihre Erlaubnis oder darauf, dass sie ihn entlässt.
Sie zuckt mit den Achseln. «Geh nur», sagt sie und winkt ihm zu. Er schiebt die restlichen Milch-Duds in seine Hosentasche, und während sie zusieht, wie er durch die Ackerschollen davonläuft, ist sie überzeugt davon, dass Dale von der Tür hinter ihr ebenfalls zusieht. Sie ist sogar überzeugt davon, seinen missbilligenden Blick auf sich ruhen zu spüren. Doch als sie sich umdreht, ist der Türrahmen leer, und sie ist allein.
Dale geht hinter den Tresen, um die Münzen aus seiner Hosentasche in die Kasse zu werfen. Obgleich Ora es immer auf Anhieb schafft, muss er die Lade dreimal zudrücken, ehe sie einrastet. Er sieht die Zeitschrift, die Ora auf dem Tresen liegen gelassen hat, die Augustausgabe der Life. Auf dem Titelblatt ist ein uniformierter Armeeoffizier abgebildet, der eine gutangezogene Frau auf die Wange küsst. Die Bildunterschrift lautet Abschied eines Soldaten. Dale blinzelt. Er denkt an den Januar zurück, als sie sich zu dritt in den Bantam gezwängt hatten und, ohne ein Wort zu sagen, nach New Orleans gefahren waren, Ora zitternd, Tobe entschlossen, Dale selbst gegen jede Gefühlsregung verhärtet. Er sieht die Jungen vor sich, die sich bereits auf dem Bordstein versammelt hatten, als sie ankamen, und auf den Bus warteten, der sie ins Ausbildungslager bringen sollte. Sie trugen Jeans, keine Uniformen. Ihre Mütter weinten, den meisten Vätern sah man ihr Unbehagen an. Dale zumindest verspürte es. Er starrt auf das Cover der Zeitschrift, auf den uniformierten Mann, die stoische Frau. Abschied eines Soldaten, in der Tat.
Die Glocke über der Tür schrillt, und als Dale aufsieht, erblickt er Benny Mayes, der gekommen ist, um seine Nachtschicht bei der Zapfsäule anzutreten. Der Junge ist in Tobes Alter, der Jüngste von Art Mayes’ zehn Kindern, die alle auf seiner Farm einige Meilen entfernt aufgewachsen sind. Noch heute, mit achtzig Jahren, bestellt Art das Land. «Wollt Sie nur wissen lassen, dass ich da bin», sagt Benny.
Dale nickt ihm grüßend zu, dreht die Zeitschrift um. «Du bist früh dran», sagt er. «Ist noch nicht sechs.»
Benny zuckt mit den Schultern. «Hab sonst nichts zu tun», antwortet er. Er geht auf Dale zu mit einer Papiertüte in der Hand und reicht sie ihm über den Tresen hinweg. «Von meiner Mutter», sagt er. «Feigen. Haben eine Handvoll Bäume, die voll davon sind.»
Dale nimmt die Tüte entgegen. «Richte ihr meinen Dank aus», sagt er.
«Sie ist froh, wenn sie sie los ist.»
«Und ich, sie zu kriegen.» Dale schnieft. «Wie geht’s deiner Mutter? Hab sie in letzter Zeit gar nicht gesehen.»
«Der geht’s gut.»
«Und deinem Vater?»
«Ganz gut auch.»
Dale räuspert sich. «Und der Nigger, bringt der ihm was?»
«Scheint so.»
«Und wie geht’s seinem Knie?»
Benny zuckt mit den Achseln. «Passt schon. Jedenfalls fährt er schon wieder. Fährt heute Abend nach St. Martinville, um bei der Hinrichtung des Jungen zuzusehen. Sagte, dass er sich das nicht entgehen lassen will.»
Dale kratzt sich am Kopf. «Der Stuhl wird im Gefängnis sein, steht zumindest in der Zeitung. Wird’s nicht viel zu sehen geben.»
Benny zuckt die Schultern, und sie schweigen einen Moment lang.
«Wie auch immer», sagt Benny schließlich. «Ich geh raus und warte im Truck.»
«Gut», sagt Dale und schaut dem Jungen nach.
Wenn Lane manche Dinge zu lange festhält, etwa den Griff einer Axt, ein Austernmesser oder ein Lenkrad, beginnt die Narbe an seiner rechten Hand zu brennen, als werde die Haut noch einmal auseinandergezogen. Die Narbe fängt an zu schmerzen, als sie das Sumpfgebiet am Bayou Teche erreichen. Er hat sie sich mit dreizehn geholt, als er noch nicht wusste, wie man ein Schloss knackt und dass man die Hand mit einem Tuch schützt, wenn man eine Scheibe mit der Faust einschlägt. Damals hat er eigentlich nichts gestohlen, sondern sich nur die Remington Kaliber 22 zurückgeholt, die seinem Großvater gehört hatte und ihm demnach rechtmäßig zustand, die sein Vater aber beim Pokern aufs Spiel gesetzt und an einen Kumpel namens Guy Davis verloren hatte, der wie er in den Zuckerrohrfeldern arbeitete. Lane hatte die Scheibe über dem Türgriff eingeschlagen, durch das Loch gegriffen und sich gleich darauf mir nichts, dir nichts im Haus eines anderen Mannes befunden: kalte Suppe auf dem Herd, schmutziges Geschirr in der Spüle, schlammverdreckte Stiefel neben der Tür. Die Wunde hätte bestimmt genäht werden müssen, sie war schlecht zu einer wurmartig geschwollenen Linie verheilt, die ihn stets daran erinnerte, wie einfach es ist, in ein fremdes Haus einzudringen.
Er schüttelt die Hand, presst den vernarbten Knöchel an die Lippen und schmeckt das Salz seines Schweißes. Von der Straße aus kann er den versumpften Flussarm zwar nicht sehen, aber er kann seinen modrigen Geruch riechen, eine Mischung aus Mineral, Morast und Erde, die ihn unweigerlich an zu Hause erinnert. Die Zuckerrohr- und Baumwollfelder sind Wäldern aus Pekanbäumen gewichen, die ihrerseits stattlichen Häusern mit Säulen Platz machen, die sich zwischen Virginia-Eichen am Rand von New Iberia aneinanderdrängen. Nach der mitternächtlichen Hinrichtung in St. Martinville, zwölf Meilen im Nordosten, sollen sie hier in New Iberia die Nacht verbringen. Seward ist auf dem Beifahrersitz eingeschlafen; er atmet keuchend, und da sein Kiefer immer wieder auf- und zuschnappt, fragt sich Lane, ob der Mann im Traum wohl isst. Seit der Captain schläft, denkt Lane darüber nach, dass er den Stuhl irgendwohin fahren und abhauen könnte. Aber erstens weiß er nicht, wohin er soll, und zweitens hat er bereits die Hälfte seiner Zeit abgesessen; es ist besser, nun auch noch die restliche Zeit durchzustehen, als eine Bestrafung zu riskieren, die unter Umständen schlimmer wäre. Hier kommen sie nun also mit ihrer schrecklichen Fracht an.
Lane wirft dem Captain einen Blick zu. Seward regt sich, räuspert sich und setzt sich anders hin. Er sieht Lane an, als wolle er nachprüfen, ob der wohl bemerkt hat, dass er eingeschlummert ist. Dann schraubt er den Verschluss von dem Flachmann ab, den er in der Brusttasche trägt, und trinkt. Nachdem er sich den Mund abgewischt hat, späht er, die Hand über den Augen, durch die Windschutzscheibe.
Draußen glitzert Staub in der Sonne, aufgewirbelt vom Verkehr: Lastwagen mit Zuckerrohr, Tanklaster, die Öl geladen haben, Tieflader mit Containern. Der Motor des Trucks brummt gleichmäßig. «Bin seit 37 nicht mehr in New Iberia gewesen», sagt Seward schließlich und lässt seine Hand sinken, «dem Jahr, in dem mein Enkel geboren worden und gestorben ist.»
«Dem Jahr, in dem ich ins Gefängnis gekommen bin», murmelt Lane. Es ist möglich, dass er durch New Iberia gekommen ist, als der Vater seines Vaters krank wurde, aber da war er noch klein, und es war mitten in der Nacht, und er ist sich unsicher, ob es wirklich New Iberia oder nicht doch eine der anderen Städte gewesen ist, die von Öl und Rohrzucker leben. Er erinnert sich, dass sein Vater vom Abschaum geredet hat, der auf den Ölfeldern arbeitet, und an ein großes Feld mit Bohrtürmen im Mondschein, eine regelrechte Stadt aus dürren Galgen. Der größte Teil seiner Vergangenheit zeigt sich Lane in dieser Form, in plötzlichen Erinnerungsbildern, die keinen Zusammenhang ergeben. Es ist, als wäre sein Leben vor Angola eine Reihe einzelner, traumartiger Sequenzen, ohne eine Geschichte, die sie miteinander verbindet: eine Gans, die sich in einem Maschendrahtzaun verfangen hat; seine Mutter, die neben dem Haus über einem Topf Suppe weint; die winzigen, nackten Körper seiner Geschwister im Regen. Angola mit seinem Alltagstrott bietet wenig Anlass für Erinnerungen.
Als sie die Innenstadt erreichen, fährt Lane langsamer. Bis jetzt hat die Fahrt nichts als Sümpfe, Prärie und Zuckerrohrfelder sowie den einen oder anderen nichtssagenden Ort geboten. New Iberia ist die erste richtige Stadt für Lane, seit er vor sechs Jahren in Thibodaux verurteilt worden ist. Vor dem Barbier sitzen Männer auf Stühlen im Schatten, im offenen Fenster dreht sich langsam die rot-weiße Werbesäule. Menschen gehen die Straße auf und ab, vorbei an Schaufenstern, in denen bekleidete Schaufensterpuppen stehen, Bücher, Uhren oder Gebäck ausgestellt sind. Vor einem Kino stehen Leute unter einer Markise für eine Matinee-Vorstellung Schlange und fächeln sich mit allem, was sich dazu eignet, kühle Luft zu. Lane erinnert sich daran, wie er voller Sehnsucht aus dem Gefängnisbus auf Straßen wie diese geblickt hat, als er vom Gerichtsgebäude in Thibodaux weggebracht worden ist. Wenn er jetzt aus dem Fenster sieht, ist er von einer Verwirrung erfüllt, die an Panik grenzt. Die Innenstadt ist wie jede andere, die er bis jetzt gesehen hat, trotzdem könnte er genauso gut auf dem Mond gelandet sein. Nichts ergibt mehr einen Sinn: Filme, Restaurants, Boutiquen, modische Schuhe. Er fragt sich, ob es überhaupt je einen Sinn ergeben hat.
«Bieg da vorn nach links ab», sagt Seward und deutet darauf, «auf die Iberia Street.»
Lane biegt ab und hält auf Sewards Geheiß vor der Betontreppe eines großen weißen Gebäudes an, das ein Stück von der Straße zurückgesetzt liegt. Der vierstöckige Bau mit Zementstuck hat Stützpfeiler zwischen fünf Flügelfenstern, die beinahe über die ganze Höhe reichen und an Schlitze erinnern. Die Doppeltüren und Fensterrahmen sind aus mattem Aluminium, in die Türen sind acht leuchtende, kreisrunde Scheiben eingeprägt. Er hat noch nie ein solches Haus gesehen.
«Gerichtsgebäude», sagt Seward, «da drin wartet der Nigger. Zelle unterm Dach. Ich nehm mal an, dass es ihm heut Nacht nicht besonders geht.»
Lane wartet ab. Die plötzliche Nähe des verurteilten Mannes zu dem Stuhl, der ihn töten wird, sorgt dafür, dass er sich seltsam fühlt. «Ich hab gedacht, er ist in St. Martinville?»
«Hah! Wenn er noch im Gefängnis in St. Martinville wäre, hätten die anständigen Leute dort unseren Job doch schon erledigt, bevor wir überhaupt Angola verlassen hätten.»
Lane betrachtet das Gebäude und versucht sich den Mann im Innern vorzustellen; was er jetzt wohl macht, da er weiß, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat?
«Was hat er getan?», fragt er.
Seward spuckt aus dem Fenster. «Ein Mädchen vergewaltigt. In ihrem eigenen Bett. Ist einfach durchs Fenster gekrochen und hat’s ihr besorgt, während ihr Daddy und ihre Mama im Zimmer nebenan waren.»
Lane wartet erneut ab. «Hat er sie umgebracht?»
«Umgebracht? Glaub nicht, dass er noch irgendwo sicher wäre, wenn er sie auch noch getötet hätte.» Seward klopft auf die Seite des Trucks; der Ring, den er trägt, klirrt gegen das Blech. «Obwohl er’s eigentlich doch getan hat», fügt er hinzu, «sie hat sich nämlich bald darauf das Leben genommen. Hat sich am nächsten Tag mit der Pistole ihres Vaters eine Kugel in den Kopf gejagt.»
Der Himmel hinter dem Gerichtsgebäude glüht in jenem orangen, unheimlichen Farbton, der eigentlich für die Jahreszeit üblich ist, in der die Felder abgebrannt werden, die aber noch nicht angefangen hat. Eine nahe gelegene Kirchenglocke schlägt sechs Mal, und Lane denkt, während er zuhört, dass der verurteilte Mann das Geläut ebenfalls hört.
Am Rand des Zwiebelfeldes bellt ein Hund, sein Vater und er arbeiten sich durch die Reihen und ziehen die Knollen, deren Spitzen trocken sind. Will hat einen ganzen Sack davon, nicht bloß weiße, sondern auch violette, braune, grüne und sogar blaue. Sein Vater arbeitet einige Reihen von ihm entfernt, bückt sich, richtet sich auf, bückt sich, richtet sich auf. Es ist sonnig und wolkenlos, doch sein Vater ist nass, als käme er gerade aus dem Bayou, sein Hemd klebt ihm am Körper, seine wadenlange Hose tropft. Als Will an sich hinunterschaut, sieht er, dass er genauso nass ist; seine Ärmel sind schweißgetränkt, auf seinen Fußketten glänzen Tropfen.
Will! Die Stimme seines Vaters schallt über das Zwiebelfeld. Will!
Er sieht auf. Solch eine Zwiebel, wie sein Vater sie in der Hand hält, blutrot und groß wie ein Basketball, hat Will noch nie gesehen. Sein Vater nimmt den Hut ab und winkt ihm damit zu, doch als er ihn in die Höhe hält, stürzt sich ein Adler auf ihn herab und schnappt ihm den Hut aus der Hand. Will hebt die Hand, um die Augen vor der Sonne zu schützen; während er zusieht, wie der Vogel höher und höher steigt und davonfliegt, seine riesengroßen Krallen um die Krempe geschlagen, dämmert es Will, dass er träumt.
Er hält seine Augen geschlossen, der Traum verblasst, und er wird in die triste Wirklichkeit zurückgeworfen. Er hält am Bild seines Vaters und des Zwiebelfeldes fest, aber er spürt die harte Pritsche unter sich, hört das Wasser in der Ecke der Zelle tropfen, riecht den fauligen Gestank, der aus der offenen Toilette steigt. Und genau wie in seinem Traum bellt jetzt tatsächlich ein Hund; immer bellt irgendwo ein Hund.
Er öffnet die Augen und sieht das letzte Tageslicht, zerstückelt von den Gitterstäben, auf die Betonwände fallen. Er hat eigentlich gar nicht einschlafen wollen. Aber seit einiger Zeit kommt der Schlaf, wann er will, und immer bringt er Träume mit sich. Manchmal sind es Albträume: verbranntes Fleisch, versengtes Haar, tödliche Stromstöße, die durch seinen Körper jagen. Meist aber träumt er von kleinen Dingen, von einem Splitter unter dem Daumennagel zum Beispiel oder wie er mit nackten Zehen Kreise in die Erde zeichnet oder vom Gefühl, gleich zu stürzen, wenn man rückwärts rennt, um einen Ball gegen die blendende Sonne aufzufangen; winzige Details, die dafür sorgen, dass sich der Schlaf mehr nach Leben anfühlt, als wenn man wach ist. Wach zu sein bedeutet, bloß zu existieren. Wach zu sein bedeutet, auf das Sterben zu warten und darauf, dass das, was geschieht, wirklich erscheint.
Seit er Grace das erste Mal gesehen hat – ihre Ellbogen hatte sie tief in eine große Schüssel gesteckt, und sie hatte Mehl im Gesicht, einen perfekten, weißen Halbmond direkt unter ihrem Wangenknochen –, ist ihm nichts je wirklich erschienen; es war dieses Bild von ihr, das er wochenlang mit sich herumtrug, an das er dachte, während er Kuchenformen und Schüsseln mit süßen Teigfetzen schrubbte oder auf dem Nachhauseweg von seiner Schicht gewesen ist, so verloren in Gedanken, dass er, zu Hause angekommen, gar nicht mehr wusste, wie er dorthin gekommen ist. Er fand sich in einer Welt wieder, die ganz und gar von Grace bestimmt wurde, in einer Welt, in der alles ein Traum zu sein schien: das Knistern, wenn sie sich in der Küche zufällig berührten, das Gespräch ihrer Augen, ihr leichter Körper auf dem seinen, der Nervenkitzel, der Schrecken. Und dann wurde aus dem Traum ein Albtraum: der Vater, wie er mit rasendem Gesichtsausdruck in der Türöffnung stand; wie er, Will, kurz vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gerannt ist, blind vor Angst; die Deputies und der Mob, die zur gleichen Zeit nur wenig später schon vor seiner Haustüre standen, an ihr pochten, fluchend, schreiend. Manchmal wünscht Will, der Mob hätte ihn zuerst zu fassen bekommen.
Will erhebt sich von der Pritsche und sieht aus dem Fenster. Die Sonne steht als schwelende, orange Kugel am Horizont. Sie ist so tief gesunken, dass die Blechdächer der Holzhäuser um das Gerichtsgebäude, die den ganzen Tag in der Sonne gleißen, im Schatten liegen. Die Turmspitze von St. Peter dagegen ragt noch immer ins Licht. Das ist der letzte Sonnenuntergang, den er sehen wird. Diese Einsicht ist so seltsam, dass sie Will nicht so trifft, wie sie es eigentlich müsste, genau wie ein Schock den Schmerz eines Knochenbruchs zunächst verdrängt, wie er vermutet.
Nach einigen Minuten hört er Schritte, die den Korridor hinunterkommen, das Klirren von Schlüsseln. Sein letzter Sonnenuntergang. Will atmet tief ein, tritt vom Fenster weg und setzt sich auf den Rand der Pritsche. In seinem Blick glüht der Sonnenuntergang noch nach. Die Schritte haben ihn erreicht.
Sheriff Grazer erscheint in der Tür seiner Zelle, begleitet von einem Mann, der das gleiche braune Gewand wie Will trägt. Der Mann bleibt dicht hinter Grazer stehen und sieht Will nervös an, während der Sheriff den Schlüssel ins Schloss steckt. Der Häftling hält eine Schüssel in den Händen, in der sich ein Rasierer, eine Schere, ein Rasierpinsel und Seife befinden.
Grazer lässt die Zellentür aufschwingen und bedeutet dem Häftling, einzutreten.
«Abend, Will», sagt der Häftling.
Will nickt und hebt die Hand, um seine Wange zu berühren, seine Haare.
Grazer trägt einen Klappstuhl aus dem Korridor herein. «Burl hier wird dir den Kopf scheren», sagt er und stellt den Stuhl in die Mitte von Wills enger Zelle.
«Tut mir leid, Will», sagt Burl und legt Rasierpinsel, Seife und Schere auf die Liege. Er ist klein und drahtig, alt genug, um ergraute Schläfen zu haben, aber immer noch mit einem jugendlichen Körper. Er sieht Will mit Bedauern an, das Weiß seiner Augen ist ungesund gelb. Will nickt einmal, als Zeichen dafür, dass er einverstanden ist oder ihm vergibt. Burl tritt ans Becken, um die Schüssel mit Wasser zu füllen.
«Setz dich», sagt Grazer und zeigt auf den Stuhl. Will erhebt sich von der Pritsche. Und als er sich auf den Klappstuhl setzt, erinnert er sich an Maud Clovers Herrensalon in St. Martinville, an die weißen Männer, die auf ihren zurückgekippten Stühlen stundenlang unter zeltartigen Kitteln saßen und Neuigkeiten mit Maud austauschten, während der Friseur um ihre Ohren herumschnippelte oder den Rasierer über ihre eingeseiften Wangen führte. Als Kind hat Will auf dem Heimweg vor dem Herrensalon manchmal mit Little Maud geredet, dabei aber immer mit einem Auge beobachtet, wie das Rasiermesser des Friseurs durch die Stoppeln glitt, fasziniert von der Balance zwischen sanft und entschlossen, mit der er die Klinge führte.
Will spürt, wie Burl ihm mit einem feuchten Waschlappen über den Kopf fährt. Er blinzelt und kehrt in seine Zelle zurück; wie oft er doch in seine Gedankenwelt abtaucht.
«Was für ein schöner Abend», sagt der Häftling hinter ihm, «wird wohl kühler.»
«Die Hitze ist noch nicht vorbei», sagt Grazer. Er lehnt vor Will an der Zellenwand, die kräftigen Arme vor der Brust verschränkt. «Ich rechne mal damit, dass es nächste Woche noch schlimmer wird.»
«Wenn Sie meinen», sagt Burl.
Will betrachtet seine Hände und berührt eine wunde Stelle am Knöchel, die ihn seit einer Weile stört. Wie unwichtig das Wetter doch ist. Es wird, ein weiterer seltsamer Gedanke, nächste Woche auch ohne ihn heißer oder kühler sein. Er kratzt sich am Knöchel, bis es blutet; er begreift, wie unwichtig auch diese Wunde ist.
«Also», murmelt Burl und reibt Schaum in Wills Haar, «gut so, Will?»
Will schließt die Augen; die Berührung von Burls knochigen Fingern auf seinem Schädel gibt ihm das Gefühl, erschöpft in den Schlaf sinken zu dürfen. «Gut so», antwortet er. Es ist eine Weile her, seit ihn ein Mensch berührt hat.
«Musst rein sein, um dem Herrn zu begegnen», murmelt Burl.