
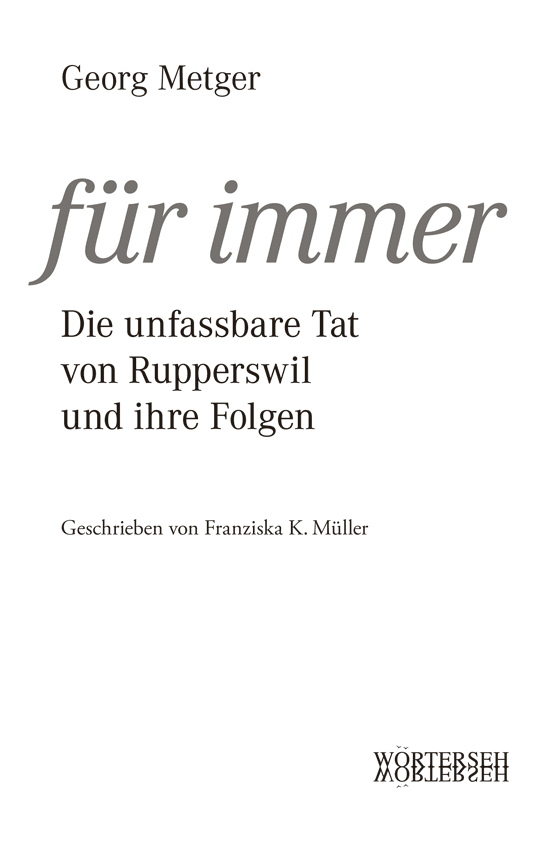
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 bis 2020 unterstützt und dankt herzlich dafür.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2018 Wörterseh, Gockhausen
2. Auflage 2018
Juristisches Lektorat: Markus Leimbacher, Rechtsanwalt, Brugg
Lektorat: Lydia Zeller, Zürich
Korrektorat: Claudia Bislin, Zürich
Lektoratsleitung und Koordination: Andrea Leuthold, Zürich
Umschlaggestaltung: Thomas Jarzina, Holzkirchen
Layout, Satz und herstellerische Betreuung:
Beate Simson, Pfaffenhofen a. d. Roth
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Print ISBN 978-3-03763-084-6
E-Book ISBN 978-3-03763-710-4
www.woerterseh.ch
∞
Über die Autoren
Über das Buch
Prolog
Der dunkelste Tag
Stille Nacht
In Stein gemeißelt
Zeit zum Träumen
Unter Verdacht
Der Maulkorb
Suche nach dem Täter
Erste Ergebnisse
Trauerarbeit
Carla und ich
Was wäre gewesen
Die große Liebe
Die neue Familie
Davin und Dion
Familiäre Konsequenzen
Ungelöst
Spuren im Sand
Kein Zuhause
Hallwilersee
Was ich liebte
Endlich gefasst
Einer von uns
Wut und Hass
Die Angehörigen
Ich war glücklich
Täterschutz
Überwacht
Die erste Hausbegehung
Abscheu und Ekel
Erneutes Schweigen
Erinnerungen von Mirco Metger, 21,
Sohn von Georg Metger
Zurück von den Sternen
Die Strafe
Der Brief des Täters
Warum?
21. Dezember 2017
Für immer
In eigener Sache
Eindrücke vom Prozess
von Franziska K. Müller
Interview
Dank
GEORG METGER, geb. 1968, war nach dem Vierfachmord von Rupperswil unfassbaren Anschuldigungen ausgesetzt. Als Partner von Carla Schauer galt er lange als Hauptverdächtiger. Nachdem der Mörder gefasst und damit verbunden auch endlich das Motiv der Tat klar geworden war, musste der damals 49-Jährige nicht nur mit der Wahrheit fertig werden, sondern auch mit dem Hass auf einen Mann, dessen Tat für immer ganz und gar unbegreiflich bleiben wird. Gerettet haben Georg Metger seine zwei eigenen Söhne; sie waren es, die ihm die Kraft gaben, wieder aufzustehen. Mit der Veröffentlichung seiner Geschichte möchte er dazu beitragen, dass Carla, Dion, Davin und Simona niemals in Vergessenheit geraten und nicht nur als Opfer in Erinnerung bleiben, sondern als das, was sie waren: einzigartige, wunderbare Menschen.
FRANZISKA K. MÜLLER ist selbständige Journalistin und Autorin. Nachdem Georg Metger sich mit dem Wunsch, seine Geschichte zu veröffentlichen, an Wörterseh gewandt hatte, war es für den Verlag schnell klar, dass sie die Richtige ist, das Unfassbare ohne Voyeurismus darzulegen und aufzuzeigen, was Angehörige von Opfern von Gewaltverbrechen auf verschiedensten Ebenen durchmachen müssen. Das jetzt vorliegende Buch ist das Resultat von langen Gesprächen und von verschiedenen Aufzeichnungen, die Georg Metger bereits gemacht hatte, um das Geschehene zu verarbeiten. Franziska K. Müller, die für Wörterseh unter anderen bereits die Bestseller »Heimatlos«, »Platzspitzbaby«, »Leben!« und »Mutanfall« geschrieben hat, lebt und arbeitet in Wien und Zürich.
Der Vierfachmord von Rupperswil vom 21. Dezember 2015 veränderte von einer Sekunde auf die andere das Leben der Angehörigen von Carla, Dion, Davin und Simona; für immer. Carlas Eltern verloren ihre Tochter und ihre beiden Enkelkinder. Carlas Bruder verlor seine Schwester und seine beiden Neffen. Simonas Eltern verloren ihre Tochter, ihre Geschwister die Schwester. Georg Metger verlor die Liebe seines Lebens und seine zwei Ziehsöhne. Darüber hinaus geriet er ins Fadenkreuz der Ermittlungen. In den Tagen und Monaten, die dem grausamen Verbrechen folgten, blieb für ihn kein Stein auf dem anderen.

Das schriftliche Festhalten der schrecklichen Geschehnisse, denen ich ausgesetzt war, hatte in der schlimmsten Zeit meines Lebens eine heilende Wirkung. Bevor ich mich dazu entschloss, alles aufzuschreiben, bewirkten der gewaltsame Tod meiner Partnerin und ihrer Kinder, die ich als Familie empfand, und die sich danach überschlagenden Ereignisse ein mentales und psychisches Chaos in mir. Eindrücke, Visionen, tausend Fragen und Gedanken beschäftigten mich Tag und Nacht. Ich verlor die Orientierung, die Belastung wurde unerträglich. Dann endlich begann ich zu schreiben, und bereits nach den ersten Notizen bemerkte ich, wie sich manches klärte, später half es mir, anderes sogar loszulassen. Ordnen und gewichten, das alles half mir, zu überleben: Vor dem Hintergrund unglaublicher Anschuldigungen, denen ich in der Zeit der Trauer ausgesetzt war, ohne dass ich mich hätte wehren können, wollte ich festhalten, wie es wirklich war.
Ich hatte dann das Glück, dass mich eine langjährige Freundin auf die Verlegerin Gabriella Baumann-von Arx aufmerksam machte und den Kontakt zu ihr herstellte. Ich lernte sie in einem frühen Stadium kennen, als der Täter noch nicht gefasst war. Wir trafen uns, redeten stundenlang. Sie vertraute mir, nie hatte ich das Gefühl, sie sehe mich als eventuellen Täter. Sie unterstützte mich, mein Buchprojekt zu realisieren, das daraufhin in enger Zusammenarbeit mit Franziska K. Müller entstanden ist. Das jetzt vorliegende Buch erzählt meine unglaubliche und verstörende Geschichte, es macht auf Versäumnisse und Missstände aufmerksam und auf die vielen Konsequenzen, die mit einem Verbrechen verbunden sind. Es hat mir geholfen, die Tragödie zu verarbeiten, und hat mir Linderung verschafft. Die Tantiemen werde ich für wohltätige Zwecke spenden.
Mein größter Wunsch ist es, dass mit diesem Buch Carla, Dion, Davin und Simona, die mir und uns auf die denkbar schrecklichste Art und Weise entrissen wurden, niemals in Vergessenheit geraten und nicht nur als Opfer in Erinnerung bleiben, sondern als das, was sie waren: einzigartige, wunderbare Menschen.
Carlas lange Haare sind zerzaust, ihr kluger Blick ist auf den Bildschirm des Handys gerichtet. Im Bett sitzend, ist sie auf der Suche nach letzten Weihnachtsgeschenken. Davin, ihr Jüngster, wünscht sich neue Fußballschuhe. Dion, der Ältere, ist ein Mode-Fan und wird sich über einen entsprechenden Gutschein freuen. Engelsfiguren und Kerzen schmücken das ganze Haus. Selbst gebackene Lebkuchen und anderes Gebäck liegen bereits in hübschen Blechdosen bereit. Der Tannenbaum steht im Wohnzimmer. Carla und ich wollen ihn am 23. Dezember gemeinsam schmücken, ein Ritual, seit vielen Jahren. Die Frau, die meinem Leben Sinn und Kraft gibt, greift lächelnd nach der Tasse Milchkaffee, die ich ihr ans Bett serviere. Sie atmet den Duft mit geschlossenen Augen ein, trinkt in kleinen Schlucken, genussvoll. Diese frühmorgendliche Normalität, verbunden mit der berechtigten Hoffnung auf eine glückliche Zukunft, hat sich für immer in meinem Herzen eingebrannt.
Die Kinder schlafen noch. Ich erinnere mich nicht an ihre letzten Sätze, doch an den Abend zuvor, das gemeinsame Essen, das Gelächter, die familiäre Geborgenheit. Erinnere mich an den Nachmittag, den ich mit Davin im Kino verbracht habe. »Star Wars«. Auf dem Heimweg hat er mich zum Dank umarmt, und ich wusste, dass ich ihm nicht nur ein Freund, sondern auch zum Vaterersatz geworden bin. Manchmal sitzt auch Simona bei uns am Esstisch, erzählt über ihr Engagement in der Jungschar, über ihre Passion, das Tanzen. Seit einem Jahr sind sie und Dion ein Paar, und manchmal übernachtet sie auch ganz spontan bei ihm. Sie weiß, sie ist jederzeit willkommen, und steigt dann leise in den ausgebauten Dachstock, den Carla und ich für Dion geräumt haben. Auch jetzt, als ich das Haus verlasse, deuten winzig scheinende Turnschuhe im Eingangsbereich auf Simonas Anwesenheit hin. Es ist 7 Uhr 25. Ich küsse Carla zum Abschied und weiß nicht, dass es ein Abschied für immer sein wird. Als ich die Haustür hinter mir ins Schloss ziehe, gebe ich Carla und die Kinder nichts ahnend der Schutzlosigkeit preis.
Wir leben im Spitzbirrli-Quartier, einer beschaulichen Wohngegend von Rupperswil. Kinder können hier allein draußen spielen, die Haustüren werden offen gelassen. Man glaubt, einander zu kennen, meint, einander vertrauen zu können. Zumindest den Menschen, die sich in der kleinen Siedlung über den Weg laufen. Carlas Einfamilienhaus liegt in einer Sackgasse, was zusätzliche Sicherheit vermittelt. Draußen ist es noch dunkel, als ich zum Auto gehe, Windlichter und Laternen schmücken unseren Hauseingang, in anderen Vorgärten stehen beleuchtete Rentiere und blinkende Schneemänner. Es ist ein ganz normaler Montagmorgen.
Die Ruhe und die Sicherheit werden sich als Lügen erweisen: Während sich Davin in seine Decke kuschelt, Simona im Arm von Dion liegt und Carla den Morgen genießt, denkt ein paar Häuser weiter jemand über unsere Vernichtung nach. Hätte man etwas bemerken müssen, eine Zweideutigkeit in der Luft, die auf das bevorstehende Schicksal hinwies? Auf manche Fragen gibt es keine Antworten, das weiß ich heute und weiß auch, dass mein Weggang nicht nur erwartet, sondern auch beobachtet wird. Am frühen Morgen des 21. Dezember 2015 fahre ich durch die beschaulichen Straßen unseres Quartiers und lasse mir auf dem Weg nach Aarau verschiedene Menüvorschläge für Silvester durch den Kopf gehen. Carla und ich werden den Jahreswechsel zum ersten Mal allein verbringen. Als ich den Wagen in der Tiefgarage am Hauptsitz meines Arbeitgebers parkiere, steht der erste Gang fest: gebratene Jakobsmuscheln auf einer Avocadomousse.
Die Budgetsitzung, an der ich als Niederlassungsleiter der Region Aarau teilnehme, dauert knapp zwei Stunden. Gegen zehn Uhr befinde ich mich bereits auf dem Weg nach Lenzburg. In der dortigen Bankniederlassung arbeite ich seit vielen Jahren als Filialleiter. Ich ahne nichts, ich spüre nichts, aber bereits auf meiner Rückfahrt von Aarau nach Lenzburg muss Carla massiven Bedrohungen ausgesetzt gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hat sie am Bankomaten in Rupperswil Geld bezogen. Da – wie später bekannt wird – die Schweizer-Franken-Funktion außer Betrieb ist, kann sie lediglich 1000 Euro abheben. Um 10 Uhr 10 trifft sie am Schalter der Aargauischen Kantonalbank in Wildegg ein und lässt sich 9850 Schweizer Franken in einer mysteriös erscheinenden Stückelung aushändigen.
Dort macht eine Überwachungskamera das letzte Bild von Carla. Wie oft ich diese Aufnahme betrachtet und nach Erklärungen gesucht habe, kann ich nicht mehr sagen. Carla ist auf dem Bild ungeschminkt, die Haare hat sie vermutlich mit einem schnellen Griff zusammengebunden – eine Geste, die ich oft erlebt habe, bei Tisch oder wenn die Haarpracht sie bei anderen Tätigkeiten störte. Ihre Mimik ist angespannt, und die Unterzeichnung des Empfangsbelegs geschieht abwehrend, so empfinde ich es. Gleichzeitig wirkt sie auf mich aber auch entschieden und gefasst. Als müsse erledigt werden, was keine Alternative zulässt. In ihren Gesichtszügen erkenne ich keine Panik, und ich bin sicher, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Überzeugung ist, dass die Kinder, die sich in der Gewalt des Täters befinden, überleben werden. Doch das Schicksal ist längst festgeschrieben, die geschürte Hoffnung nichts als Bestandteil eines Plans, der in einem unfassbar schrecklichen Szenario endet.
Carla schlägt nicht Alarm, obwohl am Bankschalter ein ehemaliger Zollbeamter sitzt, den sie persönlich kennt. Man weiß nicht genau, was Opfer eines Gewaltverbrechens durchmachen, welche Gefühle und Gedanken sie leiten und aus welchen Überlegungen sie in einer Extremsituation Entscheidungen treffen, die das Risiko schrecklicher Konsequenzen möglichst klein halten sollen. Was ich aber mit absoluter Sicherheit weiß: Niemals hätte Carla die Kinder allein zurückgelassen und sich in Sicherheit gebracht. Niemals hätte sie Dion, Davin und Simona einer noch so geringen Gefahr ausgesetzt. Sie erfüllt die Anweisungen des Täters, verzichtet auf das Einschalten der Polizei oder anderer Personen, um ganz sicher zu sein, dass den Kindern nichts passiert. Dann kehrt sie zu ihnen zurück. Was geschehen wäre, wenn sie anders gehandelt hätte – das werden wir nie wissen.
Um 11 Uhr 40 ruft mich Carlas Vater im Geschäft an. Bei uns zu Hause brenne es, sagt er. Während mein Hirn seine Nachrichten und Informationen aufnimmt und verarbeitet, bleibt das Bewusstsein schwer von Begriff. Ich erinnere mich daran, dass mich das Wort »Ambulanz« mehr beunruhigte als das Wort »Feuerwehr«, an die rasante Autofahrt nach Rupperswil und an die zahlreichen Geschwindigkeitsübertretungen, die ich auf dieser Strecke begehe. Während ich fahre, auch das weiß ich noch, spiele ich verschiedene Szenarien durch, die zu einem Brand hätten führen können. Ich bin sicher, dass Carla, die ja bereits wach war, als ich das Haus verließ, die Kinder rechtzeitig wecken und in Sicherheit bringen konnte. Gleichzeitig mache ich mir Vorwürfe. Ist mir am Vorabend eine brennende Kerze entgangen? Dann ein unfassbarer Gedanke, der mich, wie ich heute überzeugt bin, vor dem späteren Zusammenbruch bewahren wird: Könnte es sein, dass jemand im Feuer gestorben ist?
Von weit her sehe ich eine dunkle Rauchsäule in den winterlichen Himmel steigen. Angst durchflutet mich. Vor meinem Zuhause sind unzählige Menschen versammelt: Nachbarn, Neugierige, erste Medienleute, die Feuerwehr, die Polizei und ein Krankenwagen. Lärm und Ruhe wechseln sich ab. Ich sehe Rauch aufsteigen. Ich will zum Haus, aber man lässt mich nicht durch. Ich stelle mich der Amtsperson vor, und als ich als Angehöriger identifiziert worden bin, wird mir ein Polizeibeamter zur Seite gestellt. Es dauert einen Moment, bis sich meine Verwirrung legt und ich ihn fragen kann: »Wo ist Carla, wo sind die Kinder?«
Ich erlebe ein Flashback. Jahre zuvor erlitt ein Arbeitskollege während eines Firmenausflugs einen Herzinfarkt. Eben hatten wir noch zusammen gescherzt, waren in die Klettergurte gestiegen, um im Team die künstlichen Felswände zu erklimmen, als er sich während einer Kletterpause plötzlich ans Herz fasste und zusammensackte. Alle Rettungsversuche waren vergeblich. Wir mussten sein plötzliches Sterben miterleben. Es war eine Erfahrung, auf die niemand je vorbereitet sein kann. In den Sekunden vor seinem Tod erfasste ich die gesamte Situation und wusste, dass wir gerade eine Katastrophe erlebten.
Auch jetzt betrachte ich das Geschehen von außen, sehe das Unglück mit absoluter Sicherheit auf mich zukommen. Menschen rennen durcheinander, andere stehen mit schockierten Mienen auf dem Vorplatz. Sie reden. Sie schweigen. Sie weinen.
In meinem Kopf ist es sehr still. Dann trifft mich ein Bild mit unglaublicher Wucht. Die Sanitäter sind um ihr Fahrzeug versammelt, untätig. Warum retten sie niemanden? Warum retten sie nicht Carla, Dion, Davin und Simona, die doch noch im Haus sein müssen? Zwei Sanitäter treten aus unserer Haustür, die Bahre, die sie tragen, ist leer. Meine verzweifelten Fragen, die ich den Polizisten, die neben mir stehen, stelle, werden nicht beantwortet, im Gegenteil. Sie stellen mir Gegenfragen, um meine Person einordnen zu können. Sie möchten wohl in Erfahrung bringen, ob ich mit den Geschehnissen etwas zu tun habe. Ich erhalte keinerlei Informationen, nichts, nicht den kleinsten Hinweis und meine, die Wahrheit bereits zu kennen. Meine Vermutung, dass alle vier an einer Rauchvergiftung gestorben sein müssen, verbinde ich mit der irrsinnigen Hoffnung, jemand möge doch überlebt haben.
Carlas Eltern sitzen abgeschirmt in ihrem Auto. Sie sind sehr traurig, das sehe ich. Rösly winkt mir mit Tränen in den Augen zu. Ich will zu ihnen, werde aber zurückgehalten, darf nicht mit ihnen sprechen, und instinktiv weiß ich, dass etwas im Raum steht, das für Unklarheit sorgt. Mein Körper befindet sich in einem Schockzustand, reagiert jedoch beherrscht. Im Kopf bin ich klar, normal und rational denkend. Ich funktioniere, ich fasse Gedanken, ziehe Schlüsse, und die folgende Situation erscheint mir als absurd. Ich sitze wenig später in einem Fahrzeug der Polizei, ein Polizist nimmt neben mir Platz, blickt mich an. Ich empfinde beinahe Mitleid für den Beamten, denn ich ahne, dass er mir eine schreckliche Nachricht überbringen muss. Und dann sagt er es: »Es sind vier Menschen tot.« Ich höre die Worte wie aus weiter Ferne und denke, es müssen Carla, Dion, Davin und Simona sein. Ich weiß, dass er nicht lügt, und glaube es doch nicht. Mein Hirn funktioniert jetzt wie ein Computer mit eingebauter Firewall. Die ganze Tragweite der Information dringt nicht zu mir durch.
Auf der Fahrt ins Polizeikommando Aarau wird mir eröffnet, dass keine Nachlässigkeit zu dieser Katastrophe geführt hat, kein Unfall, den man als höhere Fügung bezeichnen könnte. Der Polizeibeamte spricht von Dritteinwirkung. Was das genau bedeutet, muss er mir erklären. Er sagt: »Es war Absicht.« Dann: »Es war menschlicher Wille.« Und als ich immer noch nichts begreife: »Es war ein Verbrechen.« Ich höre zu und nicke, nach wie vor ohne etwas zu verstehen, ich kann nicht verarbeiten, was er sagt, und gerate in einen Zustand der Apathie und der Verneinung. Der Polizist redet jetzt von »Brandbeschleuniger«. Heute weiß ich, dass man bereits zu diesem Zeitpunkt denkt, ich könnte der Verursacher des Unfassbaren sein und über Täterwissen verfügen, weshalb man mich im Glauben lässt, dass Carla und die Kinder in einem absichtlich gelegten Feuer umgekommen sind. Rückblickend war es eine Gnade, dass ich die wirkliche Todesursache erst später erfahre.
Bei der darauf folgenden Vernehmung glaube ich, als Angehöriger befragt zu werden. Als sie meine Hände und Nägel auf Rußspuren untersuchen, sagen die Beamten, es handle sich um eine Routineuntersuchung. Erst als ich meinen Tagesablauf akribisch schildern und viele seltsame Fragen beantworten muss, beginne ich zu ahnen, dass man mich als Verdächtigen qualifiziert. Vier geliebte Menschen sind tot. Kein Unfall. Ein Verbrechen. Und ich – ich werde verdächtigt, ihr Mörder zu sein. Den damit verbundenen Seelenzustand kann ich nicht in Worte fassen. Schmerz und Trauer erfahren eine neue, eine überwältigende Dimension. Ich möchte tot sein und weiß nicht, welche bösen Kräfte das Weiterleben erzwingen. Wieso hört mein Herz nicht einfach auf zu schlagen? Bereits habe ich Mobiltelefon und Kleidung abgeben müssen, bekomme Trainerhosen und Plastikschuhe ausgehändigt. Man begleitet mich zur Toilette. Ich sehe, dass die Kleidungsstücke ohne Bändel sind. Man hält mich offenbar für suizidgefährdet.
In den folgenden Stunden müssen die Auswertungen verschiedenster Informationen und Befragungen wiederholt der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden. Diese formuliert neue Fragen, die mir abermals vorgetragen werden. Einmal entsteht eine Pause, und zum ersten Mal seit vielen Stunden bin ich allein. Ich sitze in einem grell erleuchteten, spartanisch eingerichteten Büro. Ein Wachmann steht vor der Tür. Carla, Dion, Davin und Simona sind tot. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Bis jetzt hatte ich meine Emotionen irgendwie unter Kontrolle, jetzt weine ich zum ersten Mal. Hemmungslos. Die Unfassbarkeit führt paradoxerweise zu einem klaren Gedanken: Ich gehe von einem Raubmord aus. Der oder die Täter waren auf der Suche nach Geld. Im Haus eines Bankdirektors vermuteten sie eine ergiebige Beute. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Wenig später tritt der Polizist wieder ins Büro. Er setzt sich mir gegenüber und blickt mir in die Augen. Er sagt »Messer«, sagt »Stichwunden«. Ich habe keinen Nervenzusammenbruch. Ich weine nicht mehr. Es gibt kein Ventil für die überwältigende Furcht, die mich erfasst, und erneut denke ich, dass meine Arbeit und meine Stellung Grund für das Verbrechen sein müssen.
Ich bin in diesem Moment überzeugt davon, für das, was geschehen ist, verantwortlich zu sein, anders, als es der Polizist vielleicht vermutet, aber dennoch schuldig. Ich denke an Rösly und Georges, meine Schwiegereltern, wie ich sie nenne, auch wenn Carla und ich nicht verheiratet waren. Für ein paar Sekunden sehe ich sie im Korridor des Polizeipräsidiums, als ich zur Toilette geführt werde. Sie sind am Boden zerstört, und doch winken sie mir zu.
Ich spüre ihre Zuneigung und ihr Mitgefühl, weiß sofort, dass sie mich nicht für den Täter halten und weniger schlecht über mich denken als ich selbst. Andere Angehörige und meine beiden leiblichen Söhne werden an diesem Tag ebenfalls befragt, wie ich später erfahre. Mirco, damals neunzehnjährig, muss Auskunft über mich geben, eine Einschätzung zur Beziehung von Carla und mir abgeben und auch sein Alibi nennen, das wie meines überprüft wird. Auch Fabio, damals zwölf, wird auf das Polizeikommando in Aarau geholt und ebenfalls befragt. Er glaubt, dass ich der vierte Tote bin. Er ist verzweifelt und erkundigt sich während der Befragungen immer wieder nach meinem Verbleib, erhält die erlösende Nachricht aber nicht. Es sind, wie er mir später erzählen wird, die schlimmsten Stunden seines Lebens.
Zwölf Stunden verbringe ich auf dem Polizeikommando, einem Kosmos, der, wie ich jetzt weiß, nach eigenen Regeln funktioniert. Es ist nach Mitternacht, als Mirco und ich zum gleichen Zeitpunkt entlassen werden. Mein Sohn umarmt mich. Wir blicken in die Nacht hinaus, fühlen uns beide absolut leer.
Die Welt ist mir innerhalb eines Tages fremd geworden. Das Unfassbare kann jederzeit geschehen. Wenn der Anschlag meiner Person gegolten hat, was auch von den ermittelnden Beamten nicht ganz ausgeschlossen wird, wie man mir gesagt hat, könnten die Täter zurückkommen, ihr Werk weiterführen und vollenden wollen. Mir ist dieser Gedanke egal, aber meine Söhne muss ich schützen. Fabio wohnt bei Danira, seiner Mutter, meiner Exfrau, Mirco hat in Niederlenz eine Wohnung. Man verspricht mir, dass eine Polizeipatrouille seine Adresse in den kommenden Wochen regelmäßig kontrollieren wird. Eine Patrouille wird uns in dieser Nacht auch auf unseren Wunsch hin zum Haus im Spitzbirrli-Quartier bringen.
Im Polizeiauto nehme ich mein Handy zur Hand, das man mir, nachdem man es stundenlang konfisziert hatte, wieder ausgehändigt hat, und sehe, dass besorgte, verstörte und schockierte Menschen im Verlauf des Tages unzählige SMS und Combox-Nachrichten hinterlassen haben. Unvermittelt hält das Auto. Unser Haus ist großräumig abgesperrt, und es wird durch Beamte bewacht. Zu Fuß gehen Mirco und ich weiter. Unsere Ankunft ist durch einen Polizeibeamten angekündigt worden, wir werden durchgelassen.
Die vielen Menschen – Nachbarn, Polizisten, Schaulustige und Medienvertreter –, die das Gelände am Mittag bevölkert haben, sind jetzt verschwunden, auch die Fahrzeuge von Feuerwehr, Ambulanz und privaten Fernsehstationen. Der Lärm hat sich, ebenso wie die Hoffnung, verflüchtigt. Es herrscht dunkle Nacht, der Himmel ist ohne Sterne. Doch bald erblicken wir ein Lichtermeer, und als wir näher zum Haus treten, sehen wir Hunderte von Kerzen in allen Größen und Farben, auch kleine Engelsfiguren, Blumen, Zeichnungen und Briefe. Warum? So lautet die häufigste Frage der Menschen. Ich spüre Mitgefühl und Unterstützung, und sekundenschnell wird meine Ungläubigkeit zu einer kalten Gewissheit: Es ist wahr, es hat stattgefunden.
Wir möchten bei Carlas Eltern sein, bei Rösly und Georges. Als Mirco und ich wenig später zu ihrem Haus gelangen, sind zwei Fenster schwach erleuchtet, wir klingeln und werden sofort eingelassen. Manuel, Carlas Bruder, mein Freund seit Kindheitstagen, ist wie erwartet ebenfalls anwesend. Wir sehen uns an, schweigend. Die Unfähigkeit, wirklich zu erfassen, was geschehen ist, verbindet uns wie ein unsichtbares Band. Dann beginnt mein Schwiegervater zu erzählen: Dass er und Rösly am Morgen alles für das Weihnachtsessen bei Carla vorbeibringen wollten, sahen, wie es brannte, und er sofort in die oberen Stockwerke gelangen wollte, dass die Rauchentwicklung sich aber als zu stark erwies, er den Rückzug antreten musste und die von der Nachbarin alarmierte Feuerwehr eintraf. Als Georges mich im Geschäft anrief und in gefassten Worten mitteilte, dass unser Zuhause brenne, wusste er bereits, dass das Schreckliche wahr sein könnte.
Wir weinen gemeinsam, sitzen erschöpft zusammen und verabschieden uns gegen 3 Uhr 30. Ich übernachte bei Mirco, finde keinen Schlaf. Bald wird es hell. Sonnenlicht drängt durch den fahlen Winterhimmel, Autos fahren vorbei. Im Treppenhaus wird gelacht. Ich bin durstig, trinke ein Glas Wasser. Es fühlt sich ungeheuerlich an. Es fühlt sich falsch an. Das Leben ohne Carla und die Kinder hat begonnen.
Die folgenden Tage verschwinden in einem Nebel aus Ungläubigkeit und Verzweiflung. Heute verstehe ich Menschen, die von einem gebrochenen Herzen sprechen, einer Metapher für einen seelischen Schock, der einen von der Welt entfernen kann. Die Trauer wird sich als weites Feld erweisen. Dieses eine Wort ist zuständig für unzählige Schattierungen des Schmerzes. Die Trauer verändert meinen Blick auf die Welt und vernichtet die positive Wahrnehmung für lange Zeit, vielleicht für immer. Verschont geblieben zu sein, erscheint mir als härteste Bestrafung. Dass ich Carla und den Kindern im Tod nicht beistehen konnte, erfüllt mich mit Verzweiflung und Bitterkeit. Stirbt ein Mensch durch eine Krankheit, darf man ihn umsorgen und beschützen und weiß im besten Fall, dass er ohne Angst stirbt und ohne Schmerzen. Vielleicht kann man Abschied nehmen, den Prozess auch innerlich vollziehen. Und selbst wenn ein schrecklicher Unfall geschieht, findet man irgendwann vielleicht im Gedanken Trost, dass das Unfassbare nicht gewollt, nicht bewusst herbeigeführt worden ist.
Ich weiß nicht mehr, wann ich erfahren habe, dass den Menschen, die ich liebte, die Kehle durchgeschnitten worden ist. Die Nachricht eines solchen Gewaltexzesses ruft furchtbare Visionen hervor. Sie verfolgen mich, ebenso wie manche Fragen, die von den besten Forensikern und Kriminalisten nicht beantwortet werden können: Was hat die Verzweiflung mit Carla und den Kindern gemacht? Haben sie geweint? Haben sie nach mir gerufen? Es ist, als spürte ich ihre Angst und ihre Schmerzen am eigenen Leib. Ich konnte die Menschen, die ich liebte, nicht beschützen, sie vor diesem Martyrium nicht bewahren. Was bleibt an Hoffnungen übrig? Der Wunsch, dass das Ende überraschend gekommen und alles schnell gegangen ist. Der Zweifel, dass es vielleicht anders war, reißt mich in einen Abgrund.
Am 24. Dezember sitzen meine Schwiegereltern, ihr Sohn Manuel und ich im Wohnzimmer ihres Hauses. Weingläser und ein Teller mit Gebäck stehen vor uns. Es geht uns allen gleich: Wir sind sicher, dass wir bald mit Carla, Dion und Davin Weihnachten feiern werden. Alles war nur ein Albtraum. Nichts von dem, was in den letzten drei Tagen passiert ist, ist wahr. In unserer Fantasie ist bei uns zu Hause bereits alles organisiert für das große Familienfest. Wie jedes Jahr wird in der Mitte des festlich gedeckten Tisches das Fondue chinoise stehen. Die Rindshuft kaufen wir jeweils am Stück und schneiden sie von Hand. Wenn unser Wohnzimmer im Kerzenschein liegt, der Sekt eiskalt ist, feine Gerüche durch das Haus ziehen, treffen die festlich gekleideten Gäste – Familienmitglieder und Carlas Freundinnen Karin und Brigitte – ein, und die »Buben« tragen ihre schönsten Sachen. Zwischen den einzelnen Gängen wird gesungen, gelacht, und die sorgfältig ausgesuchten Geschenke werden verteilt. Seit sich die Erwachsenen dazu entschlossen haben, in einem Losverfahren nur noch je einer einzigen Person ein Geschenk zu machen, folgen der Übergabe jeweils lange Erklärungen, und die ganze Runde verharrt andächtig, bis das Präsent endlich ausgepackt ist.
Obwohl Weihnachten in meiner Kindheit nur bescheiden gefeiert wurde und mich später der damit verbundene Konsumrausch störte, liebe ich unsere Tradition wie auch die folgenden ruhigen Tage, in denen der Alltag zum Erliegen kommt, die langen Spaziergänge, die nachmittäglichen Treffen am Familientisch, die gemütlichen Filmabende. Alles weg. Alles vernichtet. Es ist kein Albtraum, sondern grausame Wirklichkeit: Carla, Dion und Davin werden nicht erscheinen, um mit Rösly, Georges, Manuel und mir zu feiern, nie mehr.
Ich weiß noch nichts über die verschlingende Leere und nichts über die unerfüllbare Sehnsucht. Anstelle der gemeinsamen Zeit, die Carla und ich uns zu Weihnachten schenken wollten, erhalte ich Tage später ihren Fingerring zurück, um den ich auf dem Polizeipräsidium gebeten habe. Er liegt in einer durchsichtigen Plastiktüte. Sein Gegenstück trage ich am Finger. Wir haben die Ringe vor vielen Jahren anlässlich einer gemeinsamen Reise in Berlin gekauft. Ein einfaches Band aus Silber mit einer Gravur. Meine Befürchtung, dass dieses symbolische Schmuckstück beim Brand geschmolzen sein könnte und nicht mehr existiert, hat sich nicht bestätigt. Der Ring hat die schrecklichen Stunden mitgemacht, doch abgesehen von einer Farbveränderung, die wohl durch die Hitze eingetreten ist, ist er unbeschadet. Ich trage ihn in den kommenden Monaten mit mir. Er soll mir Kraft geben in einer Zeit, von der ich noch nicht weiß, um wie viel schrecklicher sie noch werden kann.
Die Gewissheit, dass ich Carla nie mehr sehen werde, macht mich krank. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Panik durchflutet meinen Körper. Ich rede mir gut zu, versuche, mich zu täuschen. Bereits zwei Tage ohne Carla. Habe ich es nicht schon vier Tage, zehn Tage und einmal sogar vierzehn Tage lang ohne sie ausgehalten? Bald kommt sie zurück, bald ist sie wieder da.