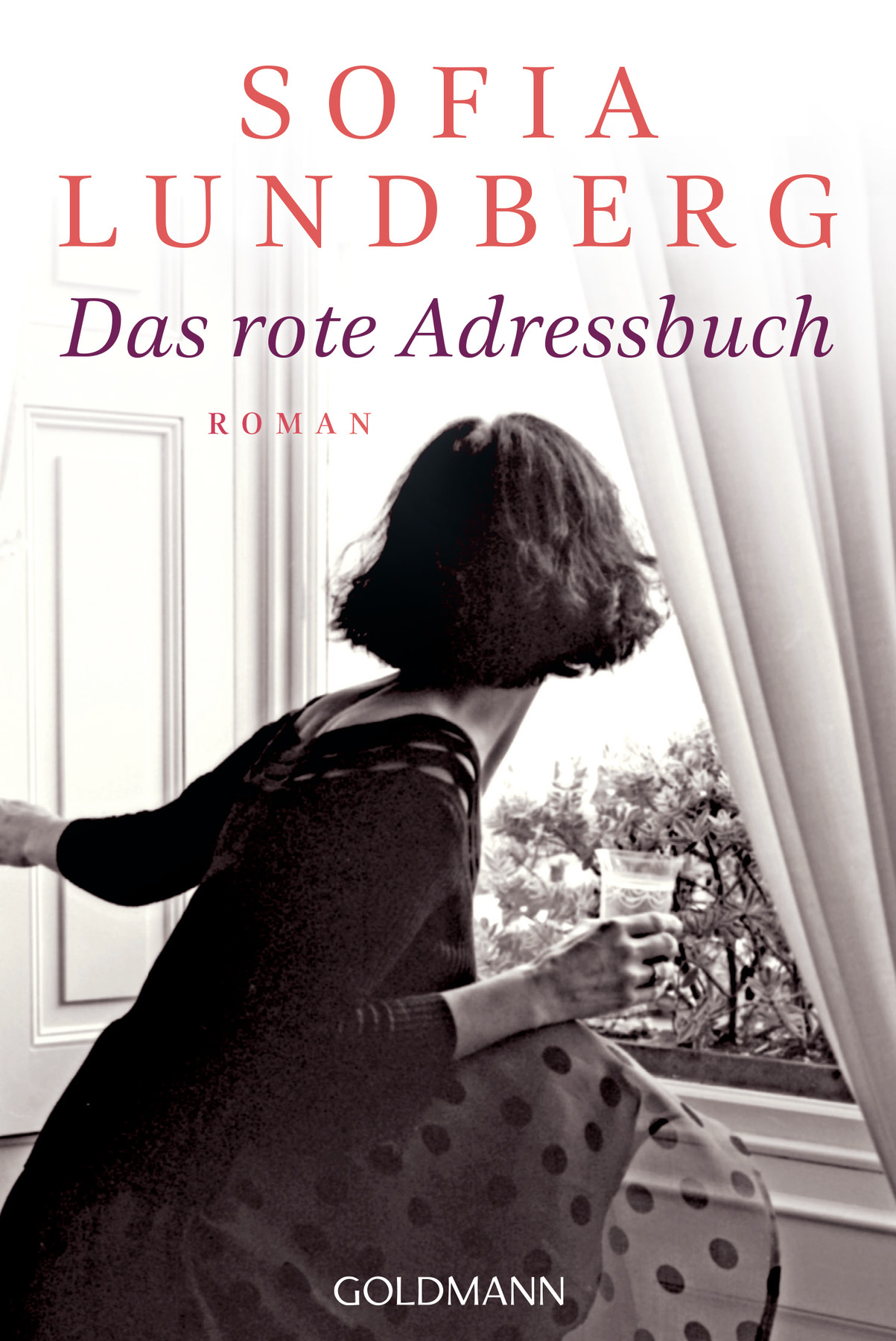
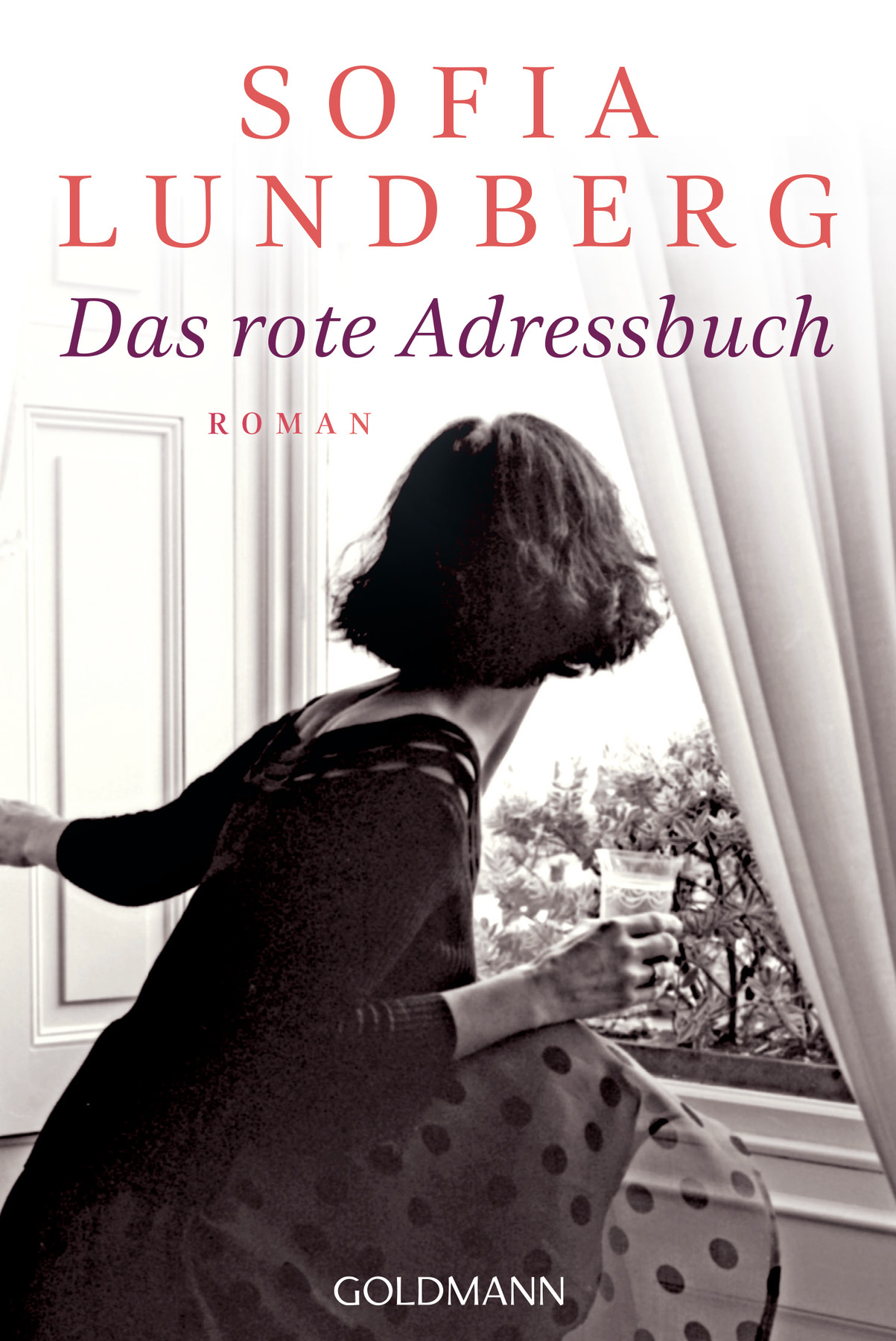
Buch
Doris wächst in einfachen Verhältnissen im Stockholm der 1920er-Jahre auf. Als sie zehn Jahre alt wird, macht ihr Vater ihr ein besonderes Geschenk: ein rotes Adressbuch, in dem sie all die Menschen verewigen soll, die ihr etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das kleine Buch noch immer wie einen Schatz. Und eines Tages beschließt sie, anhand der Einträge ihre Geschichte niederzuschreiben. So reist sie zurück in ihr bewegtes Leben, quer über Ozeane und Kontinente, vom mondänen Paris der Dreißigerjahre nach New York und England – zurück nach Schweden und zu dem Mann, den sie einst verlor, aber nie vergessen konnte.
Autorin
Sofia Lundberg wurde 1974 geboren und arbeitet als Journalistin in Stockholm. Mit ihrem Debütroman »Das rote Adressbuch« eroberte sie die schwedische Literatur- und Bloggerszene im Sturm.
Sofia Lundberg
Das rote Adressbuch
Roman
Aus dem Schwedischen
von Kerstin Schöps






Für Doris, den wunderbarsten Engel
auf dieser Erde. Du hast mir Luft zum Atmen
und Flügel zum Fliegen gegeben.
Und für Oskar,
meinen allerliebsten Schatz.
~ 1 ~
Der Salzstreuer. Die Pillendose. Die Schale mit den Halspastillen. Das Blutdruckmessgerät in seiner ovalen Plastiktasche. Die Lupe mit dem roten, geklöppelten Band von einer alten Weihnachtsgardine, das mit drei Knoten befestigt ist. Das Telefon mit den extragroßen Zifferntasten. Das rote Adressbuch, dessen Leder abgegriffen ist und sich an den Ecken hochbiegt, sodass man die gelben Seiten sehen kann. Sie arrangiert die Sachen sorgfältig in der Mitte des Küchentisches. Gerade und ordentlich sollen sie liegen. Dürfen keine Falten auf der hellblauen, gebügelten Tischdecke bilden.
Danach verbringt sie eine Weile in tiefer Stille und sieht aus dem Fenster auf die Straße, die im regnerischen Grau versinkt. Sie sieht die Menschen vorbeihetzen, mit und ohne Regenschirm. Die kahlen Bäume. Den Matsch auf dem Asphalt und das Wasser, das sich seinen Weg sucht.
Ein Eichhörnchen springt auf einen der Äste, und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie lehnt sich vor und folgt den Bewegungen des kleinen Geschöpfs. Der buschige Schwanz wippt von einer Seite zur anderen, wenn das Tier von Ast zu Ast springt. Dann klettert es den Baum hinunter, springt auf die Straße und verschwindet. Auf zu neuen Abenteuern.
Es ist bestimmt bald Zeit für das Mittagessen, denkt sie und streicht sich über den Bauch. Mit zitternder Hand nimmt sie die Lupe und hält sie über ihre goldene Armbanduhr. Aber die Ziffern sind trotzdem viel zu klein, und sie gibt es gleich wieder auf. Sie faltet ihre Hände im Schoß und schließt die Augen. Wartet auf das so wohlbekannte Geräusch an der Eingangstür.
»Doris, schlafen Sie etwa?«
Eine viel zu laute Stimme reißt sie aus dem Schlaf. Sie spürt eine Hand auf ihrer Schulter und lächelt die junge Pflegerin schlaftrunken an, die sich über sie beugt.
»Ich muss eingenickt sein.« Die Worte bleiben im Hals stecken, und sie räuspert sich.
»Hier, trinken Sie mal einen Schluck.« Die Pflegerin reicht ihr ein Glas Wasser, und Doris nimmt ein paar Schlucke.
»Vielen Dank … Verzeihen Sie, aber wie heißen Sie noch mal? Ich habe es vergessen.« Schon wieder eine Neue. Die vorherige hatte aufgehört, weil sie weiterstudieren wollte.
»Aber Doris, ich bin es doch, Ulrika. Wie geht es Ihnen denn heute?«, fragt sie. Bleibt aber nicht bei ihr stehen, um auf eine Antwort zu warten.
Es kommt auch keine.
Doris beobachtet Ulrika, die in der Küche herumwirbelt. Sieht, wie sie die Pfeffermühle herausholt und den Salzstreuer zurück in die Speisekammer stellt. Danach ist das Tischtuch voller Wellen und Falten.
»Kein Salz, habe ich Ihnen doch gesagt.« Ulrika steht mit der Essensbox vor ihr und sieht sie streng an. Doris nickt und seufzt, während Ulrika den Plastikdeckel von der Box reißt und den Inhalt auf einen braunen Teller kippt. Soße, Kartoffeln, Fisch und Erbsen. Alles auf einem Haufen. Sie stellt den Teller in die Mikrowelle und die Uhr auf zwei Minuten. Die Maschine beginnt ihre Arbeit mit einem dumpfen Brummen, und in der Wohnung breitet sich der Geruch von gekochtem Fisch aus. In der Zwischenzeit räumt Ulrika auf: Sie stapelt die Zeitungen und die Post zu einem unordentlichen Haufen, leert die Spülmaschine.
»Ist es kalt draußen?« Doris sieht aus dem Fenster. Düster und feucht ist es dahinter. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal vor der Tür gewesen ist. Im Sommer war es. Oder im Frühling?
»Oh ja, der Winter kommt. Die Regentropfen fühlen sich an wie kleine Eiswürfel. Ich bin froh, dass ich mit dem Auto unterwegs bin und nicht laufen muss. Ich habe sogar einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden. Was die Parkplätze angeht, ist es bei uns in den Vororten wirklich einfacher. Hier in der Stadt ist es doch aussichtslos, aber manchmal hat man auch Glück.« Die Worte purzeln ohne Pause aus ihr heraus.
Dann fängt Ulrika an zu summen. Einen Popsong. Doris hat ihn schon einmal im Radio gehört. Ulrika wirbelt weiter durch die Zimmer. Staubsaugt im Schlafzimmer. Doris hört sie poltern und hofft, dass sie nicht die Vase umwirft. Die handbemalte, die ihr so viel bedeutet.
Als Ulrika zurück in die Küche kommt, hat sie ein Kleid über dem Arm. Es ist das bordeauxrote aus Wolle, das mit den ausgestellten Ärmeln und einem Faden, der vom Saum herunterhängt. Doris hat versucht, ihn abzureißen, als sie das Kleid das letzte Mal anhatte, aber die Schmerzen im Rücken hatten es ihr unmöglich gemacht, sich so weit vorzubeugen. Sie streckt ihre Hand aus, um den Faden zu packen, aber die bleibt unverrichteter Dinge in der Luft hängen, weil sich Ulrika abrupt umdreht und das Kleid über eine Stuhllehne legt. Dann löst sie den Knoten von Doris’ Morgenmantel und beginnt, ihn ihr vorsichtig auszuziehen. Doris wimmert, die Rückenschmerzen strahlen bis in die Arme. Der Schmerz ist immer da, tagsüber und nachts. Er erinnert sie an ihren vergänglichen und verfallenden Körper.
»So, jetzt stehen wir mal auf. Ich hebe Sie auf drei, okay?« Ulrika hält sie mit einem Arm fest, zieht sie hoch und streift ihr den Morgenmantel von den Schultern. Doris bleibt stehen. Im kalten Tageslicht der Küche und nur in Unterwäsche. Die muss auch gewechselt werden. Doris bedeckt sich, als ihr BH geöffnet wird und seine Aufgabe verliert. Ihre Brüste senken sich Richtung Bauch.
»Oh, Sie Arme, Sie frieren ja. Kommen Sie, wir gehen schnell ins Badezimmer.«
Ulrika nimmt Doris an der Hand, und sie folgt ihr mit unsicheren Schritten. Sie spürt, wie ihre Brüste gegen den Körper wippen, hält sie mit der freien Hand fest. Im Badezimmer ist es viel wärmer, unter den Fliesen winden sich die Schlingen der Fußbodenheizung. Sie schüttelt sich die Hausschuhe von den Füßen und genießt die Wärme.
»So, jetzt ziehen wir uns mal an. Hoch mit den Armen.«
Doris gehorcht, aber sie bekommt die Arme nur bis zur Brust. Ulrika kämpft mit dem Kleidungsstück und zieht es ihr schließlich über den Kopf. Sie lächelt, als Doris wieder zum Vorschein kommt.
»So eine tolle Farbe. Die steht Ihnen so gut. Wollen Sie heute ein bisschen Lippenstift dazu tragen? Und vielleicht ein bisschen Rouge auf den Wangen?«
Die Schminksachen stehen auf einem kleinen Tisch neben dem Waschbecken. Ulrika hat den Lippenstift schon aufgedreht, aber Doris schüttelt den Kopf.
»Ist das Essen schon fertig?«, fragt sie.
»Das Essen! Oh je! Was bin ich bloß für ein Dummerchen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss es noch mal aufwärmen.«
Ulrika springt zur Mikrowelle, öffnet die Tür, drückt sie wieder zu und stellt eine Minute ein. Dann gießt sie etwas Preiselbeersaft in ein Glas und stellt den Teller auf den Tisch. Doris rümpft die Nase, als sie den Essensbrei sieht, aber sie hat Hunger.
Ulrika setzt sich mit einem Becher Kaffee in der Hand zu ihr. Es ist der handbemalte, mit den rosa Rosen. Den Doris nie benutzt, aus Angst, dass er kaputtgehen könnte.
»Ach, Kaffee ist das schwarze Gold, stimmt doch, oder?« Ulrika lacht.
Doris nickt, lässt den Becher aber nicht aus den Augen.
Bitte nicht fallen lassen.
»Sind Sie satt?«, fragt Ulrika, nachdem sie eine Weile schweigend beisammengesessen haben. Doris nickt, und Ulrika räumt den Teller ab. Sie kommt mit einem zweiten Becher Kaffee zurück. Dem dunkelblauen aus Höganäs.
»Bitte schön. Jetzt verschnaufen wir ein bisschen, ja?«
Ulrika lächelt und setzt sich wieder. »Was für ein Wetter. Regen, Regen und noch mal Regen. Das hört wohl nie auf.«
Doris will etwas erwidern, als Ulrika unbekümmert fortfährt: »Ich überlege gerade, ob ich dem Jungen ein Paar Ersatzstrümpfe für den Kindergarten eingepackt habe. Die werden heute doch total durchweicht sein, die Kleinen. Na ja, wahrscheinlich haben die da auch Ersatzsocken. Sonst muss ich halt ein barfüßiges, schlecht gelauntes Kind mit nach Hause nehmen. Immer macht man sich Sorgen um die Kleinen. Ich nehme an, Sie wissen, wie das ist. Wie viele Kinder haben Sie?«
Doris schüttelt den Kopf.
»Oh Gott, keine Kinder? Sie Arme, dann bekommen Sie ja nie Besuch? Waren Sie denn nie verheiratet?«
Die Gedankenlosigkeit der Pflegerin überrascht sie. Normalerweise stellten die nicht solche Fragen, nicht so direkte zumindest.
»Aber Freunde haben Sie doch? Die Sie ab und zu besuchen kommen? Das sieht doch ziemlich dick aus!«, sie zeigt auf das Adressbuch, das auf dem Tisch liegt.
Doris antwortet nicht. Sie wirft einen heimlichen Blick in die Richtung des Fotos von Jenny, das draußen im Flur hängt. Ulrika ist es bisher noch gar nicht aufgefallen. Jenny, die so weit weg ist und doch immer ganz nah, in ihren Gedanken.
»Oh je, wie die Zeit vergeht«, plappert Ulrika weiter. »Ich muss los. Wir unterhalten uns das nächste Mal darüber, einverstanden?«
Ulrika räumt die Kaffeebecher in die Spülmaschine, auch den handbemalten. Dann wischt sie ein paarmal mit dem Lappen über den Tisch und die Arbeitsfläche, schaltet die Spülmaschine ein, und ehe sichs Doris versieht, ist sie verschwunden. Durchs Fenster sieht Doris, wie Ulrika den Jackenkragen hochschlägt und in ein kleines rotes Auto steigt, das auf der Seite das Logo der Kommune aufgeklebt hat. Ganz langsam steht Doris auf, geht mit winzig kleinen Schritten zur Spülmaschine und unterbricht das Programm. Sie nimmt den handbemalten Becher aus der Maschine, spült ihn sorgfältig mit der Hand ab und versteckt ihn dann ganz hinten im Schrank, hinter den tiefen Dessertschalen. Sie überprüft es aus mehreren Blickwinkeln. Der Becher ist von vorne nicht mehr zu sehen. Zufrieden setzt sie sich wieder an den Küchentisch und streicht die Tischdecke glatt. Arrangiert die Dinge darauf neu. Das Medikamentendöschen, die Halstabletten, die Plastiktasche, die Lupe und das Telefon werden wieder an ihren richtigen Platz gesetzt. Als Letztes will sie das Adressbuch zurücklegen. Sie lässt ihre Hand einen Moment darauf liegen. Es wurde schon lange nicht mehr aufgeschlagen. Sie klappt den Deckel auf und sieht die Namen auf der ersten Seite. Sie sind alle durchgestrichen. In großen Buchstaben hat sie ein Wort danebengeschrieben. Immer nur ein Wort. TOT.
Das rote Adressbuch
A. ALM, ERIC
So viele Namen, die einem im Laufe eines Lebens begegnen. Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht, Jenny? Die vielen Namen, die kommen und gehen. Die dir das Herz zerreißen und dich zu Tränen rühren. Die zu Geliebten oder zu Feinden werden. Manchmal blättere ich in meinem Adressbuch. Es ist die Landkarte meines Lebens. Ich werde dir ein bisschen davon erzählen. Denn du bist die Einzige, die sich an mich erinnern wird, wenn ich gehe. Und darum bist du auch die Einzige, die sich an mein Leben erinnern wird. Das ist eine Art Testament. Ich vermache dir meine Erinnerungen. Das ist das Wertvollste, was ich besitze.
Es war 1928. An meinem zehnten Geburtstag. Als mir das Geschenk überreicht wurde, wusste ich schon, dass sich in der Verpackung etwas ganz Besonderes befand. Das konnte ich an dem Funkeln im Blick meines Vaters sehen. In seinen dunklen Augen, die sonst immer verrieten, dass er mit den Gedanken woanders war. Sie warteten auf meine Reaktion. Das Geschenk war in feines, dünnes Seidenpapier gewickelt. Ich strich mit der Fingerspitze darüber. Die zarte Oberfläche, die aus einem Wirrwarr aus Mustern bestand. Und dann das Band, ein dickes rotes Seidenband. Es war das schönste Päckchen, das ich jemals bekommen hatte.
»Aufmachen, aufmachen!« Meine kleine Schwester Agnes hatte sich weit über den Esstisch gelehnt und die Ellenbogen aufgestellt, woraufhin sie sofort von meiner Mutter ermahnt wurde.
»Ja, komm, mach es auf!« Auch mein Vater klang ungeduldig.
Ich strich mit dem Daumen über das rote Seidenband, bevor ich vorsichtig an beiden Enden zog und die Schleife löste. Das Geschenk war ein Adressbuch, das in rotes Glattleder gebunden war und beißend nach Färbemittel roch.
»Darin kannst du alle deine Freunde eintragen«, sagte mein Vater und lächelte. »Alle Menschen, denen du im Laufe deines Lebens begegnest. Aus all den spannenden Städten und Ländern, die du bereisen wirst. Damit du sie nicht vergisst.«
Er nahm mir das Adressbuch aus der Hand und schlug die erste Seite auf. Unter A hatte er seinen Namen eingetragen. Eric Alm. Und darunter die Adresse und Telefonnummer seiner Werkstatt. Die Nummer war ganz neu, worauf er besonders stolz war. Denn zu Hause hatten wir noch kein Telefon.
Er war ein großer Mann, mein Vater. Nicht physisch. Das gar nicht. Aber seine Gedanken waren groß, zu groß für das Leben, das er führte. Sie waren in der großen weiten Welt unterwegs, auf dem Weg zu unbekannten Orten. Ich hatte oft den Eindruck, dass er eigentlich gar nicht bei uns zu Hause sein wollte. Er fühlte sich nicht wohl in diesem beengten Leben, ihn störte der Alltag. Er hatte einen unstillbaren Wissensdurst, und er füllte unser Haus mit Büchern. In meiner Erinnerung hat er nie viel geredet. Auch mit meiner Mutter nicht. Er vergrub sich meistens hinter seinen Büchern. Manchmal kletterte ich auf seinen Schoß, wenn er in seinem Lesesessel saß. Er ließ mich immer gewähren, schob mich aber beiseite, wenn ich ihm den Blick auf das Buch und die Bilder versperrte, mit denen er sich gerade beschäftigte. Ihn umhüllte immer der süßliche Geruch von Holz, sein Haar war oft bedeckt mit einer feinen Schicht von Sägemehl, was es ganz grau aussehen ließ. Seine Hände waren grob und voller Risse. Jeden Abend cremte er sie mit Vaseline ein und schlief mit dünnen Baumwollhandschuhen.
Meine Hände. Die lagen in einer vorsichtigen Umarmung um seinen Nacken. So saßen wir in unserer eigenen Welt. Ich begleitete ihn auf seinen Reisen, die er in Gedanken machte, mit jeder neuen Seite, die er umblätterte. Er studierte fremde Länder und Kulturen, steckte kleine Nadeln in eine große Weltkarte, die er an die Wand gehängt hatte. Als hätte er diese Orte tatsächlich bereist. Eines Tages, sagte er immer, eines Tages würde er in die weite Welt fahren. Und dann klebte er Ziffern an die Nadeln. Einser, Zweier, Dreier. Nach Vorliebe gestaffelt. Vielleicht wäre er als Forschungsreisender besser durchs Leben gekommen?
Wenn da nicht die Werkstatt meines Großvaters gewesen wäre. Das Erbe, das er angetreten hatte und verwalten musste. Eine Pflicht, die es zu erfüllen galt. Auch nachdem sein Vater gestorben war, ging er jeden Morgen, zuverlässig und treu, in die dunkle Werkstatt und arbeitete Seite an Seite mit seinem Lehrling. Bis unter die Decke waren die Holzbretter an den Wänden gestapelt, und immer lag der beißende Geruch von Terpentin und Waschbenzin in der Luft. Wir Kinder durften meist nur in der Tür stehen und ihnen zusehen. Die dunkelbraune Holzfassade der Werkstatt war mit Kletterrosen bewachsen, weißen Buschrosen. Wenn sie ihre Blütenblätter verloren, sammelten wir sie ein und legten sie in Schalen mit Wasser: Wir produzierten unser eigenes Parfum, das wir uns mit den Fingern an den Hals tupften.
Ich erinnere mich an Stapel aus unfertigen Stühlen und Tischen; Holzspäne und Sägemehl; das Werkzeug an den Haken an den Wänden: Stemmeisen, Stichsägen, Schnitzmesser, Hammer. Alles hatte seinen angestammten Platz. Von seinem Stuhl hinter der Tischlerbank hatte mein Vater alles im Blick. Dort saß er, mit einer Schürze aus braunem, rissigem Leder und einem Stift, den er sich hinters Ohr geklemmt hatte. Er arbeitete immer, bis es dunkel wurde. Sommer wie Winter. Dann kam er nach Hause. Zurück in seinen Lesesessel.
Seine Seele ist noch da, in mir. In seinem Stuhl, der unter dem Berg von Zeitungen verborgen ist und dessen Sitzfläche meine Mutter gewebt hat. Sein größter Traum war es, die Welt zu sehen, sie zu bereisen. Am Ende hat er nur einen bleibenden Eindruck in seinen vier Wänden hinterlassen. Mit den Ergebnissen seines Handwerks: der Schaukelstuhl mit den zarten Verzierungen, den er für meine Mutter geschnitzt hatte. Die Holzornamente hatte er alle mit der Hand ausgesägt. Die Bücherregale, in denen noch heute Bücher von ihm stehen. Mein Vater.
~ 2 ~
Die geringsten Bewegungen erfordern eine große Anstrengung, mental und physisch. Sie schiebt die Füße ein paar Millimeter vor, dann macht sie eine Pause. Dann legt sie die Hände auf die Armlehnen. Eine nach der anderen. Pause. Sie drückt die Füße in den Boden. Greift mit der einen Hand um die Armlehne, die andere legt sie auf den Esstisch. Dann beginnt sie vor und zurück zu schaukeln, um Schwung zu holen. Ihr Stuhl hat eine hohe weiche Rückenlehne und Untersetzer aus Plastik unter den Stuhlbeinen, die den Stuhl erhöhen. Trotzdem dauert es eine ganze Weile, bis sie es schafft, sich hochzudrücken. Erst beim dritten Anlauf gelingt es ihr. Mit beiden Händen auf dem Tisch bleibt sie stehen und wartet, bis der Schwindel sich wieder legt.
Das ist ihre tägliche Übung. Ein kleiner Spaziergang durch die zwei Zimmer ihrer Wohnung. Von der Küche in den Flur, eine Runde um das Sofa im Wohnzimmer, um die verwelkten Blätter von der roten Begonie im Fenster abzupflücken. Dann geht es weiter ins Schlafzimmer, zu ihrem Schreibtisch. Mit dem Laptop, der so wichtig geworden ist. Vorsichtig setzt sie sich auf den Stuhl, auch er hat Untersetzer unter den Beinen. Dadurch ist er aber so hoch geworden, dass ihre Oberschenkel kaum noch unter die Tischplatte passen. Sie klappt den Laptop auf. Die Festplatte brummt sanft, als sie zum Leben erweckt wird. Sie klickt das Explorer-Icon an und ist sofort auf ihrer Wunschstartseite, von Dagens Nyheter. Jeden Tag wundert sie sich aufs Neue, dass die ganze große Welt in diesem kleinen Rechner Platz hat. Dass sie, eine alte einsame Frau in Stockholm, mit jedem Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten könnte. Wenn sie wollte. Diese Technik füllt ihre Tage mit Inhalt. Und macht das Warten auf den Tod erträglicher. Jeden Nachmittag sitzt sie davor, manchmal auch schon früh am Morgen und spät am Abend, wenn der Schlaf nicht kommen will. Die Pflegerin Maria hat ihr beigebracht, wie das alles funktioniert. Skype, Facebook, Mail. Sie hatte immer gesagt, dass niemand zu alt sei, um etwas Neues zu lernen. Doris hatte ihr recht gegeben und hinzugefügt, dass niemand zu alt sei, um sich seinen Traum zu verwirklichen. Kurz darauf hatte Maria ihren Job gekündigt und wieder angefangen zu studieren.
Ulrika hat sich dafür noch nie interessiert. Sie hat weder den Laptop im Schlafzimmer kommentiert noch gefragt, was Doris damit macht. Sie wischt nur den Staub weg, wenn sie durch die Zimmer jagt und ihre To-do-Liste im Kopf abhakt. Vielleicht ist sie ja sogar auf Facebook. Die meisten sind da. Doris ist auch auf Facebook, Maria hat ihr einen Account eingerichtet. Sie hat drei Freunde. Maria ist eine davon. Und dann ist da noch ihre Nichte Jenny aus San Francisco und deren Sohn Jack. Ab und zu verfolgt sie, was in ihrem Leben so passiert, sieht Fotos und Filme aus einer anderen Welt. Manchmal sogar die Einträge von deren Freunden, wenn die ein öffentliches Profil haben.
Ihre Finger funktionieren nämlich noch einwandfrei. Sie sind langsamer als früher und tun zwischendurch weh, dann muss sie eine Pause einlegen. Sie schreibt, um ihre Erinnerungen zusammenzutragen. Um sich einen Überblick über ihr Leben zu verschaffen. Doris wünscht sich, dass Jenny diese Aufzeichnungen finden wird, wenn sie gestorben ist. Dass sie die Geschichten lesen und die Fotos ansehen wird und sich darüber freut. Dass sie die schönen Gegenstände erbt: die Möbel, die Gemälde, den handbemalten Becher. Denn sie werden hoffentlich nicht gleich alle in einen Container entsorgt? Bei dem Gedanken bekommt sie Gänsehaut, legt die Finger auf die Tastatur und schreibt, um sich abzulenken.
Die dunkelbraune Holzfassade der Werkstatt war mit Kletterrosen bewachsen, weißen Buschrosen, schreibt sie heute. Einen Satz. Danach herrscht Stille, und sie reist durch ein Meer aus Erinnerungen.
Das rote Adressbuch
A. ALM, ERIC TOT
Hast du jemals einen abgrundtiefen Schrei gehört, Jenny? Einen Schrei aus reinster Verzweiflung? Einen Schrei, der direkt aus dem Herzen kommt und sich in jede menschliche Zelle bohrt, niemanden unberührt lässt? Ich habe in meinem Leben viele gehört, aber sie alle erinnern mich nur an den ersten, den schrecklichsten von allen.
Er kam aus dem Innenhof. Dort stand er. Mein Vater. Sein Schrei hallte von den Steinwänden wider. Das Blut schoss aus seiner Hand und färbte den Frost auf dem Rasen dunkelrot. Ein Bohrer steckte in seinem Handgelenk. Dann verstummte der Schrei, und er sank zu Boden. Wir alle rannten zu ihm, die Treppen hinunter und über den Hof. Meine Mutter wickelte ihre Schürze um seine Hand und hielt seinen Arm hoch. Ihr Schrei war so laut wie seiner, als sie um Hilfe rief. Das Gesicht meines Vaters war erschreckend weiß, die Lippen blau. An alles, was danach geschah, erinnere ich mich nur noch verschwommen. Die Männer, die ihn vom Hof trugen. Das Auto, das ihn abholte. Die eine vertrocknete weiße Rose an der Wand der Werkstatt und der Frost, der sie und alles andere bedeckte. Nachdem alle verschwunden waren, blieb ich auf dem Boden im Hof sitzen und starrte die Rose an. Sie war eine Überlebende. Ich flehte Gott an, dass auch mein Vater so stark sein würde.
Es folgten Wochen des bangen Wartens. Jeden Tag sahen wir, wie unsere Mutter nach dem Mittag die Reste einpackte und sich auf den Weg ins Krankenhaus machte. Brei, Brot und Milch. Oft kam sie mit dem unberührten Esspaket zurück.
Eines Tages kam sie nach Hause und hatte die Kleidung meines Vaters über dem Korb hängen, in dem sie die Lebensmittel transportiert hatte. Ihre Augen waren verquollen und rot. So rot wie das vergiftete Blut meines Vaters.
Danach wurde alles anders. Das Leben war vorbei. Nicht nur das meines Vaters. Der abgrundtiefe Schrei an diesem frostigen Novembermorgen hatte auf brutale Weise meine Kindheit beendet.
Das rote Adressbuch
S. SERAFIN, DOMINIQUE
Die nächtlichen Tränen waren nicht meine, aber sie gingen mir so nahe, dass ich manchmal nachts davon wach wurde und dachte, ich hätte im Schlaf geweint. Meine Mutter saß immer im Schaukelstuhl in der Küche, wenn wir ins Bett gegangen waren. Ich gewöhnte mich daran, in Begleitung ihrer Schluchzer einzuschlafen. Sie nähte und weinte; die Geräusche ihrer Trauer übertrugen sich in Wellen in unser Zimmer. Sie dachte, dass wir schlafen. Aber das taten wir nicht. Ich konnte hören, wie sie die Nase hochzog. Ich spürte ihre Verzweiflung darüber, plötzlich allein zu sein, nicht mehr geborgen zu sein im Schatten meines Vaters.
Ich vermisste ihn auch furchtbar. Nie wieder würde er versunken in ein Buch in seinem Lesesessel sitzen. Nie wieder würde ich auf seinen Schoß klettern können und ihn auf seiner Reise durch die Welt begleiten dürfen. Ich vermisste auch seine Nähe, denn in meiner Kindheit wurde ich nur von ihm umarmt.
Es waren schwere Monate. Der Brei, den wir morgens und mittags aßen, wurde immer dünner. Die Beeren, die wir im Wald gepflückt und getrocknet hatten, waren aufgebraucht. Einmal schoss meine Mutter eine Taube mit dem Gewehr meines Vaters und machte daraus einen Eintopf. Und zum ersten Mal seit dem Tod meines Vaters wurden wir alle satt, zum ersten Mal hatten wir rote Wangen und lachten zusammen. Aber das Lachen sollte schon bald für lange Zeit verstummen.
»Du bist die Älteste, du musst jetzt alleine zurechtkommen«, sagte meine Mutter und drückte mir einen Zettel in die Hand. Ich sah, wie sich ihre grünen Augen mit Tränen füllten, bevor sie sich umdrehte und wie besessen die Teller abwusch, von denen wir gerade gegessen hatten. Dieser Moment in der Küche hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. Alles ist erhalten, wie in einem Museum. Ich erinnere mich an jedes Detail. Der blaue Rock, an dem sie gerade arbeitete, der auf einem Hocker lag. Der getrocknete Schaum am Topf mit den Kartoffeln, der beim Kochen übergelaufen war. Die eine Kerze, die dem Raum Licht spendete und dunkle Schatten erzeugte. Die Bewegungen meiner Mutter, die zwischen der Spüle und dem Esstisch hin und her lief. Ihr Kleid, das ihre Beine umspielte.
»Was meinst du damit?«, stieß ich hervor.
Sie unterbrach für einen Moment ihr geschäftiges Treiben, sah mir aber nicht in die Augen.
»Wirfst du mich raus?«
Wieder keine Antwort.
»Jetzt sag doch endlich was! Setzt du mich vor die Tür?«
Sie stand an der Spüle, den Blick gesenkt. »Du bist jetzt groß, Doris. Und das ist eine gute Arbeit, die ich dir besorgt habe. Auf dem Zettel steht die Adresse, du siehst, das ist auch gar nicht weit weg von uns. Wir werden uns sehen können.«
»Und was ist mit der Schule?«
Mama hob den Kopf und starrte ins Leere.
»Vater hätte das niemals zugelassen, dass du mich aus der Schule nimmst. Jetzt noch nicht! Ich bin noch nicht so weit!«, schrie ich.
Agnes rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her.
Ich ließ mich auf einen Stuhl fallen und brach in Tränen aus. Meine Mutter setzte sich neben mich und legte mir eine Hand auf die Stirn. Sie war kühl und feucht vom Spülwasser.
»Bitte, nicht weinen, mein Herz«, flüsterte sie und lehnte ihren Kopf an meinen. Es war so still im Raum, dass ich fast hören konnte, wie ihr die dicken Tränen über die Wangen liefen und sich mit meinen vermischten. »Du kannst immer an deinem freien Tag nach Hause kommen. Jeden Sonntag.«
Der geflüsterte Trost wurde zu einem Murmeln, das mich in ihren Armen in den Schlaf wiegte.
Aber am nächsten Morgen wachte ich auf und sah der brutalen und unleugbaren Wahrheit ins Gesicht, dass ich gezwungen war, die Geborgenheit meines Zuhauses für eine ungewisse Zukunft zu verlassen. Ohne Protest nahm ich die Tasche mit meinen Sachen, die mir meine Mutter gab. Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen, als wir uns verabschiedeten. Ich umarmte meine kleine Schwester und ging. Ohne ein Wort. In der einen Hand trug ich die Tasche, in der anderen drei Bücher meines Vaters, die ich mit einer dicken Schnur zusammengebunden hatte. Auf dem Zettel in meiner Jackentasche stand ein Name, den meine Mutter mit zierlichen Buchstaben aufgeschrieben hatte: Dominique Serafin. Darunter standen ein paar Instruktionen: Mach einen ordentlichen Knicks. Sprich deutlich. Ich ging durch die Straßen von Södermalm auf mein neues Zuhause zu: Bastugatan 5.
Als ich die Adresse erreicht hatte, blieb ich eine Weile vor dem modernen Gebäude stehen. Die großen schönen Fenster waren von roten Holzrahmen eingefasst. Die Fassade war aus Stein, und ein schönes Kopfsteinpflaster führte in den Innenhof. Kein Vergleich zu dem einfachen Holzhaus, das bis dahin mein Zuhause gewesen war. Da kam eine Frau aus der Eingangstür. Sie trug glänzende Lederschuhe und ein weißes Kleid, ohne Taille. Auf ihrem Kopf saß ein beiger Glockenhut, den sie sich tief ins Gesicht gezogen hatte, und am Arm baumelte eine kleine Ledertasche in der gleichen Farbe. Ich strich beschämt über mein schlichtes, knielanges Wollkleid und war gespannt, wer mir die Tür öffnen würde. War Dominique ein Mann oder eine Frau? Ich wusste es nicht, diesen Namen hatte ich noch nie gehört.
Langsam ging ich die Marmortreppe in den zweiten Stock hoch, blieb auf jeder Stufe stehen. Die Flügeltür aus dunklem Eichenholz war größer als alle Türen, die ich je gesehen hatte. Der Türklopfer war ein großer Löwenkopf. Es hallte dumpf durch das Treppenhaus, und ich starrte dem Löwen ängstlich in die Augen. Eine Frau öffnete die Tür und nickte mir zu, sie war ganz in Schwarz gekleidet und trug eine weiße Schürze. Ich faltete meinen Zettel auf und wollte ihn ihr zeigen, als dahinter eine zweite Frau erschien. Die Schwarzgekleidete wich zur Seite und stellte sich mit geradem Rücken an die Wand.
Die andere Frau hatte rotbraunes Haar, das in zwei langen Zöpfen geflochten zu einem dicken Knoten im Nacken gewickelt war. Um ihren Hals hingen mehrere Reihen aus weißen, ungleich großen Perlen. Ihr Kleid war aus glänzender grüner Seide, reichte ihr bis zur Wade und hatte einen plissierten Rock, der raschelte, wenn sie sich bewegte. Sie war wohlhabend, das sah ich sofort. Sie musterte mich von oben bis unten, nahm dann einen Zug von ihrer Zigarette, die in einem langen schwarzen Mundstück steckte, und blies den Rauch zur Decke.
»Sieh mal einer an«, ihr französischer Akzent war deutlich zu hören, ihre Stimme ganz heiser vom Rauchen, »so ein hübsches Mädchen. Du darfst bleiben. Na komm, komm rein jetzt.«
Mit diesen Worten drehte sie sich um und verschwand in der Wohnung. Ich blieb auf der Fußmatte im Treppenhaus stehen und klammerte mich an meine Tasche. Die Schwarzgekleidete gab mir mit einem Nicken zu verstehen, dass ich ihr folgen sollte. Wir liefen durch die Küche zu der dahinterliegenden Dienstmädchenkammer, die ich mit zwei anderen teilen würde. Ich legte meine Tasche auf mein Bett. Ohne eine Aufforderung nahm ich das Kleid, das dort lag, und zog es mir an. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich das jüngste der Dienstmädchen war und ich darum mit allen Aufgaben betraut werden würde, die keine der beiden anderen ausführen wollte.
Danach setzte ich mich auf mein Bett und wartete. Die Füße hatte ich dicht nebeneinander gestellt, die Hände gefaltet in den Schoß gelegt. Ich erinnere mich gut an die Einsamkeit, die mich in der kleinen Kammer überkam, weil ich nicht wusste, wo ich war und was mich erwartete. Die Wände waren kahl, die Tapete vergilbt. Neben jedem der drei Betten stand ein kleiner Nachttisch mit einem Kerzenständer. Zwei der Kerzen waren schon fast heruntergebrannt, meine noch ganz neu, mit gewachstem Docht.
Es dauerte nicht lange, da hörte ich Schritte auf den Dielen und das Rascheln ihres Rockes. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Sie blieb in der Tür stehen, aber ich wagte nicht, den Blick zu heben.
»Stell dich hin, wenn ich komme. Na, los. Gerader Rücken.«
Ich sprang auf, und sie griff sofort in meine Haare. Ihre kalten, schmalen Finger glitten über meine Kopfhaut, sie untersuchte jeden Millimeter meiner Haut.
»Sauber und fein. Sehr gut. Du hast doch keine Läuse, Mädchen?«
Ich schüttelte den Kopf. Sie setzte ihre Untersuchung fort, hob eine Haarsträhne nach der anderen hoch und zog an meinen Ohren. Sie kratzte mit ihren langen Fingernägeln über meine Haut.
»Hier sitzen sie am liebsten, hier hinter den Ohren. Ich hasse diese Viecher«, murmelte sie, und ein kleiner Schauer lief durch ihren Körper. In dem Sonnenstrahl, der durchs Fenster fiel, konnte ich den zarten Flaum auf ihren Wangen sehen, der sich aufstellte und der Schicht aus hellem Puder trotzte.
Die Wohnung war groß und voller Kunstgegenstände, Skulpturen und wunderschönen Möbeln aus dunklem Holz. Es roch nach Rauch und nach etwas anderem, das ich nicht zuordnen konnte. Tagsüber war es immer ruhig und still. Sie war eine der Glücklichen, die niemals arbeiten musste und trotzdem vermögend war. Woher sie das Geld hatte, wusste ich nicht. Manchmal stellte ich mir vor, dass sie ihren Mann irgendwo in einem Verschlag auf dem Dachboden eingesperrt hatte.
Abends hatte sie sehr oft Gäste. Frauen in wunderschönen Kleidern und mit Diamanten behangen. Die Männer trugen Anzug und Hut. Sie behielten ihre Schuhe an und liefen damit unbekümmert durch den Salon, als wäre es ein Restaurant. Die Luft war verraucht, und es wurde sich auf Englisch, Französisch und Schwedisch unterhalten.
In diesen Nächten kam ich mit Gedanken und Themen in Berührung, mit denen ich mich noch nie zuvor beschäftigt hatte. Gleicher Lohn für Männer und Frauen, gleiches Recht auf Bildung. Philosophie, Kunst und Literatur. Und auch das Verhalten der Gäste war anders, als ich es gewohnt war. Lautes Lachen, aufgebrachtes Geschrei, Paare, die in den Fensternischen oder in dunklen Ecken standen und sich ungeniert küssten. Eine radikale Veränderung.
Ich machte mich ganz klein, wenn ich die Gläser einsammelte und verschütteten Wein aufwischte. Beine auf hohen Schuhen wackelten über den Boden, Pailletten und Pfauenfedern schwebten zu Boden und setzten sich in den Fugen zwischen den breiten Dielen fest. Dort lag ich bis in die frühen Morgenstunden, um alle Reste der Feiern mit einem kleinen Küchenmesser zu beseitigen. Wenn Madame aufwachte, musste alles wieder perfekt sein. Das war harte Arbeit. Jeden Morgen musste eine frisch gebügelte Tischdecke bereitliegen. Alles musste glänzen, die Gläser mussten fleckenfrei sein. Madame schlief immer bis in den späten Vormittag hinein. Wenn sie dann ihr Schlafzimmer verließ, lief sie durch die Wohnung und inspizierte jedes Zimmer. Wenn sie etwas fand, das sie zu bemängeln hatte, bekam immer ich die Schuld dafür. Immer die Jüngste. Ich habe schnell gelernt, worauf sie achtete, und machte morgens eine zusätzliche Runde, um die Fehler zu korrigieren, die von den anderen Dienstmädchen begangen worden waren.
Die wenigen Stunden Schlaf auf der harten Matratze aus Rosshaar waren nie genug. Ich war erschöpft und entkräftet von den harten, langen Tagen und den kratzenden Nähten der schwarzen Dienstmädchenuniform. Und von der Hierarchie und den Ohrfeigen. Und von den Männern, die ungefragt meinen Körper berührten.
Das rote Adressbuch
N. NILSSON, GÖSTA
Ich hatte mich daran gewöhnt, dass einige Gäste einfach einschliefen, wenn sie zu viel getrunken hatten. Es gehörte zu meinen Aufgaben, sie zu wecken und hinauszuwerfen. Aber dieser eine Mann schlief gar nicht. Er starrte. Die Tränen liefen ihm unaufhaltsam die Wangen hinunter, während er einen anderen Mann in einem Sessel anstarrte – jung, mit goldbraunen Locken, die seinen Kopf wie einen Heiligenschein umgaben –, der dort lag und schlief. Das weiße Hemd des jungen Mannes war aufgeknöpft und entblößte ein vergilbtes Unterhemd. Auf der sonnengebräunten Brust war ein Anker abgebildet, unsauber gezeichnet, in grünblauer Tinte.
»Es tut mir sehr leid, dass Sie traurig sind, mein Herr, aber ich …«
Er lehnte seine Schulter gegen die Armlehne des Ledersessels und legte seinen Kopf darauf.
»Unmöglich ist die Liebe«, nuschelte er und nickte.
»Sie sind betrunken. Bitte stehen Sie jetzt auf, Sie müssen die Wohnung verlassen haben, bevor Madame aufwacht.« Ich bemühte mich, meine Stimme mit Nachdruck zu versehen.
Er hielt meine Hand fest umklammert, als ich versuchte, ihn hochzuziehen. »Sieht das Fräulein es denn nicht?«
»Was soll ich sehen?«
»Dass ich leide!«
»Doch, das sehe ich sehr wohl. Gehen Sie nach Hause, und schlafen Sie Ihren Rausch aus, dann wird auch das Leid weniger werden.«
»Lassen Sie mich bitte hier sitzen und diese Vollkommenheit betrachten. Lassen Sie mich diese lebensgefährliche Verführung genießen.«
Er verhedderte sich in seiner Ausführung, in dem Bemühen, die Stimmung zu beschreiben. Ich schüttelte nur den Kopf.
Das war meine erste Begegnung mit diesem empfindsamen Mann, und es würden noch viele folgen. Wenn sich die Wohnung langsam leerte und die Morgendämmerung über den Dächern von Södermalm aufging, saß er oft noch in einem der Sessel, tief in Gedanken versunken. Sein Name war Gösta. Gösta Nilsson. Er wohnte ein paar Häuser weiter die Straße hinunter, in der Bastugatan 25.
»Nachts kann ich so gut nachdenken, meine süße Doris«, sagte er immer, wenn ich ihn bat zu gehen. Und dann erhob er sich und schwankte mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Nacht davon. Seine Kappe saß schief, und sein abgewetztes Jackett war viel zu groß und hing an einer Seite tiefer herunter, als wäre auch sein Rücken schief. Und trotzdem sah er elegant aus. Sein Gesicht war oft sonnengebräunt und hatte klassische Züge, eine gerade Nase und schmale Lippen. Sein Blick war voller Güte und Liebenswürdigkeit, aber auch voller Sorge und Trauer. Sein Feuer war erloschen.
Es dauerte ein paar Monate, bis ich begriff, dass er ein Künstler war, den Madame vergötterte. Seine Gemälde standen in ihrem Schlafzimmer, große Leinwände mit Drei- und Vierecken in kräftigen Farben. Keine Motive, nur Explosionen aus Farben und Formen. Als hätte sich ein Kind mit einem Pinsel auf die Leinwand gestürzt. Ich mochte die Bilder nicht. Überhaupt nicht. Aber Madame kaufte und kaufte. Weil auch Prinz Eugen von Schweden es tat. Und weil die surrealistische Moderne eine Kraft hatte, die sonst niemand verstand. Sie mochte es, dass er, wie sie, ein Außenseiter war.
Madame hat mir beigebracht, dass der Mensch die unterschiedlichsten Erscheinungsformen annehmen kann. Dass das Erwartete nicht immer auch das Richtige sein muss, dass es viele Wege gibt auf dieser Reise, die für uns alle gleich endet. Mit dem Tod. Dass wir an viele Kreuzungen kommen, die schwere Entscheidungen erfordern, aber der Weg dahinter wieder gerade verläuft. Und dass Kurven nicht immer gefährlich sein müssen.
Gösta stellte mir immer unzählig viele Fragen.
»Magst du lieber Blau oder Rot?«
»In welches Land würdest du reisen, wenn du dir jeden beliebigen Ort auf dieser Welt aussuchen könntest?«
»Wie viele Bonbons für ein Öre das Stück kann man sich für eine Krone kaufen?«
Nach dieser letzten Frage warf er mir immer ein Kronenstück zu. Er schnippte es mit dem Zeigefinger in die Luft, und ich fing es lächelnd auf.
»Gib die ganze Krone für etwas Süßes aus, versprich mir das.«
Er wusste genau, dass ich noch sehr jung war. Eigentlich noch ein Kind. Er berührte mich auch nie, so wie es die anderen Männer taten. Er verlor nie auch nur ein einziges Wort über meine Lippen oder meine Brüste. Manchmal ging er mir sogar heimlich bei der Arbeit zur Hand: sammelte Gläser ein und brachte sie raus in den Dienstbotengang. Wenn Madame das bemerkte, bekam ich hinterher eine Ohrfeige. Ihre dicken Goldringe hinterließen rote Spuren auf meiner Wange. Ich kaschierte sie mit ein bisschen Weizenmehl.