

Schicksalsgeschichten von politischer Wucht,
geschrieben im Hochsicherheitsgefängnis von Edirne –
»ein Zeichen des Widerstands gegen Erdoğan«
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Wenn eine Frau Opfer staatlicher Willkür wird, nur weil sie zur falschen Zeit auf dem Weg zur Arbeit ist. Wenn ein Vater gezwungen ist, über seine Tochter zu richten, um die Ehre der Familie zu retten. Wenn einem Mädchen nur die Flucht von zu Hause bleibt, um selbst über sein Leben zu bestimmen.
Jede einzelne der Schicksalsgeschichten lässt einem den Atem stocken, weil nichts so schrecklich ist wie die Realität, aus der Selahattin Demirtaş schöpft. Nur selten kommt man dem Alltag in der islamischen Welt so nahe wie in diesen Erzählungen. Konkret und ungeschönt schildern sie das Leben in der Türkei, das gespalten ist zwischen Tradition und Moderne, Ignoranz und ohnmächtiger Wut.
Selahattin Demirtaş, Jahrgang 1973, war bis Februar 2018 Co-Vorsitzender der Oppositionspartei HDP, der Demokratischen Partei der Völker, die sich für eine pluralistische Türkei einsetzt. Der kurdische Politiker ist Erdoğans wichtigster Gegenspieler und wird seit November 2016 im Hochsicherheitsgefängnis von Edirne festgehalten. Dort, in der Zelle, hat er angefangen, Erzählungen zu schreiben. Nach der Prüfung durch die Gefängnisdirektion wurden die Texte an den Verlag Dipnot gefaxt, der die Sammlung im September 2017 herausgegeben hat. Morgengrauen wurde zum Bestseller und hat sich inzwischen 200 000 Mal in der Türkei verkauft.
Gerhard Meier, Jahrgang 1957, lebt seit 1986 in Lyon und übersetzt literarische Werke aus dem Türkischen und Französischen, unter anderem von Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Amin Maalouf, Henri Troyat und Sait Faik. 2014 erhielt er für sein Gesamtwerk den Paul-Celan-Preis.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
SELAHATTIN DEMIRTAŞ
MORGENGRAUEN
Storys
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier
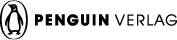
Allen misshandelten und ermordeten Frauen
INHALT
Der Mann in uns
Seher
Nazan, die Putzfrau
Es ist nicht so, wie Sie denken
Schönen Gruss an die schwarzen Augen
An die Gefängnis-Brief-Lese-Kommission
Die Meerjungfrau
Aleppo-Püree
Ach, Asuman!
Abrechnung mit meiner Mutter
Unendlich einsam
Es wird einmal herrlich werden
Danksagung
DER MANN IN UNS
UNSER GEFÄNGNISHOF IST so groß wie ein rechteckiger Betonbrunnen. Vier mal acht Meter. Zu Fuß kaum zu bewältigen. Wenn man morgens losgeht, ist man abends immer noch nicht angekommen. Zwei Menschen dürfen auf diesen Hof, der Parlamentsabgeordnete Abdullah Zeydan und ich. Was aber nicht heißt, dass er uns allein gehört. Wir teilen uns den Hof mit Ameisen und Spinnen. Im Grunde ist das Gefängnis deren Heimstätte übergestülpt worden, darum behandeln sie uns auch, als seien sie die wahren Hausherren. Ganz unrecht haben sie nicht. So lassen wir uns denn in aller Höflichkeit darauf ein, und unser Verhältnis ist von gegenseitiger Achtung geprägt – und von Freude. Gern sehen wir der Ameisenkolonie bei ihrer tatkräftigen Gemeinschaftsarbeit zu. Eifrig errichten sie in einer trüben Gefängnisecke einen beeindruckenden Bau. Die Spinnen dagegen sind eher leidenschaftslos. Sie rühren sich wenig, und grüßt man sie, nehmen sie den Faden kaum einmal auf. Es sei denn, sie verwenden ihn für ihr Netz.
Und dann sind da noch die Spatzen, ein Paar, das an der Dachrinne ein Nest hat. Tag für Tag kamen die beiden mit Gräsern und Zweiglein im Schnabel angeflogen, wobei sich das Weibchen als fleißiger erwies. Das Männchen brachte nur hin und wieder etwas und turnte meist auf dem Stacheldraht am Nesteingang herum. Aber ich will ihm nicht unrecht tun, vielleicht war ja das seine eigentliche Aufgabe.
Zehn Tage dauerte der Nestbau. Wir unterstützten die beiden, so gut wir konnten, indem wir auf dem Fensterbrett Wasser und Brotkrumen anboten. Plötzlich sagte das Weibchen: »Herzlichen Dank! Mein Faulpelz von Mann würde das Essen im Leben nicht heranschaffen, dann müsste ich mich auch darum noch kümmern.« Verdutzt erwiderte ich: »Wie bitte, meinen Sie mich?« »Ja, Sie verstehen mich doch, oder?« Ich traute meinen Ohren kaum. Als Kind hatte ich die Sprache der Vögel halbwegs gelernt, und wie sich nun zeigte, nicht vergessen. »Aber ich bitte Sie, das ist nicht der Rede wert. Wir haben uns gedacht, bei all dem Bauen und Umziehen sollen Sie nicht auch die Mühe mit dem Kochen haben. Wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie es ruhig, wir sind schließlich Nachbarn.« »Gut, vielen Dank noch mal.« Da kam auf einmal das Männchen aus dem Nest heraus. »Mit wem redest du da?« »Ach, ich habe mich bloß bei den Nachbarn für das Essen bedankt.« »Sieh zu, dass du reinkommst«, herrschte er die Frau an. Sie fügte sich, um die Sache nicht ausarten zu lassen. Das Spatzenmännchen sah mich herausfordernd an. »Ist noch was?« »Nein, nein, ich habe Ihrer Frau nur angeboten …« »Ja, schon gut, wenn irgendwas ist, dann sagen Sie es gefälligst mir.« »In Ordnung. Schönen Tag noch«, stammelte ich und schloss behutsam das Fenster.
Ein paar Tage darauf merkten wir, dass das Weibchen entbunden hatte: Im Nest lagen zwei Eier. Unsere Nachbarn würden Zwillinge bekommen, zweieiige Zwillinge. Hoffentlich geraten sie nicht nach dem Vater, dachte ich mir. Normalerweise darf man im Gefängnis keine rohen Eier haben. Aus gekochten schlüpfen aber keine Jungen aus, also würde das neue Leben aus einem Verbot heraus entstehen. Wir sahen das Weibchen brüten und nebenbei am Nest weiterbauen, während das Männchen lediglich Drohgebärden übte.
Neulich weckte mich ein aufgeregtes Zwitschern aus dem Schlaf. Die Tür zu unserem Hof war noch nicht aufgeschlossen, doch vom Fenster aus hatten wir das Nest ohnehin am besten im Blick. Ich stand auf, um zu sehen, was da los war. Der Lärm war ohrenbetäubend, man hätte meinen können, es würde eine Demonstration aufgelöst. »Bitte kein Tränengas!«, schrie jemand. Um das Nest herum standen vier Spatzenmännchen und zwitscherten auf das Paar ein, das verzweifelt sein Nest zu verteidigen suchte.
Soweit ich aus dem Lärm heraushörte, waren die Ankömmlinge »Staatsvögel«. Einer von ihnen plusterte sich ganz besonders auf und war daran als ihr Chef zu erkennen. In amtlichem Ton erklärte er: »Jetzt hören Sie mal zu, Sie haben dieses Nest ohne Genehmigung errichtet. Wenn Sie nicht wollen, dass es eingerissen wird, zahlen Sie dem Vogelstaat als Strafe eines Ihrer Jungen, sobald es geschlüpft ist.« »Jawohl, das zahlen Sie!«, pflichteten seine Untergebenen ihm bei. Da breitete das Vogelweibchen vor dem Nest die Flügel aus und sagte entschlossen: »Sie kriegen weder mein Nest noch mein Junges. Nur über meine Leiche!« Das Spatzenmännchen schickte hinterdrein: »Genau! Nur über die Leiche meiner Frau!« Unklar blieb, ob das nun als Protest oder als Bitte aufzufassen war.
Der Vorgesetzte und seine Handlanger rückten noch näher heran. »Das ist jetzt meine letzte Warnung«, drohte er. »Wenn Sie sich einer staatlichen Verfügung widersetzen, lasse ich Sie beide ins Gefängnis werfen.« Unwillkürlich wandte sich das Spatzenpärchen mir zu. Sie schienen zu fragen: »Herr Nachbar, was meinen Sie, was sollen wir tun?« Der Blick, den ich zurückwarf, bedeutete: »Lassen Sie sich bloß nichts gefallen!« Daraufhin rief das Weibchen energisch: »Ich werde mich bis zum letzten Atemzug wehren!« Und das Männchen, volltönend: »Ja, wehr dich bis zuletzt!«
Ohne weiter zu zögern, stürzte das Weibchen auf die Delegation zu. Am Stacheldraht brach ein ungeheures Durcheinander los. Während das Heldenepos vom Widerstand eines Spatzenweibchens gegen vier Staatsvögel geschrieben wurde, hielt sich das Männchen zappelnd beiseite und rief: »Moment mal, Herr Beamter, wir müssen ja nicht gleich eine Szene daraus machen. Zwei Kinder sind uns sowieso zu viel!«
Mitten aus dem Kampfgetümmel heraus warf das Weibchen dem Männchen einen derartig stechenden Blick zu, dass dieses sich verlegen unter seinen Federn verkroch. Das Weibchen schlug ungelogen ganze zehn Minuten lang so sehr um sich, dass sich die vier Staatsvögel schließlich davonmachten. Der Eifer, mit dem das Weibchen um sein Nest und seine Jungen gekämpft hatte, ließ mich staunen. Mein Geschlechtsgenosse wiederum, der sich lediglich aufs Schwadronieren verstand, blickte mich an. »Jetzt schau nicht so, Hamza«, sagte ich (unterdessen hatte ich ihm nämlich den Namen Hamza verpasst), »du musst nur erst mal den Mann in dir erledigen.« Hamza starrte entgeistert, sagte aber vorläufig nichts. Falls sich in der Sache noch etwas tut, werde ich berichten.
SEHER
BEVOR PINAR UND Kader ins Bett geschlüpft waren, hatten sie sich mit dem von Seher angerührten Henna die Hände bemalt und alte Strümpfe wie Handschuhe darübergezogen. Bald darauf legte sich Seher zu ihren jüngeren Schwestern. Vor lauter Vorfreude auf das Fest am nächsten Morgen konnten sie nicht einschlafen. Pınar musste immer wieder an ihr neues Kleid denken. Bisher hatte sie stets alte Sachen von Kader auftragen müssen, nun hatte sie zum ersten Mal ein eigenes Kleid bekommen und stellte sich vor, wie schön sie darin aussehen würde. Auch neue Schuhe waren ihr zum Fest gekauft worden. Pınar war ähnlich aufgedreht, und so kicherten sie unter der Bettdecke bis nach Mitternacht. Sehers Schimpfen kümmerte sie nicht, nur zu gut wussten sie, dass es nicht ernst gemeint war. Seher konnte ihnen einfach nicht böse sein. Doch irgendwann erschöpft, schmiegten sich die beiden an ihre Schwester und schliefen ein.
Dass Seher keinen Schlaf fand, lag an etwas anderem. Sie hatte eingewilligt, sich mit Hayri in einer Konditorei zu treffen. Die beiden arbeiteten in derselben Konfektionsschneiderei. Wegen des bevorstehenden Festes hatten sie mittags schon freibekommen, und Hayri war beim Hinausgehen an sie herangetreten und hatte ihr schüchtern das Treffen vorgeschlagen. Darauf wartete sie eigentlich schon lange. Seit geraumer Zeit tauschten die beiden in der Schneiderei heimliche Blicke und waren schon ins Gerede gekommen, denn unbemerkt blieb so etwas nicht.
Seher fand, es sei höchste Zeit zu heiraten. Sie war zweiundzwanzig und fürchtete allmählich, ohne Mann zu bleiben. Die Mädchen ihres Alters waren zumeist verheiratet worden, noch bevor sie achtzehn waren, und hatten schon alle Kinder. Um Seher geworben hatte durchaus der eine oder andere, doch es war bisher keiner darunter gewesen, den sie gewollt hätte. Für Hayri dagegen hatte sie etwas übrig. Mit seiner hohen Gestalt, den lockigen Haaren und vollen Lippen konnte er durchaus als schöner Mann gelten. Seit fast acht Monaten arbeiteten sie gemeinsam in dem Betrieb. Sie selbst war seit vier Jahren dort angestellt, Hayri hatte nach seinem Wehrdienst angefangen.
Durch die festtägliche Betriebsamkeit im Haus wurde Seher am nächsten Morgen früh wach; an so einem Feiertag waren alle fröhlich gestimmt. Ihr Vater Gani, der drei Jahre ältere Bruder Hâdi und der fünfzehnjährige Engin machten sich auf den Weg zum Festtagsgebet. Sobald sie aus dem Haus waren, eilten Pınar und Kader zum Waschbecken und rubbelten sich das getrocknete Henna von den Händen. Seher wusch sich selbst die Hände, dann half sie den Schwestern. Ihre Hände waren nun rot wie Granatäpfel. Seher roch an den zarten kleinen Handflächen der Schwestern und küsste sie. Ihre Mutter Sultan war schon in der Küche und bereitete das Frühstück zu, damit es fertig war, wenn die Männer aus der Moschee zurückkamen. Während Seher ihrer Mutter zur Hand ging, liefen die beiden Kleinen in ihr Zimmer, um sich herzurichten. Die Bodenmatratzen in den beiden Zimmern waren bereits verräumt und auch im großen Zimmer der niedrige Tisch schon gedeckt, um den herum alle auf dem Boden sitzen würden. Außer an Feiertagen frühstückten sie nie zusammen.
Als die Männer wieder zu Hause waren, wünschten alle einander ein frohes Fest. Alle, auch die Mutter, küssten dem Vater die Hand. Der Vater umarmte und küsste nur Pınar und Kader, dann verteilte er die Geldgeschenke. Danach küssten die Kinder der Mutter die Hand, sie küssten sich auch untereinander, und Pınar und Kader luchsten ihrem Bruder Hâdi etwas Geld ab. Seher nahm Engin in den Arm, was er nicht leiden mochte. Aber an einem solchen Festtag ließ er es sich gefallen, außerdem war Seher seine Lieblingsschwester. Auch Seher mochte ihn am liebsten. Sie zog etwas Geld aus ihrem Portemonnaie und reichte es Engin. Der wollte es zunächst nicht annehmen, aber Seher bestand darauf, und schließlich drückte er sie und steckte das Geld ein. Munter plaudernd frühstückten sie.
Den Vormittag über kamen die Nachbarn zu Besuch, dann gingen die Männer nach und nach aus dem Haus. Bis zu Sehers Treffen mit Hayri waren es nur noch drei Stunden, aber noch hatte sie ihrer Mutter nicht gesagt, dass sie sich mit ihm treffen würde. Die Mutter liebte alle ihre Kinder, doch Seher war mehr als nur eine Tochter, sie war auch Vertraute, Gefährtin, Komplizin. Darum war sie Seher gegenüber nachsichtiger. Als Seher ohne eine Erklärung losging, gab sie ihr ein paar Mahnungen mit auf den Weg, fragte aber nicht, wo sie hinwolle; sie konnte es sich denken.
Seher traf sich mit Hayri in der Konditorei gegenüber dem Gerichtsgebäude von Adana. Als sie eintrat, saß er schon an einem Tisch. Er stand auf und schüttelte ihr die Hand. »Schön, dass du gekommen bist. Frohes Fest«, sagte er, und Seher erwiderte mit zittriger Stimme: »Ja, dir auch.« Vor Aufregung schwitzte sie. Da sie sich zum ersten Mal mit einem jungen Mann traf, wusste sie überhaupt nicht, wie sie sich verhalten sollte. Ihr Leben hatte bisher nur daraus bestanden, von zu Hause in die Arbeit zu gehen und von dort wieder zurück. Die anderen Mädchen in der Schneiderei erzählten manchmal von solchen Treffen, aber es selbst zu erleben, war doch etwas ganz anderes. Hayri hingegen schien gar nicht aufgeregt und redete über dieses und jenes. Dann kamen sie auf ihre Familien und ihr bisheriges Leben zu sprechen. Dabei taute Seher allmählich auf, und schließlich war ihr, als sei sie schon seit Jahren mit Hayri zusammen. Das lag natürlich auch an Hayris charmanter Art. Bestimmt war er in solchen Dingen erfahrener als sie, und mochte er sich auch schon mit anderen Mädchen getroffen haben, so kam es doch nur darauf an, dass er nun hier mit ihr saß und so nett zu ihr war. Beim Reden senkte er manchmal den Kopf, sodass Seher ihn mustern konnte.
Als die beiden sich nach zwei Stunden voneinander verabschiedeten, hatte sie sich wohl verliebt. Sie ging zu Fuß heim nach Şakirpaşa und dachte den ganzen Weg über nur an Hayri. Manchmal schoss ihr die Hitze ins Gesicht, und vor Aufregung wurde ihr sogar leicht schwindlig. Mit der Zeit aber schwand der Zauber des heimlichen, verbotenen Treffens, und es stellte sich Angst ein. Sollten ihr Vater oder Hâdi davon erfahren, würde es ihr übel ergehen. Sie musste vorsichtig sein und sich nichts anmerken lassen. Sogar ihre Mutter durfte sie vorläufig nicht einweihen.
Als sie zu Hause ankam, waren die Männer noch nicht da. Ihre Mutter stellte ihr keine Fragen, sie war sich sicher, dass sie ihr zu gegebener Zeit alles erzählen würde.
Am Abend wurden die Matratzen zeitig ausgelegt, und Pınar und Kader schliefen schnell ein. Seher legte sich zu ihnen, träumte aber noch stundenlang von Hayri. Sie stellte sich ihre Hochzeit vor, das Kleid, das sie tragen würde … Im Geiste richtete sie schon die gemeinsame Wohnung ein, und wenn sie daran dachte, wie sie mit Hayri darin ganz allein sein würde, wurde ihr wieder ganz heiß. Sie merkte nicht, wie sie irgendwann doch in den Schlaf glitt.
Beim Frühstück saß erneut die ganze Familie beisammen. Er herrschte nicht mehr dieselbe Ausgelassenheit wie am Tag zuvor, aber es ging fröhlich zu. Seher jedoch traute sich nicht, den anderen in die Augen zu schauen, so sehr fürchtete sie, man könne darin lesen wie in einem Buch.
Und es waren noch zwei Menschen am Tisch, die es vermieden, sich anzublicken. Der Vater und Hâdi. Die beiden waren sich am Vortag in einem Bordell in Adana über den Weg gelaufen und hatten so getan, als hätten sie den anderen nicht bemerkt. Sie wussten aber beide, dass dem nicht so war. In stillschweigendem Einverständnis taten sie nun so, als wäre nichts geschehen, sahen sich aber dennoch nicht an und sprachen auch kein Wort. Dass bei Tisch das Thema auf Hâdis Hochzeit kam, die im Sommer nach einjähriger Verlobungszeit stattfinden sollte, machte die Sache nicht leichter.