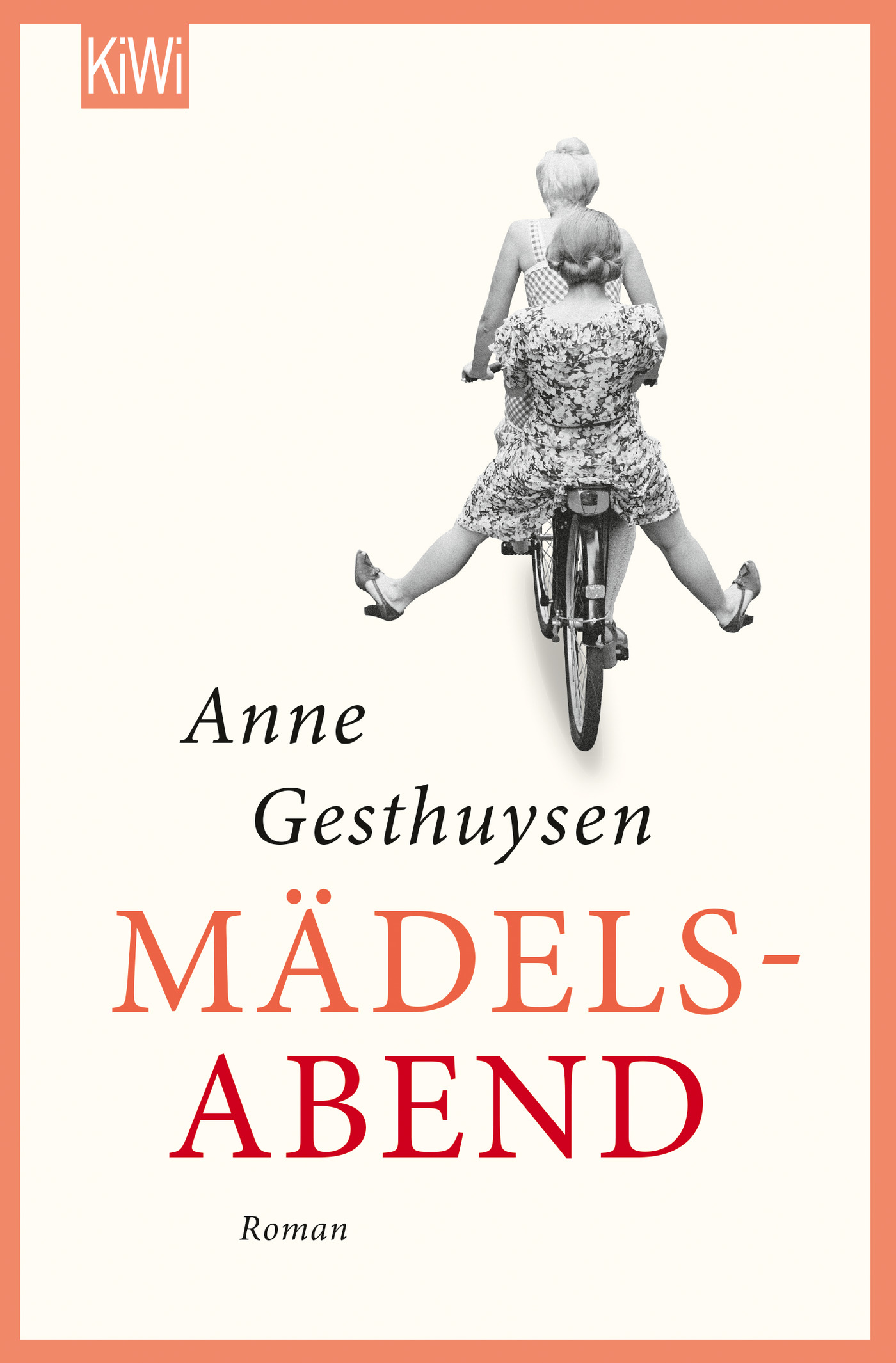
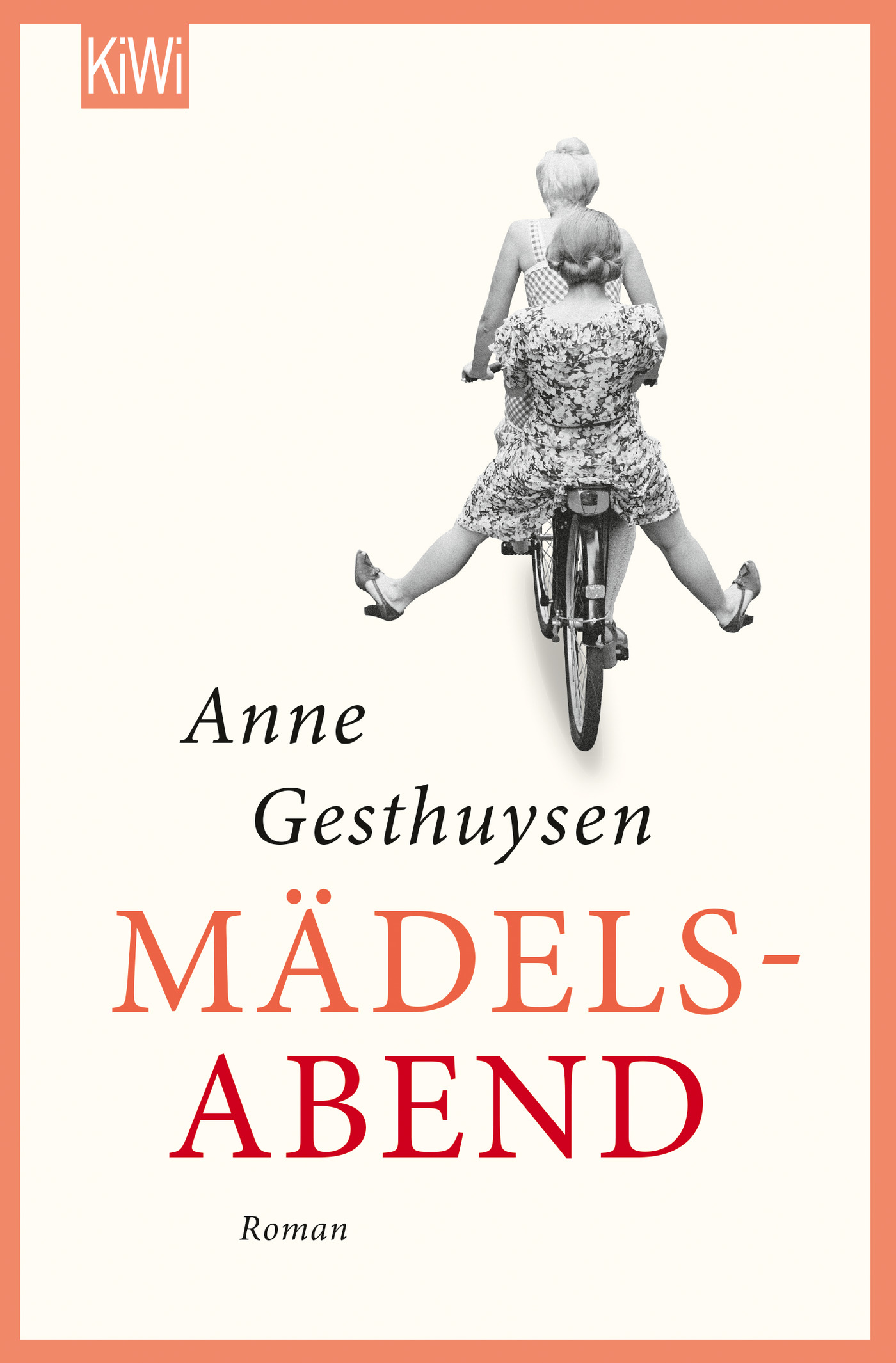
Dieses Buch ist ein Roman.
Es enthält keine Behauptungen über reale Personen.
Für Frank
Weiße Schwaden kräuselten sich vor dem schwarzen Nachthimmel, veränderten sich, je höher sie stiegen, und nahmen schließlich Gestalt an wie wabernde Gespenster. Unterhalb des Geistertanzes züngelten Flammen aus einem Fenster, die einer Schar Uniformierter mit schweren Wasserwerfern und ausgeklügelter Choreografie trotzten.
So stellte sich Ruth das Feuer auf Burg Winnenthal vor. Sie hatte eine blühende Fantasie.
Und während draußen der Kampf der Elemente tobte, erhob sich drinnen, im Gemeinschaftssaal der Burg, Lili Heinemann langsam und bedächtig. Sie griff ihren Persianermantel und warf ihn mit Schwung über die Schulter. Ruth beobachtete die Frau mit einer gewissen Faszination. Zugleich war ihr schlecht vor Aufregung, denn sie konnte den Feueralarm laut und deutlich hören, auch ohne Hörgeräte. Hoffentlich verbrennen die blöden Dinger, dachte sie. Ihre Enkelin Sara hatte nicht lockergelassen, bis sie sich ein Paar hatte anfertigen lassen. Doch sie trug sie nur, wenn ihre Enkelin sie besuchte. Kaum war Sara aus der Tür, pfefferte Ruth die schmerzenden Apparate in die Ecke.
Lili Heinemann griff in ihre Manteltasche und holte ein kleines Foto heraus, vielleicht ein Passbild. Sie zerknüllte es und rief: »Folgen Sie mir bitte, meine Damen, versuchen Sie den Anschluss nicht zu verlieren und halten Sie sich gebückt.« Ruth packte den Rollator, so fest es mit ihren vom Rheuma verkrümmten Händen möglich war, und reihte sich in die Schlange der Bewohnerinnen des Seniorenstifts Burg Winnenthal ein. Rüssel an Schwanz hinterher, schoss ihr durch den Kopf, als sie sich auf den Weg machten. Es könne ein Lauf um Leben und Tod werden, hatte Frau Heinemann ihnen eingeschärft. Wenn eine umfiel, so sollten sie weitergehen. Keine von ihnen hätte die Kraft, eine Freundin zu retten. Auch wenn sie sich gegenseitig stützten und sich Mut zusprachen, sollten sie im Falle eines Falles erst einmal an die eigene Sicherheit denken.
Als sie den kühlen Salon im Erdgeschoss des alten Gebäudes verließen, fühlte Ruth die Hitze des Feuers. Es musste über ihnen brennen, im ersten oder zweiten Stock. Sie konzentrierte sich auf den Weg, der vor ihr lag. Sie atmete schwer, schloss kurz die Augen und zählte dann ihre Schritte, wie sie es zuvor ein paarmal geübt hatte. Acht, neun, zehn, jetzt schlurfte sie vermutlich gerade an dem überlebensgroßen Porträt der Maria von Burgund vorbei. Ruth blieb stehen, sie musste verschnaufen. Sie überlegte, ob sie ihren Wintermantel einfach wegwerfen sollte. Er war zu schwer, zwang sie immer tiefer in die Bückhaltung, und sie hatte die Befürchtung, unter seiner Last zusammenzubrechen. Aber Lili Heinemann hatte ihnen eingebläut, die Mäntel anzulassen, sie würden sie nicht nur vor der Kälte draußen, sondern auch vor der Hitze schützen. Also weiter. Neunzehn Schritte, zwanzig, einundzwanzig, Herrgott, nahm dieser Flur denn überhaupt kein Ende? Ihre Augen tränten, sie fühlte sich völlig orientierungslos. In ihr keimte der Wunsch, aus der Reihe auszuscheren, an der Wand auszuruhen, doch sie riss sich zusammen. Der Lärm, der Rauch, die Flucht und das aufgeregte Getuschel erinnerten sie an die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Sie war fünfzehn gewesen, als die alliierten Truppen den Niederrhein in Schutt und Asche bombten. Ihre Familie jubelte, und Ruth spürte einen seltsamen Widerspruch: Sie rannte um ihr Leben, und zugleich glaubte sie, Teil von etwas Größerem, etwas Gerechtem zu sein.
Eine Sirene heulte. Ruth ging noch etwas schneller, sie atmete schwer und wusste nicht, ob es an dem vielen Kohlenmonoxid lag oder der Anstrengung geschuldet war. Als sie schließlich ins Freie trat, wurde ihr vom plötzlichen Übermaß an Sauerstoff schwindlig. Sie sog die Luft tief ein und blickte sich um. Es war finstere Nacht, sie wusste nicht, wo sie sich befanden. Jedenfalls nicht am Hauptportal der Burg, denn dort, so nahm sie an, würde die Feuerwehr stehen. Müssten sie nicht die Lichter von Veen sehen? Ruth hörte die anderen Damen keuchen, keine sagte etwas. »Haben wir es geschafft?«, fragte sie nach einer Weile leise, und Lili Heinemann antwortete: »Ich denke schon. Aber Vorsicht! Wir sind direkt am Wassergraben.«
Es war schlau gewesen, sie hierher zu führen. Das Wasser in dem alten Burggraben war nicht besonders tief, ertrinken konnte hier niemand, doch ein falscher Schritt auf dem matschigen Boden wäre fatal. Er könnte bei ihren porösen Knochen eine Fraktur des Oberschenkelhalses zur Folge haben, und in ihrem Alter war das meist der Anfang vom Ende. Wie oft hatte ihre Enkelin Sara das gebetsmühlenartig wiederholt, als sie noch in ihrem Haus auf der Bönninghardt gewohnt hatten. Damals hatte Ruth die Warnung in den Wind geschlagen. Jetzt nicht mehr. Sie war achtundachtzig Jahre alt und hatte durchaus die neunzig im Sinn. Sie wollte noch nicht abtreten, das Leben hatte neuen Schwung bekommen, seit sie auf Burg Winnenthal lebte. Hier gedachte sie noch eine Weile zu bleiben.
Sie beugte sich zur Seite, um sich nach ihrer Freundin Ottilie Oymann zu erkundigen, und in dem Moment sank ein Vorderrad des Rollators im Matsch ein. Ruth hatte nicht mehr die Kraft, sich aufrecht zu halten, sie spürte noch, wie sie mit der Schläfe gegen den Rollatorgriff stieß, dann schlug sie auf den nassen Boden auf, und ihr wurde schwarz vor Augen.
Ein Klingeln riss Sara aus dem Schlaf. Es war nicht der Weckton ihres Handys, stellte sie benommen fest, und wenn es nicht ihr Wecker war, hieß das, sie musste noch nicht aufstehen.
»Geh ran, es ist dein Telefon«, murmelte Lars und stieß sie sanft in die Seite.
»Kann nicht sein«, antwortete sie mit einem Blick auf die Uhr. Es war vier, und sie war sicher, keinen Notdienst zu haben.
Es klingelte weiter, und jäh wurde Sara bewusst, wer sie um die Uhrzeit anrufen könnte. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett und rannte nach unten. Auf dem Wohnzimmertisch suchte sie zwischen iPad, Zeitschriften und Büchern ihr Handy. Endlich hielt sie es in der Hand. Es war tatsächlich ihr Vater, sie sah seinen Namen auf dem Display. Er war gerade in Thailand unterwegs.
»Ist etwas passiert?«, rief sie ohne Begrüßung.
»Hast du deine Mobilbox nicht abgehört?«, fragte er. »Auf Burg Winnenthal hat’s gebrannt. Oma ist im Krankenhaus.« Sara verstand ihren Vater kaum. Zum einen war die Verbindung schlecht, zum andern war Paul aufgewacht und brüllte aus Leibeskräften. Wie konnte ein nicht einmal einjähriges Kind nur so laut schreien, fragte sie sich. Seit der Geburt ihres Sohnes hatte sie kaum mehr als drei Stunden am Stück geschlafen, was sich bereits auf ihre Sprach- und Konzentrationsfähigkeit auswirkte. Auch in diesem Moment fiel es ihr schwer, dem zu folgen, was ihr Vater sagte. »Opa hat mich angerufen. Er war furchtbar aufgeregt. Ich habe vor lauter Räuspern kein Wort verstanden.« Ihr Vater klang verärgert, er hatte ein schwieriges Verhältnis zu Walter van Rennings, hatte ihm immer vorgeworfen, seine geliebte Mutter nicht glücklich gemacht zu haben. Familiengeschichten, dachte Sara und hörte, wie Lars oben energisch ins Kinderzimmer ging. Es wurde still, und sie vermutete, dass er ihren Sohn zu sich ins Bett geholt hatte.
»Wo liegt Oma denn? Und mit welcher Diagnose?«
»Ich weiß es nicht. Dein Opa hat nur etwas von Krankenhaus gekrächzt, und dass sie gestürzt sei. Du wirst ihn sicher besser verstehen, ich bin ja hier mitten in der Pampa, die Verbindung bricht dauernd ab«, sagte er verzweifelt. Saras Vater besuchte mit seiner zweiten Ehefrau Chi deren Familie in Thailand. Chi stammte aus einer abgelegenen Gegend, weit entfernt vom Ozean oder den landschaftlichen Wundern von Chiang Mai. Der nächste Flughafen war Stunden entfernt in einem Ort namens Khon Kaen. Als Sara damals zur Hochzeit ihres Vaters angereist war, hatte sie nicht einmal einen Reiseführer für diese Gegend gefunden.
»Ich kümmere mich um die beiden. Du kannst dich auf mich verlassen«, versprach Sara, wählte, kaum dass sie ihren Vater verabschiedet hatte, die Nummer der Heimleitung von Burg Winnenthal und hoffte, dass sie zu dieser Stunde und trotz der Umstände jemanden erreichte. Sie hörte das Tuten und bemerkte, dass ihr flau im Magen war. Sara liebte ihre Oma, sie waren sich immer schon sehr nah gewesen. Natürlich wusste Sara, dass die Zeit mit Ruth begrenzt war. Sie war immerhin schon achtundachtzig Jahre alt, aber die Vorstellung, ohne sie zu sein, machte Sara tieftraurig.
»Hier Burg Winnenthal«, meldete sich eine leicht näselnde Stimme. »Strunk, Heimleitung, am Apparat!«
»Sara van Rennings. Guten Morgen. Ich bin die Enkelin von Ruth und Walter van Rennings. Können Sie mir bitte sagen, wie es meinen Großeltern geht? Meine Großmutter musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.«
»Frau van Rennings! Guten Morgen. Es ist so furchtbar, wissen Sie?« Sara bekam es mit der Angst zu tun, gleichzeitig konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Heimleiterin auf den Schreck erst einmal ein Schnäpschen getrunken hatte. Leicht lallend, dafür mit ungeheurer Geschwindigkeit erzählte sie, was sich auf der Burg zugetragen hatte. Schnäbbeltrees nannte ihre Oma Frau Strunk wegen ihres Sprechtempos.
Die wichtigste Nachricht war: Saras Großmutter hatte sich bei ihrem Sturz nichts gebrochen. Sie war zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, da sie ein Hämatom an der Schläfe hatte. Sechs Menschen seien in der Nacht ins Hospital gekommen, darunter ein Pfleger und ein Feuerwehrmann, die vergeblich versucht hatten, das einzige Todesopfer zu retten. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in seinem Zimmer ausgebrochen. Er müsse wohl leider, leider, betonte die Heimleiterin, über einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein, die Glut habe die Wolldecke entzündet, mit der der alte Herr sich beim Fernsehen immer zudeckte. »Eigentlich hat er schon lange nicht mehr geraucht. Aber im Alter kommen solche Laster manchmal unvermutet wieder, vor allem, wenn die Herrschaften im Kopf langsam nachlassen, wissen Sie?«
»Ja, ich weiß«, sagte Sara unwillkürlich. Sie fühlte sich von dem ständigen »Wissen Sie?« der Heimleiterin zu einer Reaktion gezwungen, ähnlich wie sie bei Schweizern immer das Bedürfnis hatte, auf das »oder?« am Satzende zu reagieren.
Bereits vor einem halben Jahr habe dieser Herr einen Feueralarm ausgelöst, weil er ein halbes Hähnchen zwanzig Minuten in der Mikrowelle gelassen habe. Damals sei zum Glück nur das Federvieh verkokelt.
Sie räusperte sich. »Entschuldigung. Ich bin noch etwas durcheinander.« Sie berichtete weiter, die arme Ehefrau, nunmehr seine Witwe, habe ihren Mann allein gelassen, um mit den anderen Damen zu singen. »Ich fürchte, die Dame wird ihres Lebens nicht mehr froh. Sie wird sich unendlich schuldig fühlen. Dabei kann das doch nun wirklich keiner ahnen.« Sara unterbrach die hörbar mitgenommene Frau Strunk.
»Können Sie mir bitte noch sagen, in welchem Krankenhaus meine Oma liegt?«
»Sie ist dort nur zur Beobachtung, wissen Sie«, sagte die Heimleiterin. »Man hat sie nach Xanten gebracht. Dort …«
»Vielen Dank für die Auskunft, Frau Strunk.« Sara verabschiedete sich schnell, um einem weiteren Wortschwall zu entgehen, und rief im Sankt Josef-Hospital in Xanten an. Ihre Großmutter schlafe jetzt, sagte man ihr, sie solle für achtundvierzig Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, für den Fall, dass sie sich eine Gehirnerschütterung zugezogen habe, wonach es aber nicht aussehe.
Sara entspannte sich. Sie nahm sich vor, ihre Oma gleich am Nachmittag zu besuchen.
Vorsichtig schlich sie zurück ins Schlafzimmer, wo sie dem vertrauten Atmen von Vater und Sohn lauschte. Die beiden lagen in gleicher Pose nebeneinander, wie das Original und sein Mini-Me, und trotz aller Aufgewühltheit musste Sara lächeln. Einmal solch einen festen Schlaf haben, seufzte sie neidisch und legte sich vorsichtig ins Bett.
Sechs Jahre waren Lars und sie nun schon ein Paar, und irgendwie war von der ersten Begegnung an klar gewesen, dass dies eine ernsthafte Beziehung würde und nicht nur ein Krösken, wie ihre Oma flüchtige Affären bezeichnete.
Sie hatten sich in Afrika kennengelernt, wo sie für Ärzte ohne Grenzen arbeitete, während er dort sein Patenkind Momo besuchte. Lars kam mit Momo zu ihr, um dessen Ohren untersuchen zu lassen. Der Junge war fast taub, sein Trommelfell von einer schweren Entzündung perforiert. Doch zum Glück brauchte es nicht viel mehr als ein Antibiotikum, um aus Momo wieder einen lebhaften kleinen Kerl zu machen. Nach mehreren Besuchen im Ärzte-ohne-Grenzen-Camp streckte Lars Sara die geschlossene Hand hin, in der er offensichtlich etwas verbarg, und Sara antwortete verwirrt, sie erwarte kein Trinkgeld. Doch er hatte sie beharrlich gebeten, das, was sich in seiner Faust befand, anzunehmen. Es war ein Zettel mit seiner Telefonnummer und Adresse in Deutschland gewesen.
»Ich werde auf deinen Anruf warten«, hatte er gesagt und ihr dabei forsch einen Kuss auf die Wange gedrückt.
Lars war ein geradliniger, warmherziger Mensch, der wusste, was er wollte, und einen einmal eingeschlagenen Weg mit stoischer Dickköpfigkeit verfolgte. Er vermittelte ihr Ruhe und Gelassenheit, wenn sie selbst mal wieder mit sich und den Dingen haderte.
Seit Pauls Geburt allerdings stritten sie häufiger, was vor allem an ihrem Schlafmangel lag. Was man in jeder Frauenzeitschrift las, hatte sich leider als nur allzu wahr entpuppt: Das erste Jahr mit Kind stellte ein Paar auf die Probe. Die permanente Müdigkeit machte Sara dünnhäutig, und so manches Mal hatte Lars sie mit einer ungerechten Bemerkung über ihre organisatorische Unzulänglichkeit zur Weißglut gebracht. Neulich hatte sie ihm vor Wut eine randvolle Windel an den Kopf geworfen. »Scheiße!?«, entfuhr es dem völlig verblüfften Lars, und Sara musste vor lauter Elend lachen.
Wie die meisten jungen Mütter hatte auch Sara Mühe, Kind und Job unter einen Hut zu bringen. Sie hatte erst vor einigen Monaten wieder angefangen zu arbeiten, zunächst nur halbtags, wobei sie möglichst bald wieder Vollzeit arbeiten wollte. Doch das Gehetze zwischen Klinik, Tagesmutter, Kinderarzt und Haushalt brachte sie an ihre Grenzen. Finanziell war es ein Nullsummenspiel, weil sie in etwa das Geld, das sie verdiente, gleich wieder für die Kinderbetreuung ausgab. Sie zahlten für den Babysitter, wenn sie abends ausgehen wollten, für die Krabbelgruppe, wo Paul allerdings nur bis mittags bleiben konnte, und für Frau Brandt, eine pensionierte Lehrerin, die auf eigene Enkel wartete und, um nicht aus der Übung zu kommen, an zwei bis drei Nachmittagen in der Woche auf Paul aufpasste.
Sara konnte immer noch nicht schlafen. Sie dachte an ihre Oma. Sie hatte die ersten Jahre ihres Lebens zusammen mit ihrer Familie bei den Großeltern auf der Bönninghardt gewohnt, aber daran erinnerte sie sich nicht mehr. Sehr gut waren ihr allerdings die Ferien im Gedächtnis geblieben, die sie regelmäßig am unteren Niederrhein verbracht hatte. Sie hatte mit ihrer Oma oft ausgedehnte Spaziergänge gemacht, bei denen sie aus vollem Hals Wanderlieder schmetterten, wilde Beeren naschten und Champignons sammelten. Es gab unzählige davon auf den Wiesen der Bönninghardt, die Pilze gediehen auf dem Dung der vielen Kühe und Pferde besonders gut.
Die Bönninghardt war ein Ortsteil der Stadt Alpen, eine kleine Anhöhe, nahe der holländischen Grenze, die Überreste einer eiszeitlichen Moräne, also einer Schuttablagerung, die wegen ihrer knapp fünfzig Meter über Normalnull von den Einheimischen die Hei, plattdeutsch für Höhe, genannt wurde. Sara hatte als Kind die ländliche Atmosphäre geliebt, die Wiesen und Felder, den weiten Blick und die Tiere. Es gab dort einen kleinen Dackel und Ponys beim Nachbarn, auf denen sie Reiten lernte, wobei sie mehrfach in hohem Bogen abgeworfen wurde. Ihre ältere Schwester Anna hatte am Landleben nie Interesse gezeigt und lebte als Vorzeigehausfrau mit Mann und drei Kindern. Anna hatte ihre Heimatstadt nie verlassen, während Sara schon in der halben Republik gewohnt hatte: Hannover, Kiel, München, Berlin und immer wieder Düsseldorf. Da sie während ihres Studiums keine bezahlbare Wohnung gefunden hatte, war sie bei ihren Großeltern auf der Bönninghardt eingezogen. Sie hatte sich dort ausgesprochen wohlgefühlt, nicht nur wegen der hervorragenden Bratkartoffeln, die ihre Oma zubereitete, sondern auch weil sie immer gastfreundlich war und Saras Kommilitoninnen regelmäßig zur niederrheinischen Kaffeetafel einlud. Dabei erwies sie sich als lebenskluge Zuhörerin, die sich alle Namen und Geschichten bis ins Detail merkte. Das Gedächtnis ihrer Großmutter war bemerkenswert und hatte im Alter nicht im Geringsten nachgelassen. Sie trug immer noch lautstark einst auswendig Gelerntes vor. So kam Sara mit schöner Regelmäßigkeit in den Genuss der Fontane-Ballade »Archibald Douglas«. Und während sie selbst schon nach der dritten Strophe aufgeben musste, sprach ihre Oma alle dreiundzwanzig Vierzeiler mit Inbrunst, wie der alte Archibald höchstselbst, der nichts anderes von König Jakob erbittet, als in seinem Vaterland sterben zu dürfen.
Sara musste grinsen. Es passte zur Mentalität ihrer Großmutter, die eingefleischte Niederrheinerin war, genauso wie ihr Großvater, der sich gewünscht hatte, erst im Buchensarg sein Elternhaus zu verlassen. Es war ihm nicht vergönnt gewesen. In den letzten Jahren war es für die alten Leute einfach zu kompliziert geworden, sich in einem so gar nicht altengerechten Wohnhaus alleine zu versorgen. Und dann war ihre Oma gestürzt, und Sara hatte zusammen mit ihrem Vater die Entscheidung getroffen, die beiden ins »Betreute Wohnen« nach Burg Winnenthal zu bringen.
Sara drehte sich auf die Seite und blickte in Pauls weit aufgerissene Augen. Der Kleine lachte glucksend. »Psst«, machte Sara und legte den Finger auf die Lippen, was natürlich keine Wirkung zeigte. Also trug sie ihn leise nach unten ins Wohnzimmer, wo er genau in dem Moment mit forderndem Geschrei loslegte, als er das Brodeln des Wasserkochers hörte und erkannte, dass seine Mutter ihm ein Fläschchen zubereitete.
Paul gähnte herzhaft, als Sara ihn samt Babyschale aus dem Auto holte. In der vergangenen Dreiviertelstunde hatte er sich bitterlich über den engen Kindersitz beschwert, in dem er die siebzig Kilometer von Düsseldorf bis hierher gesessen hatte.
Sara hatte zunächst über die Freisprechanlage versucht, ihrem Vater in Thailand die beruhigenden Neuigkeiten mitzuteilen. Ein unmögliches Unterfangen. Am Rasthof Geismühle bei Krefeld hielt sie schließlich an, knallte die Autotür von außen zu und ließ Paul allein zurück. Als sie sein wütendes Gesichtchen sah, spürte sie eine Mischung aus Genugtuung und schlechtem Gewissen. Sie telefonierte in seinem Sichtfeld erneut mit ihrem Vater, winkte Paul manchmal lächelnd zu, was den Kleinen lediglich dazu ermunterte, mit neuer Wucht loszuschreien. Er beruhigte sich erst, als sie auf den Parkplatz der Burg Winnenthal einbogen und zum Stehen kamen. Sara wollte auf dem Weg zum Krankenhaus noch schnell nach ihrem Opa sehen, der zwar körperlich unversehrt war, am Telefon aber sehr aufgebracht geklungen hatte.
Die alte Wasserburg hatte das Feuer fast ohne sichtbare Schäden überstanden. Lediglich am rechten Türmchen der Vorburg erkannte Sara schwarze Spuren an der Außenwand. Unglaublich, dachte sie, was alte Steine alles aushalten. Und tatsächlich, auch als sie ins Innere trat, stellte sie fest, dass das Leben auf der Burg schon fast wieder seinen gewohnten Gang ging. Der rechte Flügel wurde noch gereinigt, das Löschwasser musste abgepumpt werden, aber in den Fluren des Ostflügels, in dem auch ihre Großeltern wohnten, sah man keine Spuren des nächtlichen Brandes. Ohne jemandem vom Heimpersonal zu begegnen, nahm sie den Aufzug in den zweiten Stock und klingelte am Apartment ihrer Großeltern. Sie hatte einen Schlüssel, benutzte ihn aber nur auf Aufforderung. Hinter der Tür hörte sie ihren Großvater rufen: »Ich komme schon.« Er klang kraftvoll, und so sah er auch aus, dachte Sara, als er die Tür öffnete. Seine Wangen waren rosig, er war akkurat gekämmt und gekleidet, auf den ersten Blick ließ nichts an ihm auf eine dramatische Nacht schließen.
»Wie geht es dir, Opa?«, fragte Sara.
»Frag lieber nicht«, antwortete er. »Ich habe kaum geschlafen. Wir können hier nicht bleiben. Wir sind hier nicht sicher.« Sara lächelte nachsichtig. Er war schon immer übervorsichtig und ängstlich gewesen. »Es ist ja alles noch mal gut gegangen«, sagte sie beschwichtigend.
»Nichts ist gut. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu«, insistierte ihr Großvater. »Willst du damit sagen, dass es hier ein Burggespenst gibt?«, fragte sie lachend. Ihr Großvater blieb ernst. »Das war kein Unfall«, beharrte er. Sara legte ihm die Hand auf den Arm. »Opa, beruhige dich. Frau Strunk grämt sich sehr. Sie sagt, sie hätte besser auf den Herrn aufpassen müssen. Das wird ihr sicher nicht noch einmal passieren.«
»Das hat der arme Pitt nicht verdient.« Saras Opa schüttelte traurig den Kopf. Dann ging er langsam neben Paul in die Hocke und streichelte dem Kind, das ungewöhnlich friedlich in der Babyschale lag, sanft die Wange. »Das hat er nicht verdient«, wiederholte er noch einmal. Er holte seinen Schlüsselbund aus der Gesäßtasche und schüttelte ihn vor Pauls Gesicht. Der lächelte, und sein Uropa war zufrieden. Bald darauf verabschiedete Sara sich wieder, packte für ihre Oma noch einen Morgenmantel ein und machte sich auf den Weg ins Krankenhaus nach Xanten.
Keine Viertelstunde später stand Sara mit Paul im Sankt Josef-Hospital vor Zimmer 225 und klopfte.
»Herein«, hörte sie im Zweiklang und trat ein. Ihre Oma lag in einem Mehrbettzimmer zusammen mit einer Dame, die Sara schon einmal gesehen hatte, deren Namen ihr allerdings nicht einfiel. »Du erinnerst dich doch sicher an Lili Heinemann«, sagte ihre Oma. »Selbstverständlich«, log Sara höflich. Sie ging freundlich auf die Bettnachbarin zu und reichte ihr zur Begrüßung die Hand. Bevor sie ihre Großmutter herzte, stellte sie den schlafenden Paul samt Babyschale in einen Rollstuhl und richtete ihn so aus, dass Ruth ihren Urenkel sehen konnte. »Was macht ihr denn für Sachen!«, sagte sie anstelle einer Begrüßung.
»Och, nicht der Rede wert«, winkte ihre Oma ab und richtete sich auf, um ihren Paul besser sehen zu können. »So ein Engelchen«, schwärmte sie in Richtung ihrer Bettnachbarin. »Unser Paul ist wirklich ein unglaublich liebes Kind, den hört man nie weinen. Er ist immer so glücklich und zufrieden.« Sara verkniff sich einen Kommentar und schaute zu ihrem Sohn, der im Schlaf engelsgleich lächelte. Satansbraten, dachte sie. »Du kannst von Glück reden, Kindchen!«, hob ihre Oma wieder an. »Dein Vater hat sich in dem Alter die Seele aus dem Leib geschrien, Tag und Nacht, ich habe ein ganzes Jahr kaum geschlafen.« Sie saß bereits auf der Bettkante und schickte sich an, den Jungen zu knuddeln. »Nichts da, Oma. Du bleibst mal schön im Bett, sonst wird dir noch schwindlig. Und lass den Kurzen lieber schlafen.« Ihre Großmutter gehorchte widerwillig. »Schätzchen, dann erzähl doch mal, was gibt es Neues bei dir?«
»Oma, wir haben uns Sorgen um euch gemacht. Papa denkt darüber nach, zurückzufliegen«, sagte sie.
»Ach, so ein Unsinn. Mir geht es gut. Und selbst wenn nicht, würde ich nicht wollen, dass Chi meinetwegen den Familienbesuch abbrechen muss.« Ruth wandte sich an ihre Bettnachbarin. »Mein Sohn ist mit einer Thailänderin verheiratet. Er hat sie bei der Arbeit kennengelernt. Sie ist Krankenschwester, und Sie wissen ja, dass mein Sohn Herzchirurg ist.«
Sara musste grinsen. Ihre Großmutter war unglaublich stolz auf ihren einzigen Sohn, und sie verpasste keine Gelegenheit, es der ganzen Welt mitzuteilen. Sie war zudem eine leidenschaftliche Anekdotenerzählerin, und daher ahnte Sara sofort, auf welche Geschichte es nun hinauslaufen würde.
Etwa zehn Jahre nach der Trennung von Saras Mutter hatte ihr Vater Chi kennengelernt. Seine Familie nahm sie herzlich auf. Einzig Saras Oma machte sich anfangs Sorgen um ihn, denn als Chi zum ersten Mal die Familie ihres Ehemannes bekochte, hielt sie sich an traditionelle thailändische Rezepte. Im Hause van Rennings, also vor allem bei Walter und Ruth, galten sogar Nudeln als exotisch. Am Niederrhein aß man Kartoffeln, und zwar entweder in guter Butter kross gebraten oder mit nem Emmerken Sauß, wie ihre Oma zu sagen pflegte, also mit Soße, oder untereinander, das bedeutete, mit irgendetwas von Endivien bis Äpfeln zusammengematscht. Und was die Würze der Speise anging, konnte allerhöchstens der Salzstreuer ausrutschen, wenn es mal richtig schiefging. Das wusste Chi natürlich, als sie der Familie grünes Curry auftischte. Und natürlich hatte sie, um die Schärfe zu mildern, nur die Hälfte der sonst üblichen Menge Chili verwendet. Dennoch endete das Antrittsmenü in einem Desaster. Walter, der sich an den niederrheinischen Spruch Wat de Buhr niet kennt, dat frette niet hielt, fischte nur das heraus, was er zu kennen glaubte und besonders mochte: die Schnibbelbohnen.
Noch ehe Chi ihn warnen konnte, hatte er sich bereits eine ordentliche Gabel voll in den Mund gestopft.
»Sie können sich Walters Gesicht nicht vorstellen«, juchzte Saras Oma zu ihrer Bettnachbarin gewandt. »Als Erstes wurden seine Ohren rot. Ehrlich, ich habe seine Ohren noch nie so leuchten sehen. Sie haben regelrecht geglüht, als hätte man Lämpchen darin angezündet.«
Nun musste auch Sara lachen, obgleich die Situation damals wirklich nicht komisch gewesen war. Ihr Opa hatte ausgesehen, als hätte er die Hölle verschluckt. Da er aber auf Manieren Wert legte, spuckte er die Chilis nicht etwa aus, sondern hielt tapfer die Hand vor den Mund, während ihm Schweißperlen auf die Stirn traten und Tränen über die Wangen liefen. Er vermied es, zu kauen, und hoffte offenbar, dadurch jeglichen weiteren Kontakt der Chilis mit seiner Mundschleimhaut zu vermeiden.
»Spuck aus. Spuck aus«, rief Chi. Walter jedoch hielt es vor lauter Höflichkeit noch eine ganze Weile unter Qualen aus, bis er die Chilis endlich doch ausspie. Er röchelte, sein Gesicht war hochrot, und Sara befürchtete einen Kreislaufkollaps. Nur Saras Vater blieb ruhig. Er blickte seiner Mutter in die Augen, bevor er ganz langsam aufstand, zum Kühlschrank ging und seinem Vater ein Glas Milch einschenkte. »Hier, trink das. Das nimmt die Schärfe.« Er lächelte, und Sara entdeckte zum ersten Mal in ihrem Leben einen Hauch von Sadismus in seinen Zügen. Chi war am Boden zerstört, doch Ruth hatte sie getröstet und sich noch einen Nachschlag genommen, wobei sie jedes einzelne Reiskorn umdrehte, um nur ja nichts Scharfes zu erwischen. Die Chilis schob sie allerdings sorgsam an den Tellerrand. »Noch jemand ein Böhnchen?«, flötete sie dabei mit diebischer Freude und erntete einen bösen Blick von Walter, der sich erst nach drei Gläschen Reiswein wieder beruhigte.
Die Zimmernachbarin lachte lauthals. Ruths Anekdote hatte ihre Wirkung nicht verfehlt.
»Weißt du eigentlich, wie es auf der Burg aussieht?«, erkundigte sich die Dame bei Sara, nachdem sie sich wieder gefangen hatte.
»Die meisten Apartments sind schon wieder bewohnbar. Lediglich im Westflügel gibt es noch ein paar Probleme wegen des Löschwassers«, erklärte Sara. »Der Trakt im alten Herrenhaus, in dem die Sozialräume sind, ist beinahe unversehrt.«
»Das ist schön«, sagte Lili Heinemann zu Saras Oma. »Dann müssen wir mit dem Singkreis nicht so lange aussetzen. Das ist schließlich unser Jubiläumsjahr, und da wollen wir doch an Heiligabend zeigen, was wir können.«
Sara sah ihre Großmutter eifrig nicken. Ihre Oma liebte es, zu singen. Sie war ganz begeistert von dem Singkreis im Seniorenheim.
»Bevor ihr wieder Arien schmettert, erholt ihr euch aber bitte noch ein bisschen«, lachte sie. »Das soll ich dir auch von Opa ausrichten. Er macht sich große Sorgen um dich.«
Ihre Großmutter verdrehte die Augen. »Quatsch. Der macht sich höchstens Sorgen, dass er kein Frühstück bekommt. Aber da muss er jetzt mal selber ran. Ich kann ja schlecht Schwester Carmen anrufen und ihr bis ins kleinste Detail erklären, wie sie sein Dubbel morgens und abends zuzubereiten hat.«
»Lass mal, Oma. Dein Mann ist schon noch in der Lage, sich selbst ein Butterbrot zu schmieren. Der ist topfit.«
Wieder verdrehte ihre Oma die Augen. »Wenn du wüsstest. Er ist wahnsinnig unselbstständig. Immer schon gewesen. Aber er hat’s ja auch nie gelernt. Seine Mutter hat immer alles für ihn gemacht, bis er geheiratet hat.« Sie machte eine Pause. »Und dann hab ich das übernommen.«
»Damit ist es nun vorbei«, hörte Sara aus dem Nachbarbett. »Das ist endgültig vorbei.«
Sie hatte keine Ahnung, wovon Frau Heinemann sprach. Ihre Oma bedeutete Sara, sie möge näher treten, um ihr etwas zu sagen. Sara zögerte. Ihre Großmutter hörte schlecht, was sie aber, wie viele Schwerhörige, nicht wahrhaben wollte. Wenn sie Sara etwas zuflüsterte, sprach sie meist so laut, dass es für jeden Normalhörenden wie ein heiseres Rufen klang. So auch diesmal: »Weißt du nicht, wer das ist? Der Mann von Frau Heinemann ist im Feuer … krxxz!« Bei dem letzten Geräusch machte Ruth van Rennings ein Auge zu, ließ die Zunge raushängen und fuhr mit der flachen Hand vor ihrem Hals entlang. »Oh mein Gott«, entfuhr es Sara, der der Name des Verunglückten zwischenzeitlich entfallen war. Sie wusste selbst nicht, ob sich ihr Ausruf auf die Peinlichkeit der Situation oder ihr Mitgefühl bezog. Sie wandte den Kopf vorsichtig nach rechts, wo sie Frau Heinemann gequält lächeln sah. »Entschuldigen Sie bitte, Frau Heinemann, ich … ich meine … mein herzliches Beileid«, stammelte sie.
»Nenn mich Lili, Kindchen. Ruth, das gilt auch für dich. Ich finde, Frau Heinemann trifft es nicht mehr.«
Sara räusperte sich. Sie trat an das Bett der alten Dame und ergriff ihre Hand: »Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann sagen Sie es bitte.«
»Du musst kein Mitleid mit mir haben, Kindchen, ich bin ja selbst schuld«, sagte Frau Heinemann, und Sara wunderte sich über ihre Gefasstheit. Sie vermutete, dass die alte Dame noch unter Schock stand.
»Sie dürfen so etwas nicht denken, Frau … Lili! Wann werden denn Ihre Angehörigen eintreffen, wer kümmert sich um Sie?«
»Das werden wir tun«, flüsterte Saras Oma ihr nun wieder in einer Lautstärke zu, die sicher bis auf den Krankenhausflur zu hören war, und Sara schüttelte ermahnend den Kopf. »Die Heinemanns haben nur einen Sohn, und der ist verschollen«, fuhr ihre Oma unbeirrt fort. »Aber die Betreuer im Heim machen das toll. Die sind wirklich alle sehr liebevoll. Und mit Beerdigungen kennen die sich aus.«
»Oma, bitte!«, sagte Sara scharf.
»Wir hatten immer mal wieder übers Einäschern gesprochen«, meldete sich Lili Heinemann in diesem Moment zu Wort. Der Satz traf Sara völlig unerwartet. Ein Lachen blieb ihr in der Kehle stecken, und sie versuchte krampfhaft, es durch einen Hustenanfall zu kaschieren. Frau Heinemann war die makabre Ironie nicht entgangen.
»Das musste er natürlich gleich wörtlich nehmen«, murmelte sie. »Man wird die Urne wohl auf dem Veener Friedhof beisetzen. Wahrscheinlich ohne mich, ich komme hier so schnell nicht raus. Meine Lunge hat die Kälte nicht gut vertragen.«
»Was ist denn mit Ihrem Sohn?«, fragte Sara vorsichtig. »Sollten wir nicht versuchen, ihn ausfindig zu machen? Er wird doch sicher zur Beerdigung kommen wollen.« Frau Heinemann lachte bitter. »Wenn ich unter die Erde komme, vielleicht. Aber bei Pitt … Nein, keiner aus der Familie wird bei der Beerdigung dabei sein.«
Sara traute sich nicht, weiter nachzufragen. Konflikte zwischen Vater und Sohn kannte sie zur Genüge. Auch Saras Vater hatte für ihren Opa nur wenig übrig. Einige Male hatten sie sich deswegen gestritten, weil sie seine Kälte ihm gegenüber kaum ertragen konnte. Aus ihrer Sicht war ihr Großvater ein liebenswerter alter Herr, der für seine fast neunzig Jahre noch sehr fit auf den Beinen war, sich ausgesprochen charmant verhielt und einen klaren Blick auf die Welt hatte. Sie wandte sich wieder an Lili Heinemann: »Ich werde das mit der Heimleitung klären. Man wird mit der Beerdigung sicher warten können, bis Sie entlassen werden. Wenn Sie mögen, kümmere ich mich darum.«
»Lass nur! Ich bin sicher, den letzten Weg schafft er auch ohne mein Geleit.« Sara konnte den Gesichtsausdruck der alten Dame nicht recht deuten. Menschen trauern eben auf sehr unterschiedliche Weise, dachte sie.
»Früher war das ganz normal«, riss Ruth sie aus den Gedanken.
»Was?«
»Na, dass Frauen nicht mit zur Beerdigung gingen. Ich kann mich noch an die Beerdigung meines Großvaters erinnern, da war ich vielleicht vier oder fünf, also war das 1933 oder 1934. Da durfte meine Oma gar nicht hinter dem Sarg herlaufen.«
»Wirklich?«, fragte Sara. »Deine Oma durfte ihren eigenen Mann nicht beerdigen?«
»Ich erinnere mich noch sehr genau daran: Die Herren trugen alle Zylinder, und als sie bei meiner Großmutter am Laden vorbeikamen, salutierten sie und hoben kurz ihre Kopfbedeckungen, um ihr Respekt zu zollen. Aber zum Friedhof durfte sie nicht. Ich habe in meinem alten Fotoalbum noch die Traueranzeige von Opa, da steht explizit drauf: ›Ohne Frauenbeteiligung‹.«
Sara schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ts, ts«, machte Paul in diesem Moment, vermutlich weniger, um seine Empörung auszudrücken, als vielmehr, um sein Erwachen anzukündigen. Er würde Hunger haben, und Sara hatte nichts dabei. Rabenmutter, schalt sie sich. »Hast du vielleicht ein Stück Brot hier, an dem Paul lutschen kann?«, fragte sie ihre Großmutter, doch die verneinte. »Aber die Cafeteria hier ist wirklich gut. Ich habe selten so leckeren Kuchen in einem Krankenhaus gegessen.«
Ruth van Rennings hatte wegen ihres chronischen Rheumas schon in so vielen Krankenhäusern gelegen, dass sie einen Klinikführer hätte schreiben können. Ihre Bewertungskategorien erstreckten sich von medizinischer Kompetenz, die sie glaubte beurteilen zu können, über Fürsorglichkeit des Pflegepersonals, Zimmerausstattung, wobei Zimmernachbarn mit zur Ausstattung gerechnet wurden, bis hin zu Speisen und Getränken. Sara lächelte ihre Oma an.
»Na dann gehe ich da noch schnell hin, bevor wir losfahren. Lars will heute für uns beide kochen, da möchte ich pünktlich sein.« Sie gab ihrer Oma einen Abschiedskuss auf die Wange.
»Du hast wirklich Glück mit deinem Mann. Walter hat den Herd kein einziges Mal auch nur berührt.«
»Also ganz ehrlich: Wenn ich so kochen könnte wie du, würde Lars den Herd auch nicht anfassen«, lachte Sara.
»Dann muss ich dir wohl meine Rezeptsammlung vermachen, damit ihr zwei endlich mal heiratet. Denn wie heißt es so schön: Liebe geht durch den Magen.«
»Das hat bei euch ja ganz offensichtlich funktioniert«, sagte Sara.
»Das kann man wohl sagen. Nächsten Monat feiern wir nämlich Eiserne Hochzeit«, wandte Ruth sich an ihre Zimmergenossin, »wir sind dann fünfundsechzig Jahre verheiratet.« Sara zuckte zusammen. Ihre Oma hatte manchmal das Feingefühl eines Elefanten im Porzellanladen. Doch erneut schätzte sie die Witwe Heinemann falsch ein. »Da gratuliere ich aber«, sagte diese trocken, fast ein wenig spöttisch, »darauf trinken wir dann zusammen das ein oder andere Fisternölleken.«
»Was bitte?«, fragte Sara.
»Wie? Dat kennste nich?«, fragte Saras Oma mit gespielter Überraschung. »Dann wird es aber Zeit. Für ein Fisternölleken nimmst du ein Pinneken Klaren, tust ein Stück Zucker rein und ein paar Rosinen, und dann hopp hopp, rin inne Kopp. Das haben wir früher oft getrunken. Aber Walter verträgt das nicht mehr. Und der ist ja sowieso nicht so fürs Feiern«, seufzte sie.
»Ja, aber das können wir ihm doch nicht durchgehen lassen. Der Singkreis wird schon dafür sorgen, dass es ein würdiges Fest wird. Ich verspreche dir hoch und heilig: Wir Frauen werden da sein.« Frau Heinemann hatte mit enormem Pathos gesprochen, und Saras Oma lächelte glücklich.
* Februar 1941 *
Ruth platzte fast vor Stolz, als sie den Karton aufmachte und ihre neuen Schlittschuhe auspackte. Sie würde aussehen wie Fräulein Hoppla, die berühmte norwegische Eiskunstläuferin, die viele Medaillen gewonnen hatte. An den eigentlichen Namen der Sportlerin konnte Ruth sich nicht erinnern, sie wusste nur, dass Fräulein Hoppla als elfjähriges Mädchen an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte und, als sie auf den Po gefallen war, »Hoppla« gerufen hatte. Heute war Ruths Geburtstag, sie wurde zwölf. Mit fünfzehn war Fräulein Hoppla schon Olympiasiegerin geworden. Ob sie das noch schaffen könnte? Sie würde von nun an fleißig trainieren, nahm sie sich vor und hüpfte ihrer Großmutter in die Arme. »Danke, Oma. Du bist die Beste! Immer bekomme ich die allerschönsten Geschenke von dir. Wollen wir auf den Altrhein und die Schlittschuhe gleich ausprobieren?«
Ruth wurde nach der Schule von ihrer Großmutter betreut, ihre Eltern arbeiteten im Kaufhaus in Xanten, wo sie täglich mit dem Auto hinfuhren, obwohl man die drei Kilometer auch zu Fuß hätte gehen können, wie Ruth es jeden Morgen tat, um zum Gymnasium zu gelangen. In dem Kaufhaus gab es Anziehsachen für Damen, aber auch Kurzwaren und Puppen, die Ruths Mutter selbst bastelte. Der Urgroßvater hatte das Geschäft 1890 gegründet, und es war seitdem in Familienhand. Bis vor Kurzem hatte es sogar zwei Geschäfte gegeben, ein weiteres noch in Wesel, aber der Krieg hatte die Leute so verarmen lassen, dass sie es hatten schließen müssen. So hatte es ihr zumindest der Vater erklärt. Ihr Vater erklärte ihr immer alles. Er hatte eigentlich Lehrer werden wollen, deshalb hatte er sogar an der Universität studiert. Sein älterer Bruder hätte das Kaufhaus Maaßen übernehmen sollen, doch dann kam alles anders.
Ihr Onkel Ralf Maaßen war Anfang der Zwanzigerjahre nach Hamburg gegangen, um im großen Kontorhaus seine Ausbildung zu machen. Er war ein kluger Kaufmann und mit seiner Lehre fast fertig, als das Unheil geschah: Mehrere Lehrjungen trieben nach Feierabend Unsinn und spielten im Paternoster, dem ersten, der je auf europäischem Festland gebaut wurde, wie Ralf seinem Bruder stolz mitgeteilt hatte. Die Familie erfuhr nie, wie es sich genau zugetragen hatte, aber offensichtlich geriet Ralf so unglücklich zwischen Geschossboden und Paternoster, dass sein Kopf vom Rumpf getrennt wurde. Nach einem Jahr der Trauer wurde schließlich Ruths Vater von seinem Studium zurückgerufen und zum künftigen Ladeninhaber bestimmt. Er musste seine Träume vom Lehrerberuf aufgeben.
Auch Ruth ging gern zur Schule. Von ihrem Vater hatte sie nicht nur die Wissbegierde geerbt, sondern auch eine schöne Gesangsstimme. Er sang im Kirchenchor, und Ruth wünschte sich sehr, eines Tages, so wie er, die Weihnachtskantate im Dom singen zu dürfen. Ruth hatte kastanienbraune Haare, auch darin glich sie ihrem Vater, die ihr in dicken, geflochtenen Zöpfen fast bis zur Taille reichten. Dazu grüne Augen. Die seien von der Mama, sagte ihre Großmutter immer und fügte hinzu, Ruth hätte sich von beiden Elternteilen das Beste ausgesucht. Die Großmutter sprach es nicht aus, aber sie betete täglich, dass ihre Enkelin nicht auch eines Tages an der schweren Krankheit würde leiden müssen, die Generationen von Maaßens geplagt hatte: Rheuma. Ruth hörte ihren Vater manchmal vor Schmerzen schreien. Seine Handknöchel waren dann wochenlang rot und geschwollen. Ihre Oma machte sich Sorgen, wenn Ruths Knie beim Beugen knackten, und hoffte, durch viele Leibesübungen einem Ausbruch der Krankheit vorbeugen zu können. Deshalb wohl auch diese wundervollen Schlittschuhe. »Komm, lass uns zum Altrhein gehen«, bat Ruth erneut.
Oma und Enkelin liefen eine halbe Stunde lang über den Xantener Berg, bis sie schließlich in Birten den Altrhein erreichten. Ruth liebte diesen Ort. Im Sommer kam sie manchmal an den Wochenenden, wenn das Geschäft geschlossen war, mit der ganzen Familie, mit den Eltern und der Oma nach dem Kirchgang hierher, um in der Natur zu picknicken. Ruths Mutter hatte dann einen Korb mit zahlreichen Leckereien dabei: Stuten und Kuchen und Schwarzbrot, dazu Würste und Kartoffelsalat mit Eiern. In der Hoffnung, etwas von dem Festmahl abzubekommen, näherten sich Enten, Gänse und sogar Kormorane bis auf Armeslänge. Ruth beobachtete die schimmernden Gefieder, um sie abends zu Hause nachzumalen. »Du musst mir etwas versprechen, mein kleines Mädchen«, flüsterte ihr Vater dann. »Versprich mir, dass du dein Abitur machst. Vielleicht kannst du Biologielehrerin werden. Willst du mir den Gefallen tun?« Ruth sah ihn jedes Mal mit heiligem Ernst an, legte die Hand aufs Herz und gelobte feierlich: »Ja, Papa, ich schwöre es.« Es war ein Ritual zwischen ihnen geworden, und Ruth hoffte insgeheim, sie könnte vielleicht sogar Ärztin werden und ein Heilmittel gegen die Krankheit ihres Vaters finden.
Manchmal baute Ruths Vater am Altrhein aus einem langen Stock und einem Stück Zwirn eine Angelrute. Dann drehte er einen Stein um, zog den nächstbesten Wurm, der nicht rechtzeitig in sein Erdloch geschlüpft war, hervor, steckte das arme Viech an eine Sicherheitsnadel und angelte mit unfassbarer Geduld. Und tatsächlich gelang es ihm das eine oder andere Mal, mit diesem notdürftigen Gerät kleine Schleien zu fangen, die sich in dem Gewässer zu Tausenden tummelten. Der Alte Fritz hatte vor mehr als hundert Jahren dieses Idyll geschaffen. Er hatte den Bislicher Graben bauen lassen und den Rhein damit begradigt. Und aus dem alten Flusslauf war eine Auenlandschaft entstanden, mit vielen hübschen Kopfweiden, die so typisch für den unteren Niederrhein waren. Ein Paradies für Fische, Vögel und Menschen. Im Winter, wenn harter Frost auf den Herbstregen folgte, waren der alte Rheinarm und die angrenzenden überfluteten Wiesen fast bis zum neuen Rheinlauf nach Wesel von einer dicken Eisschicht bedeckt. Und jeder, der Schlittschuhe oder auch nur glatte Sohlen hatte, kam nachmittags hierher, um sich zu vergnügen. Der Sonsbecker Metzger Theo Scholten, genannt der dicke Thei, hatte eine besondere Geschäftsidee entwickelt: Er stellte einen großen Einmachbottich mit heißem Wasser und Würstchen darin auf seinen Schlitten, zog ihn hinter sich her über das Eis und rief mit donnernder Stimme: »Rutscht nicht vorbei – ohne ’ne Wurst vom dicken Thei.«
»Oma, wenn der dicke Thei da ist, essen wir dann eine Wurst bei ihm?«, fragte Ruth, während sie sich die Schlittschuhe zuschnürte. Ihre Großmutter schnaufte verächtlich. Ruth erschrak, hatte sie zu viel verlangt? Schlittschuhe, eine Geburtstagstorte und eine Wurst waren vielleicht zu viel der Wünsche. Sie schämte sich sofort, zumal ihre Eltern ihr immer wieder einbläuten, sie müsse sich glücklich schätzen, dass es ihnen trotz des Krieges so gut gehe. Sie wollte gerade ansetzen, sich zu entschuldigen, als sie erkannte, dass die Verachtung ihrer Großmutter einer Gruppe Uniformierter galt. Es waren junge Burschen in braungrünen Mänteln mit zwei Knopfreihen, Gürtel und einer Hakenkreuzbinde am Arm, die in Zweiergrüppchen über das Eis marschierten. Als sie an ihnen vorbeistolzierten, hoben sie zackig den rechten Arm und grüßten lauthals »Heil Hitler, Frau Maaßen«. Sie sahen dabei aus wie Marionetten, fand Ruth. Ihre Großmutter starrte den jungen Männern hinterher und rief ihnen ein wütendes »Grüß Gott, Heinzi« hinterher. Ruth sah, wie einer der Männer sich kurz umdrehte und ihrer Oma einen merkwürdigen Blick zuwarf. Er schickte sich an, zurückzukommen, doch die anderen zogen ihn mit sich fort. »Warum hast du den Mann so seltsam begrüßt?«, fragte Ruth.
»Der Heinzi weiß schon, warum ich das gesagt habe. Seine Großeltern kommen aus Bayern, dort sagt man zur Begrüßung nicht ›Guten Tag‹, wie bei uns, sondern ›Grüß Gott‹. Und ich finde, dass man ihn daran erinnern sollte, wo er herkommt, dieser Hitlerschnösel. Aber nun lass gut sein, Mädchen, zeig mir, wie schön du schon auf Kufen laufen kannst. Und dann kauf ich dir eine leckere Wurst.« Ruth hatte schon oft Diskussionen der Erwachsenen verfolgt, die voller Sorgen waren. Die Eltern lehnten den Krieg ab, ebenso die Nazis, aber wenn sie davon sprachen, so redeten sie immer leise und vorsichtig, denn die Nazis hatten Geld und waren ihre Kunden.
Das letzte Stück Wegs bis zum Geschäft der Eltern liefen sie schweigend nebeneinanderher. Ruth wurde dabei immer schneller, sie konnte es kaum erwarten, ihren Eltern von ihrem Ausflug zu erzählen. Und so flog sie ihrer Mutter in die Arme, als sie ankamen, und erzählte freudig drauflos. Erst ein selbst gebackener Keks stoppte ihren Redefluss, sie ging damit nach hinten in den Laden zum Puppenregal und genoss jeden Bissen.
Heil Hitler.Guten Tag.Auf Wiedersehen.
Guten Tag.
»Was Recht ist, muss Recht bleiben. Glaubst du, ich habe Angst vor dem? Ist doch lächerlich. Der ist noch nicht mal ganz trocken hinter den Ohren«, entgegnete Ruths Großmutter. »Wenn dein Vater dich so sehen könnte, würde er dir eine Tracht Prügel versetzen. Diese Leute sind Verbrecher. Mit denen macht man keine Geschäfte.«
Als sie wieder zu sich kam, lag sie in ihrem Bett, die Mutter saß auf dem Matratzenrand und tupfte ihr die Stirn mit einem Waschlappen ab.
»Was ist geschehen, Mama?«