Nichts als Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marie Rahn
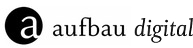
Hinter Christina Lauren verbergen sich Christina Hobbs und Lauren Billings. Lauren ist promovierte Neurowissenschaftlerin und Mutter zweier kleiner Kinder. Christina wuchs in Utah auf und ist bei weitem nicht alt genug, die Mutter einer 16-jährigen Tochter zu sein. Nach mehr als einem Dutzend Bestsellern im Bereich Young Adult legen sie hier nun ihren ersten Liebesroman für Erwachsene vor, der in den USA bereits für Furore sorgte.
Marie Rahn studierte an der Universität Düsseldorf Literaturübersetzen. Sie übersetzt aus dem Französischen, Italienischen und Englischen, u.a. Lee Child, Aldo Busi, Kristin Hannah, Silvia Day und Sara Gruen.
Manchmal braucht man … nichts als Liebe.
Macy führt ein Leben, in dem sie keine großen Gefühle riskieren muss. Sie ist mit einem netten Mann zusammen, den sie heiraten wird, und versinkt in ihrer Arbeit als Kinderärztin. Dann läuft ihr Elliot über den Weg – der ihre erste Liebe war. Schon bald bekommt Macys sorgsam errichtete Fassade Risse. Denn einst bedeutete Elliot ihr die ganze Welt – bis er ihr für alle Zeiten das Herz brach. Nun, elf Jahre später, sind sie einander fremd geworden, zu viel ist passiert, was sich nicht mehr gutmachen lässt. Oder ist da noch etwas zwischen ihnen, das ihnen die Kraft gibt, die Vergangenheit zu überwinden?
Ein Roman über das ganze Glück, aber auch den ganzen Kummer, den die Liebe manchmal für uns bereithält.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Nichts als Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marie Rahn
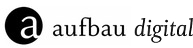
Inhaltsübersicht
Über Christina Lauren
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Heute – Dienstag, 3. Oktober
Damals – Freitag, 9. August
Heute – Dienstag, 3. Oktober
Damals – Freitag, 11. Oktober
Heute – Mittwoch, 4. Oktober
Damals – Donnerstag, 20. Dezember
Heute – Mittwoch, 4. Oktober
Damals – Freitag, 21. Dezember
Heute – Donnerstag, 5. Oktober
Damals – vor vierzehn Jahren
Heute – Donnerstag, 5. Oktober
Damals – Donnerstag, 13. März
Heute – Donnerstag, 5. Oktober
Damals – Montag, 28. Juli
Heute – Freitag, 6. Oktober
Damals – Mittwoch, 26. November
Heute – Freitag, 13. Oktober
Damals – Mittwoch, 31. Dezember
Heute – Samstag, 14. Oktober
Damals – vor zwölf Jahren
Heute – Samstag, 14. Oktober
Damals – Samstag, 9. Juli
Heute – Samstag, 14. Oktober
Damals – Samstag, 10. September
Heute – Donnerstag, 26. Oktober
Damals – Samstag, 17. Januar
Heute – Mittwoch, 8. November
Damals – Samstag, 3. Juni
Heute – Mittwoch, 8. November
Damals – Mittwoch, 12. Juli
Heute – Donnerstag, 23. November
Damals – Freitag, 25. August
Heute – Donnerstag, 23. November
Damals – Vor elf Jahren
Heute – Sonntag, 31. Dezember
Damals – Samstag, 9. September
Heute – Sonntag, 31. Dezember
Damals – Freitag, 8. Dezember
Heute – Sonntag, 31. Dezember
Damals – Samstag, 31. Dezember
Heute – Sonntag, 31. Dezember
Damals – Sonntag, 1. Januar
Heute – Sonntag, 31. Dezember
Damals – Sonntag, 1. Januar
Heute – Montag, 1. Januar
Heute – Mittwoch, 10. Januar
Impressum
Leseprobe aus: Kristin Hannah – Die andere Schwester
Für Erin und Marcia
und das Haus am Bach im Wald
Mein Vater war viel größer als meine Mutter, und zwar beträchtlich. Er war 1,96 m, während sie höchstens 1,60 m maß. Ein dänischer Riese und ein brasilianisches Püppchen. Als sie sich kennenlernten, sprach sie kein Wort Englisch. Als sie starb – da war ich zehn –, hatten sie so etwas wie eine eigene Sprache entwickelt.
Ich weiß noch, wie er sie jedes einzelne Mal umarmte, wenn er nach Hause kam. Er beugte sich mit dem ganzen Körper über sie und vergrub sein Gesicht in ihren Haaren, und sie verschwand fast vollständig in dieser innigen Umarmung. Seine Arme waren wie zwei Klammern um einen Satz voll heimlicher Koseworte.
Ich hielt mich in diesen Momenten stets im Hintergrund, hatte ich doch das Gefühl, Zeugin von etwas Unantastbarem zu sein. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass Liebe etwas anderes sein könne als überwältigend. Und schon als ich ein Kind war, war klar, dass ich mich niemals mit weniger zufriedengeben würde.
Aber nachdem das, was als Wucherung bösartiger Zellen begann, meine Mutter getötet hatte, hätte ich viel darum gegeben, keine Liebe mehr zu empfinden, nie mehr. Meine Mutter zu verlieren gab mir das Gefühl, in all der Liebe zu ertrinken, die in mir war und die ich ihr nicht mehr geben konnte. Diese Liebe staute sich in mir an, ließ meinen Atem stocken wie ein übler Geruch und entlud sich erst in Tränen und Schreien, dann in Schweigen, das tonnenschwer auf mir lastete. Aber so weh es mir auch tat, verstand ich doch, dass es meinem Vater noch viel schlimmer erging.
Ich wusste, dass er sich nach meiner Mutter in keine andere Frau mehr verlieben würde. Was das betraf, war mein Vater ein offenes Buch für mich. Er war ein so geradliniger wie leiser Mann. Er bewegte sich leise, redete leise; selbst wenn er zornig war, blieb er stets leise. Einzig seine Liebe war laut und dröhnend wie ein ohrenbetäubendes Brüllen. Und nachdem er meine Mutter mit all seiner Kraft geliebt und der Krebs sie ihm dennoch genommen hatte, wusste ich, dass er den Rest seines Lebens still bleiben und nie wieder einer Frau so nahe sein würde, wie er ihr nahe gewesen war.
*
Bevor meine Mutter starb, hinterließ sie Dad eine Liste mit Ratschlägen, von denen sie meinte, dass sie ihm und mir auf dem Weg zum Erwachsenwerden hilfreich sein würden.
Verwöhn sie nicht mit Dingen, gib ihr stattdessen Bücher.
Sag ihr oft genug, dass Du sie liebst. Mädchen brauchen Worte.
Wenn sie still und in sich gekehrt ist, übernimm du das Reden.
Gib Macy ein regelmäßiges Taschengeld, das nicht zu knapp bemessen ist, aber lass sie stets einen Teil davon sparen, damit sie den Wert des Geldes begreift.
Bis sie sechzehn ist, sollte sie immer um zehn Uhr abends zu Hause sein. Ohne Ausnahme.
Die Liste war ellenlang und umfasste mehr als fünfzig Punkte. Es war nicht so, dass Mom meinem Vater misstraute; sie wollte nur, dass ihr Einfluss als Mutter auch nach ihrem Tod für mich spürbar bliebe.
Mein Vater las die Ratschläge immer wieder, schrieb sich mit Bleistift Anmerkungen daneben und unterstrich einzelne Punkte, um sicherzustellen, dass er nichts Wichtiges übersah oder falsch verstand. Im Laufe der Jahre wurde diese Liste eine Art Bibel – nicht im Sinne eines Regelwerks, sondern als Hinterlassenschaft meiner Mutter, die uns Halt gab und uns beruhigte, dass all das, womit Dad und ich zu kämpfen hatten, ganz normal sei.
Ein Ratschlag stellte meinen Vater jedoch vor besondere Herausforderungen:
Wenn Macy irgendwann vom Stress ihres Alltags überfordert sein sollte, such einen Rückzugsort für Euch, den Ihr am Wochenende leicht erreichen könnt, damit sie Gelegenheit zum Durchatmen bekommt.
Zwar hatte meine Mutter damit sicher nicht gemeint, dass wir unbedingt ein Wochenendhaus kaufen sollten, aber mein Vater – der dazu neigte, alles wörtlich zu nehmen – sparte, schaute sich die kleinen Orte nördlich von San Francisco an, plante und bereitete alles für den Tag vor, an dem er in unseren Rückzugsort investieren müsste.
In den ersten Jahren nach Moms Tod behielt er mich mit seinen sanften eisblauen Augen unablässig im Blick und stellte mir intensive Fragen, die lange Antworten erforderten – oder zumindest längere als »ja«, »nein« oder »weiß nicht«. Und als ich das erste Mal auf eine dieser umfassenden Befragungen mit einem resignierten Stöhnen antwortete, weil ich erschöpft war vom Schwimmtraining, von den Hausaufgaben und den immer gleichen Dramen meiner Freundinnen, rief mein Vater sofort eine Immobilienmaklerin an und beauftragte sie, uns das perfekte Wochenendhaus in den Weinbergen um San Francisco zu besorgen.
Und dann fanden wir es in Healdsburg: Es handelte sich um ein mit Holzschindeln verkleidetes Häuschen, das vier Schlafzimmer und verwinkelte Dachschrägen hatte, chronisch feucht, vielleicht auch schimmlig war und im Schatten der Bäume an einem Bach stand, den ich in meinem Zimmer unentwegt würde plätschern hören.
Unser neues Zuhause hatte viel mehr Platz, als wir brauchten, und ein größeres Grundstück, als wir pflegen konnten, und weder mein Vater noch ich ahnten zu dem Zeitpunkt, dass der wichtigste Raum darin das Bücherzimmer werden würde, das er in meinem begehbaren Kleiderschrank einrichten wollte.
Und erst recht nicht hätte mein Vater geahnt, dass mein ganzes Leben eines Tages in den Händen eines mageren, etwas sonderbaren Jungen namens Elliot Lewis Petropoulos liegen würde, der im Haus nebenan wohnte.
Dienstag, 3. Oktober
Von meiner Wohnung in San Francisco bis nach Berkeley sind es Luftlinie nur zehneinhalb Meilen, aber selbst unter besten Bedingungen braucht man für diese Strecke ohne Auto über eine Stunde.
»Heute Morgen habe ich den Bus um sechs erwischt«, sage ich. »Dann zwei Schnellbahnen direkt hintereinander und gleich den anderen Bus.« Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. »Halb acht. Gar nicht so übel.«
Sabrina wischt sich ihr Milchschaumbärtchen von der Oberlippe. Zwar versteht sie, dass ich nicht Auto fahren möchte, ein Teil in ihr findet jedoch, ich solle mich einfach zusammenreißen und mir wie jeder nicht masochistisch veranlagte Bewohner der Bay Area endlich einen Prius oder Subaru zulegen. »Lass dir von niemandem erzählen, dass du keine Heilige bist.«
»Bin ich wirklich. Nur du zwingst mich, meine Wolke zu verlassen.« Aber das sage ich mit einem Lächeln und betrachte dabei ihre winzige Tochter Vivienne in meinem Arm. Ich sehe das kleine Mädchen erst zum zweiten Mal, aber es wirkt bereits doppelt so groß wie bei unserer ersten Begegnung. »Gut, dass wenigstens du es wert bist.«
Tag für Tag halte ich Babys in meinem Arm, aber dieser Moment ist etwas Besonderes. An der Uni waren Sabrina und ich Zimmernachbarinnen im Wohnheim, bevor wir erst zusammen in eine kleine Wohnung abseits des Campus und später in ein baufälliges Haus zogen. Durch einen glücklichen Zufall sind wir beide an der Westküste in der Bay Area gelandet, und nun hat Sabrina tatsächlich ein Baby. Es kommt mir sehr merkwürdig vor, dass wir schon alt genug sind für all das: ein Kind zu bekommen, es zu stillen, es großzuziehen.
»Ich hatte gestern bis elf Uhr nachts mit ihr zu tun«, sagt Sabrina und sieht uns liebevoll an. Dann wird ihr Lächeln ein bisschen bitter. »Und wieder um zwei. Und um vier. Und um sechs …«
»Okay, du hast gewonnen. Aber man muss fairerweise sagen, dass sie viel besser riecht als die meisten Leute im Bus.« Ich drücke Viv einen Kuss aufs Köpfchen und rücke sie in meiner Armbeuge zurecht, bevor ich vorsichtig nach meinem Kaffee greife.
Der Becher fühlt sich fast fremd in meiner Hand an. Er ist aus Keramik, nicht aus Pappe oder Edelstahl wie der riesige Thermobecher, den Sean mir jeden Morgen bis zum Rand mit Kaffee füllt, weil er – nicht zu Unrecht – annimmt, dass ich den Tag nur mit einer großen Dosis Koffein überstehen kann. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich tatsächlich die Zeit hatte, mich in ein Café wie dieses zu setzen und in Ruhe etwas aus einem richtigen Becher zu trinken.
»Wenn man dich so anschaut, könnte man dich glatt für eine Mutter halten«, sagt Sabrina, die uns von ihrer Seite des Tischs nicht aus den Augen lässt.
»Das ist der Vorteil, wenn man mit Babys arbeitet.«
Als Sabrina nun verstummt, wird mir mein Fehler bewusst. Grundregel Nr. 1: vor Müttern, vor allem frischgebackenen Müttern, niemals von meinem Job sprechen. Ich kann praktisch hören, wie ihr das Herz stockt.
»Ich weiß nicht, wie du das schaffst«, flüstert sie.
Dieser Satz ist mittlerweile der Refrain meines Lebens geworden. Meine Freunde finden es beunruhigend, dass ich mich für die Pädiatrie der Uniklinik von San Francisco entschieden habe – und zwar für die Kinderintensivstation. Immer wieder sehe ich in ihren Augen den Verdacht aufblitzen, mir könne irgendetwas Wichtiges fehlen, Mitgefühl oder Mütterlichkeit, etwas, das es mir doch unmöglich machen müsste, Tag für Tag das Leid kranker Kinder mit ansehen zu können.
Ich gebe Sabrina meine Standardantwort: »Irgendeiner muss es tun«, und füge hinzu: »Außerdem bin ich gut darin.«
»Das kann ich mir denken.«
»Aber Kinderneurologie, das könnte ich auf gar keinen Fall machen«, sage ich, beiße mir jedoch sofort auf die Lippen.
Sei still, Macy. Halt einfach dein dummes Plappermaul.
Sabrina nickt nur kurz und starrt auf ihr Baby. Viv lächelt mich an und strampelt aufgeregt mit den Beinchen.
»Nicht alle Geschichten enden traurig.« Ich kitzle Viv den Bauch. »Es vergeht kein Tag, an dem nicht auch ein kleines Wunder geschieht, stimmt’s, Süße?«
Daraufhin wechselt Sabrina abrupt und mit leicht schriller Stimme das Thema: »Wie steht’s um die Hochzeitsplanung?«
Ich stöhne auf und schnuppere an Vivs wunderbar nach Baby duftendem Kopf.
»Riecht so gut, oder?« Lachend streckt Sabrina die Hände nach ihr aus, als könne sie ihre Tochter einfach nicht mehr länger teilen. Ich kann es ihr nicht verdenken. Wie warm und anschmiegsam dieses Bündel in meinen Armen ist.
»Sie ist einfach vollkommen«, sage ich leise und übergebe sie ihrer Mutter. »So ein kräftiges kleines Ding.«
Und dann, weil alles, was ich tue, irgendwie mit meinen Erinnerungen an sie in Verbindung zu stehen scheint – an diese riesige, chaotische Familie, die doch niemals die meine war –, überkommt mich die Erinnerung an das letzte Mal, als ich außerhalb meiner Arbeit mit einem Baby zu tun hatte. Damals war ich noch ein Teenager und starrte auf die kleine Alex hinab, die in ihrer Wippe schlief.
Eine wahre Flut von Bildern bestürmt mich: Die Mutter Dina, wie sie mit Alex im Tragetuch kocht; der Vater Nick, der Alex in seinen massigen, haarigen Armen hält und sie mit unsagbarer Zärtlichkeit betrachtet. Der sechzehnjährige George, der – vergeblich – versucht, ihr auf der Wohnzimmercouch die Windel zu wechseln, ohne dass etwas danebengeht. Nick Jr., George und Andreas, die mit ausgeprägtem Beschützerinstinkt ihr neues Geschwisterchen begutachten. Und dann, wie könnte es anders sein, wandern meine Gedanken zu Elliot, wie er sich leicht abseits hält und wartet, bis seine älteren Brüder wieder raufen, durchs Haus trampeln oder sonst irgendwie Chaos veranstalten, um Alex auf den Arm zu nehmen, ihr vorzulesen und ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken.
Sie alle vermisse ich schmerzlich, besonders jedoch ihn.
»Macy?«, hakt Sabrina nach.
Ich blinzele sie an. »Was denn?«
»Die Hochzeit?«
»Ach ja.« Meine Laune sinkt; die Vorstellung, eine Hochzeit zu planen, während ich hundert Stunden pro Woche im Krankenhaus arbeite, schlägt mir aufs Gemüt. »Wir sind noch kein Stück weitergekommen. Uns fehlt immer noch ein Termin, eine Location … einfach alles. Sean ist es völlig egal, wie wir heiraten. Was doch ein gutes Zeichen ist, oder?«
»Aber ja!«, versichert Sabrina übertrieben munter und legt sich Viv diskret an die Brust. »Außerdem: Wozu die Eile?«
Ihre Frage lässt durchblicken, was sie wirklich denkt: Ich bin deine beste Freundin, und trotzdem habe ich diesen Mann nur zweimal zu Gesicht bekommen, verdammt noch mal! Warum also die Eile, ihn zu heiraten?
Sie hat recht. Es hat keine Eile. Schließlich sind Sean und ich erst seit ein paar Monaten zusammen. Allerdings ist Sean der erste Mann seit über zehn Jahren, bei dem ich ganz ich selbst sein kann und nicht das Gefühl habe, mich mit irgendetwas zurückhalten zu müssen. Er ist locker und gelassen, und als seine sechs Jahre alte Tochter Phoebe fragte, wann wir denn heiraten würden, ging ihm offenbar ein Licht auf, denn kurz darauf machte er mir einen Antrag.
»Ich schwöre es«, versichere ich Sabrina, »es gibt keine Neuigkeiten, die von Bedeutung wären. Abgesehen davon vielleicht, dass ich nächste Woche einen Termin beim Zahnarzt habe.« Sabrina lacht. »So weit ist es schon gekommen: Außer dem Treffen mit dir ist so etwas das Einzige, was meine langweilige Routine auf absehbare Zeit unterbricht. Ansonsten gilt für mich: arbeiten, schlafen, arbeiten und so weiter.«
Sabrina nimmt das als Aufforderung, ausführlich von ihrem neuen Leben als Kleinfamilie zu erzählen, und sie listet jeden einzelnen Meilenstein auf: Vivs erstes Lächeln, ihr erstes richtiges Lachen und, erst gestern, ihr erster geglückter Griff nach Mamas Finger.
Ich höre zu und betrachte jeden dieser ganz normalen Schritte als Wunder, denn genau das ist es. Ich wünschte, ich bekäme solche alltäglichen Kleinigkeiten öfter zu hören. Zwar liebe ich meine Arbeit, vermisse es aber, einfach mal nur zu reden, am Leben teilzuhaben.
Meine Schicht fängt heute um zwölf Uhr mittags an und wird wahrscheinlich bis tief in die Nacht dauern. Dann werde ich nach Hause kommen, ein paar Stunden schlafen, und morgen geht alles von vorn los. Nach dem Kaffeeplausch mit Sabrina und Viv wird der Rest des Tages mit dem ewigen Einerlei meines Alltags verschmelzen, und falls nicht etwas wirklich Furchtbares auf der Station passiert, werde ich mich später an keinerlei Einzelheiten dieses Tages erinnern.
Daher versuche ich, während Sabrina erzählt, so viel wie möglich von meiner Umgebung mitzubekommen. Ich genieße den Duft nach Kaffee und Toast und lausche der Musik, die die Stimmen der Gäste mit einem sanften Klangteppich unterlegt. Als Sabrina sich vorbeugt, um einen Schnuller aus der Windeltasche zu holen, lasse ich meinen Blick zur Theke schweifen. Ich mustere kurz die Frau mit den rosa Dreadlocks und den gedrungenen Mann mit dem Tattoo im Nacken, der die Bestellungen aufnimmt. Dann erregt die hoch aufgeschossene Gestalt eines Mannes meine Aufmerksamkeit.
Fast schwarze, kräftige Haare, die bis über die Ohren reichen und leicht verstrubbelt abstehen. Ein auf einer Seite hochstehender Kragen, das Hemd hängt über die verschlissene schwarze Jeans. Heruntergetretene Vans in altmodischem Schachbrettmuster. Eine abgenutzte Kuriertasche quer über dem Rücken.
Der Mann steht mit dem Rücken zu mir, und er sieht aus wie wohl tausend andere in Berkeley, und doch weiß ich genau, wer er ist.
Das dicke, zerlesene Buch unter seinem Arm verrät ihn: Ich kenne nur einen einzigen Menschen, der jedes Jahr im Oktober »Ivanhoe« liest. Immer wieder von neuem und mit absoluter Begeisterung.
Ich vermag nicht, den Blick von ihm abzuwenden, fürchte jedoch gleichzeitig den Moment, wenn er sich umdreht und ich sehe, wie er sich in den fast elf Jahren verändert hat. Auf mein eigenes Erscheinungsbild verschwende ich kaum einen Gedanken: mintgrüne Krankenhauskluft, praktische Sneaker, lockerer Pferdeschwanz. Es ist keinem von uns je in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken, wie wir aussehen. Wir waren immer nur damit beschäftigt, uns die Züge des anderen einzuprägen.
Als der Geist aus der Vergangenheit seine Bestellung bezahlt, reißt mich Sabrina aus meinen Gedanken.
»Macy?«
Wieder blinzele ich sie an. »Tut mir leid. Ich … Da – Was?«
»Ich hab nur was über Windelausschlag gesagt. Aber viel mehr interessiert mich, was dich so …« Sie folgt meinem Blick. »Oh.«
Ihr »Oh« zeugt nicht von echtem Verstehen, es gilt einzig und allein der Rückenansicht des Mannes. Er ist groß – das kam ganz plötzlich, als er fünfzehn wurde. Und seine Schultern sind breit – auch das kam ganz plötzlich, aber später. Ich weiß noch, wie es mir das erste Mal auffiel, als er im Bücherschrank neben mir aufragte, mit seiner viel zu kurzen Hose, und seine breitschultrige Gestalt die funzelige Lampe verdeckte. Seine Haare sind beeindruckend voll, das waren sie schon immer. Die Jeans hat er tief auf den Hüften sitzen, und sein Hintern ist einfach perfekt. Keine Ahnung, wann das kam.
Im Grunde sieht er genau wie der Typ Mann aus, den sie und ich sonst von ferne anstarren, um uns dann wortlos Wow! zuzufunken. Es ist bizarr: Ich sehe ihn vor mir, und er ist ein Fremder – genau jene Art Mann, die ich normalerweise verträumt anschmachten würde. Allein, ihn von hinten zu sehen, ist schon seltsam, und ich rede mir eine Sekunde lang ein, er sei es doch nicht. Schließlich könnte dieser Mann irgendwer sein, nach mehr als zehn Jahren Trennung kann ich doch gar nicht genau wissen, wie er aussieht.
Doch als er sich umdreht, habe ich plötzlich das Gefühl, alle Luft wäre aus dem Café gewichen. Ich kann nicht mehr atmen, als hätte ich einen Schlag in den Magen bekommen.
Sabrina hört mein leises Ächzen und dreht sich zu mir um. Ich spüre, wie sie sich langsam vom Stuhl erhebt. »Macy?«
Ich versuche, Luft zu holen, kann aber nur flach atmen, und meine Augen beginnen zu brennen.
Sein Gesicht ist schmaler, sein Kiefer konturierter, sein Dreitagebart ausgeprägter. Er trägt immer noch eine Brille, aber sie dominiert nicht mehr sein ganzes Erscheinungsbild. Seine strahlend goldbraunen Augen werden noch immer von den dicken Gläsern vergrößert. Seine Nase hat sich nicht verändert, nur ist sie jetzt nicht mehr zu groß für sein Gesicht. Und sein Mund ist noch immer so wie früher: geradlinig, mit Lippen, von denen ich weiß, wie weich sie sind, zum sardonischsten Grinsen der Welt befähigt.
Ich habe keine Vorstellung davon, welcher Ausdruck auf seinem Gesicht erschiene, wenn er meiner gewahr würde. Womöglich einer, den ich noch nie an ihm gesehen habe.
»Macy?« Sabrina streckt ihre freie Hand aus und umfasst meinen Unterarm. »Süße, ist alles in Ordnung?«
Ich schlucke und schließe die Augen, um wieder zu mir zu kommen. »Ja.«
Das scheint sie nicht zu überzeugen. »Bist du sicher?«
»Ja, ich …« Ich schlucke erneut und öffne die Augen, um sie anzusehen, doch wird mein Blick wieder von dem angezogen, was sich hinter ihr befindet. »Der Typ da drüben … Das ist Elliot.«
»Oh«, sagt sie erneut, und diesmal versteht sie alles.
Freitag, 9. August
vor fünfzehn Jahren
Bei der Hausbesichtigung sah ich Elliot zum ersten Mal.
Das Häuschen stand völlig leer. Im Gegensatz zu den sorgfältig in Szene gesetzten Objekten, die wir in der Bucht von San Francisco gesehen hatten, war diese etwas merkwürdige Immobilie in Healdsburg vollkommen unmöbliert. Erwachsene mochten die Möglichkeiten schätzen, die solch kahle Räumlichkeiten boten, doch auf mich wirkte es erst einmal kalt und abweisend. Unser Haus in Berkeley dagegen war gemütlich vollgestopft. Als meine Mutter noch am Leben war, setzte sie ihren Sinn für Behaglichkeit gegen Dads dänischen Minimalismus durch, und nach ihrem Tod konnte er sich nicht dazu aufraffen, irgendetwas daran zu ändern.
Hier zeugten lediglich dunkle Vierecke an den Wänden von Bildern, die einst dort gehangen hatten. Ein breiter zerschlissener Streifen auf dem Teppich offenbarte den bevorzugten Laufweg der früheren Bewohner: von der Haustür zur Küche. Vom Eingangsbereich aus blickte man auf den Flur des oberen Stockwerks. Alle Türen zu den Zimmern waren geschlossen, was dem langen Gang etwas Unheimliches verlieh.
»Da oben«, sagte Dad und wies mit dem Kinn in Richtung des Zimmers, das für mich gedacht war. Er hatte sich das Haus schon im Internet angesehen und wusste daher, was uns erwartete. »Du könntest das Zimmer am Ende nehmen.«
Ich ging die dunkle Treppe hinauf, am großen Schlafzimmer und Bad vorbei, bis ich am Ende des langen, schmalen Korridors landete. Unter der Zimmertür drang ein hellgrün schimmernder Lichtstreifen hervor. Wie ich bald sehen sollte, rührte der von den leuchtend grünen Wänden her, die von der Nachmittagssonne beschienen wurden. Der kristallene Türknauf war kalt, strahlte jedoch glänzend klar und ließ sich mit einem leisen Quietschen drehen. Die Tür hatte sich offenbar von der Feuchtigkeit verzogen und klemmte. Entschlossen drückte ich meine Schulter dagegen und wäre fast in das warme, helle Zimmer gestolpert.
Es war nahezu doppelt so lang wie breit. Den größten Teil der Längsseite nahm ein riesiges Fenster ein, das Aussicht auf einen Hügel voller moosbewachsener Bäume bot. Am hinteren Ende war noch ein Fenster, schmal und hoch aufragend wie ein geduldig wartender Butler, von dem aus in der Ferne der Russian River zu sehen war.
Die untere Etage war nichts Besonderes gewesen, ganz im Gegensatz zu den Zimmern hier oben. Schon besser gelaunt drehte ich mich um, um nach Dad zu suchen, der soeben aus dem großen Schlafzimmer trat.
»Hast du den begehbaren Schrank gesehen, Macy?«, fragte er. »Ich dachte, dass wir dir daraus eine kleine Bibliothek machen könnten.« Dann rief die Maklerin nach ihm, und er wandte sich ab, um die Treppe hinunterzugehen.
Ich kehrte in mein Zimmer zurück und ging zum hinteren Ende. Die Tür zum Schrank öffnete sich mühelos.
Wie jeder andere Raum im Haus war auch dieser unmöbliert. Aber nicht leer.
Vor Verwirrung machte mein Herz einen Satz.
Im hinteren Teil des begehbaren Schranks saß ein Junge. Er hatte sich in die Ecke unter der Dachschräge zurückgezogen und las ein Buch.
Viel älter als dreizehn konnte er nicht sein, wir mussten also ungefähr im gleichen Alter sein. Mager, kräftige schwarze Haare, die schon lange keine Schere mehr gesehen hatten, riesige goldbraune Augen hinter einer dicken Brille. Seine Nase war zu groß für sein Gesicht, seine Zähne waren zu groß für seinen Mund, und seine Präsenz war zu offensichtlich für einen Raum, der eigentlich leer sein sollte.
Erschrocken brach es aus mir heraus: »Wer bist du?«
Verblüfft und mit aufgerissenen Augen sah er mich an. »Ich hätte nicht gedacht, dass zu dieser Besichtigung wirklich jemand kommen würde.«
Mein Herz hämmerte. Unter seinem Blick – seinen riesigen Augen, die mich ohne zu blinzeln durch die Brille anstarrten – kam ich mir entblößt vor. »Wir wollen es vielleicht kaufen.«
Der Junge erhob sich, und es zeigte sich, dass der breiteste Teil seiner Beine die Knie waren. Er trug braune, glänzende Lederschuhe und ein gebügeltes Hemd, das er sich in die khakifarbenen Shorts gesteckt hatte. Er wirkte vollkommen harmlos. Doch als er einen Schritt auf mich zutrat, machte mein Herz erneut einen panischen Satz, und ich stieß hervor: »Mein Vater hat den schwarzen Gürtel.«
Halb eingeschüchtert, halb skeptisch sah er mich an. »Ehrlich?«
»Ehrlich!«
Er zog die Augenbrauen zusammen. »Worin denn?«
Ich ließ die Fäuste sinken, die ich an den Hüften geballt hatte. »Also gut: Er hat keinen schwarzen Gürtel. Aber er ist riesengroß.«
Das schien er mir abzukaufen, denn nun blickte er besorgt an mir vorbei.
»Was machst du überhaupt hier?«, fragte ich und sah mich um. Für einen Schrank war der Raum riesig. Ein mindestens vier mal vier Meter großes Quadrat. Die hohe Decke fiel am Ende des Raums steil bis auf eine Höhe von höchstens einem Meter ab, und ich konnte mir sofort vorstellen, hier auf einer Couch mit Kissen und Büchern zu sitzen und einen perfekten Samstagnachmittag zu verbringen.
»Ich mag es, hier zu lesen«, sagte er achselzuckend, worauf ein schwaches Interesse, vielleicht jemanden Gleichgesinntes zu treffen, in mir erwachte, das ich schon jahrelang nicht mehr verspürt hatte. »Meine Mutter hat den Schlüssel noch von den Hansons, den Vorbesitzern, und die waren nie da.«
»Wollen deine Eltern das Haus kaufen?«
Verwirrt sah er mich an. »Nein. Ich wohne nebenan.«
»Also ist das kein Hausfriedensbruch?«
Er schüttelte den Kopf. »Ist doch eine Hausbesichtigung, schon vergessen?«
Ich sah ihn mir genauer an. Sein Buch war ziemlich dick, und ich konnte einen Drachen auf dem Einband erkennen. Der Junge selbst war groß und hatte spitze Ellbogen und eckige Schultern. Die Haare waren zottig, obwohl sie einen gepflegten Eindruck machten, ebenso wie seine Fingernägel.
»Also hängst du hier einfach nur ab?«
»Manchmal«, gab er zu. »Das Haus steht schon seit ein paar Jahren leer.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Bist du dir wirklich sicher, dass du hier sein darfst? Irgendwie wirkst du nervös. Bist du immer so außer Puste?«
Er zuckte die Achseln, wobei sich eine knochige Schulter mehr anhob als die andere. »Vielleicht bin ich gerade einen Marathon gelaufen.«
»Du siehst aus, als könntest du nicht mal um den Block laufen.«
Er stutzte kurz und brach dann in Gelächter aus. Es klang, als würde er nicht oft lachen, und in mir regte sich etwas.
»Wie heißt du?«, fragte ich.
»Elliot. Und du?«
»Macy.«
Elliot starrte mich an und schob sich mit einem Finger die Brille hoch, aber sie rutschte sofort wieder herunter. »Wenn ihr das Haus kauft, komm ich nicht mehr einfach so her, um zu lesen.«
Das klang wie eine Herausforderung, als stünde die Entscheidung im Raum: Freund oder Feind?
Einen Freund konnte ich wirklich brauchen.
Ich atmete geräuschvoll aus und lächelte widerstrebend. »Wenn wir das Haus kaufen, kannst du rüberkommen und lesen, wann du willst.«
Da grinste er so breit, dass ich seine Zähne zählen konnte. »Vielleicht habe ich es die ganze Zeit nur für dich vorgewärmt.«
Dienstag, 3. Oktober
Elliot hat mich noch immer nicht gesehen.
Mit gesenktem Blick wartet er an der Espressobar auf seine Bestellung. In einem Meer von Menschen, die sich nur über ihr Smartphone mit der Welt verbinden, steht Elliot einfach da und liest ein Buch.
Ob er überhaupt ein Handy hat? Bei jedem anderen wäre die Frage absurd. Nicht jedoch bei ihm. Vor elf Jahren hatte er eines, aber das war ein abgelegtes Klapphandy seines Vaters, bei dem man dreimal auf die Fünfertaste drücken musste, um ein L zu schreiben. Er benutzte es ohnehin kaum.
»Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«, fragt Sabrina.
Mit gerunzelter Stirn sehe ich zur ihr hinüber und funkle sie an. Ich bin mir sicher, dass sie die Antwort kennt, zumindest ungefähr. Doch ich entspanne mich, als ich verstehe, dass ihr im Moment gar nichts anderes übrig bleibt, als Konversation zu betreiben, da ich mich vor Schreck in einen stummen Fisch verwandelt habe.
»Im letzten Jahr der Highschool. Silvester.«
Sie atmet scharf ein und nickt. »Stimmt ja.«
Da springt mein Selbsterhaltungstrieb an und treibt mich vom Stuhl.
»Tut mir leid«, sage ich und blicke auf Sabrina und Viv. »Aber ich muss sofort gehen.«
»Klar. Natürlich. Sicher doch.«
»Ich rufe dich dieses Wochenende an, ja? Vielleicht können wir endlich mal in den Golden Gate Park gehen.«
Sie nickt immer noch, so als wäre mein Vorschlag mehr als nur eine Phrase und läge auch nur entfernt im Bereich des Möglichen. Doch wir wissen beide, dass ich seit Beginn meiner Zeit als Assistenzärztin im Juli noch kein einziges freies Wochenende hatte.
So unauffällig wie möglich sammle ich meine Sachen zusammen, hänge mir die Tasche über die Schulter und beuge mich zu Sabrina hinunter, um ihr ein Küsschen auf die Wange zu geben.
»Du bist die Beste«, sage ich, richte mich wieder auf und wünsche mir, ich könnte sie mitnehmen. Sie riecht auch nach Baby.
Sabrina nickt, erwidert, ich sei die Beste, und dann, während ich Viv mit ihren kräftigen kleinen Fäustchen noch ein letztes Mal über den Kopf streiche, erstarrt sie.
Elliot muss mich entdeckt haben.
»Äh …«, sagt sie und weist mit dem Kinn auf ihn, weil ich wohl besser einen Blick riskieren sollte. »Er kommt.«
Ich wühle in meiner Tasche, um äußerst beschäftigt und abgelenkt zu wirken. »Ich muss flitzen«, murmle ich.
»Macy?«
Mit gesenktem Blick halte ich inne und umklammere den Riemen meiner Tasche. Beim Klang seiner Stimme durchzieht mich ein sehnsüchtiger Schmerz. Bis zum Stimmbruch war sie hoch und quietschig, was ihm von allen ständig unter die Nase gerieben wurde. Doch dann, eines Tages, sollte er Genugtuung bekommen, denn das Universum schenkte ihm eine Stimme, so sanft und vollmundig wie Honig.
Wieder nennt er mich beim Namen – diesmal bei meinem vollen Namen, leiser: »Macy Lea?«
Ich blicke auf, und in einem Impuls, der mich sicher bis zum Ende meines Lebens wird zusammenzucken lassen, winke ich schlaff mit der Hand. »Elliot! Hey!«, sage ich betont munter.
Als hätten wir uns während der Erstsemesterwoche irgendwann mal kennengelernt. Oder zufällig in einem Zug aus Santa Barbara getroffen.
Als er sich nun mit einer ungläubigen Geste, die ich schon tausendmal an ihm gesehen habe, die Haare aus der Stirn streicht, drehe ich mich um und kämpfe mich durch die Menge hinaus ins Freie. Einen halben Block jogge ich in die falsche Richtung, bevor mir mein Irrtum aufgeht und ich herumwirble. Mehrere große Schritte später pralle ich mit gesenktem Kopf und hämmerndem Herzen gegen eine breite Brust.
»Oh! Tut mir leid!«, stoße ich hervor, doch dann schaue ich auf und merke, wer vor mir steht.
Elliot fasst mich an den Oberarmen und hält mich auf Armeslänge von sich. Ich weiß, er sieht mein Gesicht an und wartet darauf, dass ich seinen Blick erwidere, aber ich kann nur seinen Adamsapfel anstarren, weil ich daran denken muss, wie ich heimlich immer wieder seinen Hals betrachtete, während wir stundenlang gemeinsam in meinem Bücherschrank lasen.
»Macy. Wirklich?«
Wirklich, bist du das?
Wirklich, du rennst vor mir weg?
Wirklich, wo warst du in den letzten zehn Jahren!
Ein Teil von mir wünscht sich, ich könnte mich einfach an ihm vorbeidrängen und weglaufen, so tun, als wäre das alles nie passiert. Ich könnte wieder in die Bahn springen, zum Krankenhaus fahren und mich in einen Tag voller Arbeit und lebenswichtiger Entscheidungen stürzen, was ehrlich gesagt viel angebrachter wäre als dieses emotionale Durcheinander.
Aber ein anderer Teil in mir hat die letzten zehn Jahre, eigentlich sind es sogar fast elf, auf genau diesen Augenblick gewartet. Erleichterung und Schmerz durchströmen mich gleichzeitig. Jeden einzelnen Tag wollte ich ihn wiedersehen. Und wollte ihn niemals wiedersehen.
»Hi.« Endlich blicke ich zu ihm auf und überlege angestrengt, was ich jetzt sagen soll; in meinem Kopf wirbeln sinnlose Phrasen umher, wie ein Sturm aus ja und nein.
»Bist du …«, setzt er an und stockt. Er hat mich noch immer nicht losgelassen. »Bist du wieder hierhergezogen?«
»Nach San Francisco.«
Ich merke, wie er meine Klinikkluft und die hässlichen Sneaker mustert. »Ärztin?«
»Ja, Assistenzärztin.«
Ich bin ein Roboter.
Er zieht die dunklen Augenbrauen in die Höhe. »Aber was machst du ausgerechnet hier?«
Ein sehr merkwürdiger Anfang für ein Gespräch. Aber wenn sich ein Berg vor einem auftürmt, muss man wahrscheinlich mit dem Nächstliegenden beginnen. »Ich habe mit Sabrina einen Kaffee getrunken.«
Verständnislos zieht er die Nase kraus, ein Ausdruck, der mir schmerzlich vertraut ist.
»Meiner Mitbewohnerin vom College«, erkläre ich. »Sie lebt in Berkeley.«
Elliot sinkt ein bisschen in sich zusammen, was mich daran erinnert, dass er Sabrina gar nicht kennen kann. Früher störte es uns schon, wenn wir auch nur einen Monat vom Leben des anderen verpassten. Jetzt fehlen uns Jahre, ein halbes Leben.
»Ich hab dich angerufen«, sagt er. »Eine Million Mal. Aber dann hat sich deine Nummer geändert.«
Er fährt sich mit der Hand durch die Haare und zuckt hilflos die Achseln. Und ich verstehe ihn. Die ganze Situation ist so verdammt unwirklich. Selbst jetzt ist es kaum zu begreifen, dass wir diese Entfremdung zugelassen haben. Dass ich sie zugelassen habe.
»Ich weiß. Ich … äh … hab damals ein neues Handy bekommen«, erkläre ich lahm.
Er lacht, aber es klingt nicht besonders amüsiert. »Ja, das dachte ich mir.«
»Elliot«, setze ich an und schlucke den Kloß hinunter, der sich mit seinem Namen in meinem Hals gebildet hat. »Es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Meine Schicht fängt bald an.«
Er beugt sich zu mir und sieht mich direkt an. »Soll das ein Witz sein?«, fragt er. »Wir treffen uns zufällig in einem Café, und es heißt einfach: ›Hey, Macy, wie läuft’s?‹, und dann gehst du zu deiner Arbeit und ich zu meiner, und dann ziehen weitere zehn gottverdammte Jahre ins Land?«
Da ist es wieder. Elliot konnte nie anders, als das Kind beim Namen zu nennen.
»Ich war nicht darauf vorbereitet, dir zu begegnen«, gestehe ich.
»Musst du etwa auf mich vorbereitet sein?«
»Auf dich ganz besonders.«
Das trifft ihn, von mir beabsichtigt – mitten ins Herz –, aber als er zusammenzuckt, tut es mir schon wieder leid.
Verdammt noch mal!
»Gib mir nur eine Minute«, drängt er und zieht mich zum Rand des Bürgersteigs, damit wir den Strom der Passanten nicht länger blockieren. »Wie geht es dir? Seit wann bist du zurück? Wie geht es Duncan?«
Mit einem Mal steht die Welt um uns still.
»Mir geht’s gut«, antworte ich automatisch. »Ich bin im Mai zurückgezogen.« Die dritte Frage hat mich so erschüttert, dass meine Stimme zittert, als ich sage: »Und … Dad ist tot.«
Elliot fährt zurück. »Was?«
»Ja«, sage ich mit schwankender Stimme. Mir fehlen die Worte, ich habe Mühe, das Vergangene in meiner Erinnerung aufzurufen, Tausende von Synapsen in meinem Hirn zu entwirren.
Irgendwie gelingt es mir, dieses Gespräch zu führen, ohne zusammenzubrechen, aber sollte es auch nur zwei Minuten länger dauern, kann ich für nichts mehr garantieren. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen, vor mir liegt eine weitere Achtzehnstundenschicht, und jetzt fragt mich Elliot auch noch nach meinem Vater … Ich muss hier weg, bevor ich die Fassung verliere.
Aber als ich zu Elliot aufblicke, sehe ich, wie sich das, was in mir tobt, auch in seiner Miene widerspiegelt. Er ist am Boden zerstört. Er ist der Einzige, der bei der Nachricht vom Tod meines Vaters so aussehen kann, weil er der Einzige ist, der versteht, was das für mich bedeutet.
»Duncan ist tot?«, fragt er mit erstickter Stimme. »Aber warum hast du mir nicht erzählt, dass er gestorben ist, Macy?«
Eine sehr gute Frage.
»Ich …«, beginne ich und schüttle dann den Kopf. »Als es passierte, hatten wir keinen Kontakt.«
Eine Welle der Übelkeit steigt in mir auf. Was für eine unglaublich feige Ausrede.
Er schüttelt den Kopf. »Ich hatte ja keine Ahnung. Es tut mir so leid, Macy.«
Als ich mir erlaube, ihn noch einmal kurz anzusehen, trifft es mich wie ein Schlag. Das ist der Mensch, der mir am meisten bedeutet. Und das war er schon immer. Mein bester Freund, mein Vertrauter und – wahrscheinlich – die Liebe meines Lebens. Und ich habe die letzten knapp elf Jahre damit verbracht, mich in selbstgerechtem Zorn zu suhlen. Doch letztlich war er es, durch den unsere Beziehung einen Riss bekommen hat, und dann hat das Schicksal diesen Riss in einen riesigen klaffenden Abgrund verwandelt.
»Ich muss los«, sage ich, von meinem Unbehagen überwältigt. »Okay?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, reiße ich mich los und eile die Straße hinunter zur nächsten Bahnhaltestelle. Und die ganze Zeit, während ich davonlaufe, und auch später während der Fahrt in der vollen Bahn, habe ich das Gefühl, dass er direkt hinter mir oder im nächsten Waggon ist.
Freitag, 11. Oktober
vor fünfzehn Jahren
Die ganze Familie Petropoulos stand im Vorgarten, als wir zwei Monate später mit dem Umzugswagen ankamen. Der große Wagen war nur halb voll, da Dad und ich beide gedacht hatten, es sei viel mehr, was wir mitnehmen würden. Aber am Ende hatten wir nur das Allernötigste gekauft, ein paar Möbel, um schlafen, essen und lesen zu können.
Mein Vater bezeichnete sie als »Feuerholzmöbel«, was ich nicht verstand.
Vielleicht hätte ich es, wenn ich ein paar Sekunden darüber nachgedacht hätte, aber während der gesamten anderthalbstündigen Fahrt beherrschte mich nur der Gedanke, dass wir in ein Haus einzögen, das meine Mutter nie kennengelernt hatte. Zugegeben, sie hatte es sich für uns gewünscht, aber weder hatte sie es ausgesucht noch je gesehen. Diese Tatsache hatte etwas sehr Bitteres für mich. Mein Vater fuhr noch immer seinen alten grünen Volvo. Wir wohnten noch immer in unserem alten Haus in der Rose Street. Jedes Möbelstück darin hatte es schon gegeben, als meine Mutter noch lebte. Zwar trug ich mittlerweile neue Kleider, hatte jedoch noch immer das Gefühl, dass Mom sie irgendwie durch göttliche Fügung mit ausgesucht hätte, denn jedes Mal, wenn wir shoppen gingen, brachte mein Vater mir die größten, schlabbrigsten Teile, worauf unweigerlich eine mitfühlende Verkäuferin mit einem Arm voller passender Kleider auftauchte und versicherte, dass das jetzt alle Mädchen trügen und sicher nicht zu figurbetont sei.
Als ich aus dem Umzugswagen stieg, zog ich mein T-Shirt zurecht und starrte auf die Gruppe, die sich auf unserer Schottereinfahrt versammelt hatte. Elliot entdeckte ich sofort – das einzige vertraute Gesicht in der Menge. Aber um ihn herum standen drei weitere Jungen und seine lächelnden Eltern.
Der Anblick dieser Großfamilie, die uns ihre Hilfe anbot, machte den Schmerz, der mir die Kehle zuschnürte, noch schlimmer.
Der Mann – mit seiner Nase und den dicken schwarzen Haaren unverkennbar Elliots Vater – lief auf uns zu und streckte Dad die Hand entgegen. Er war nur wenige Zentimeter kleiner als mein Vater, was eine Seltenheit war.
»Nick Petropoulos«, sagte er und bot nun mir die Hand. »Du musst Macy sein.«
»Ja, Sir.«
»Nenn mich doch Nick.«
»Okay, Mr. … Nick.« Bis dahin wäre es mir nie in den Sinn gekommen, den Vater eines Freundes beim Vornamen zu nennen.
Lachend wandte er sich wieder zu Dad. »Wir dachten, Sie könnten Hilfe beim Ausladen brauchen.«
Dad lächelte und sagte: »Das ist nett von Ihnen. Danke.« Ein Mann weniger Worte, wie immer.
»Außerdem dachte ich mir, meine Jungs könnten ein bisschen körperliche Betätigung vertragen, damit sie nicht den ganzen Tag übereinander herfallen.« Elliots Vater streckte seinen muskulösen, haarigen Arm aus und zeigte auf die Gruppe. »Das ist meine Frau Dina, und das sind meine Söhne Nick Jr., George, Andreas und Elliot.«
Drei kräftige Jungs – und Elliot – starrten uns vom Fuß der Eingangstreppe entgegen. Ich vermutete, dass sie alle zwischen fünfzehn und siebzehn Jahre alt waren, von Elliot einmal abgesehen, der sich in seiner Schlaksigkeit deutlich von seinen Brüdern unterschied. Die Mutter Dina war beeindruckend – groß und kurvig, und wenn sie lächelte, zeigten sich sympathische Grübchen auf ihren Wangen. Im Gegensatz zu Elliot, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war, sahen seine Brüder genauso aus wie sie. Groß, mit Grübchen und schweren Augenlidern. Hübsch.
Dad legte mir den Arm um die Schultern und zog mich an sich. Ich fragte mich, ob sich sein Beschützerinstinkt meldete oder ob er ebenfalls das Gefühl hatte, dass unsere Restfamilie im Vergleich zu ihrer etwas mickrig wirkte.
»Ich wusste nicht, dass Sie vier Söhne haben. Macy hat Elliot schon kennengelernt, oder?« Fragend blickte Dad zu mir herunter.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Elliot unbehaglich das Gewicht verlagerte. Ich bedachte ihn mit einem verschlagenen Grinsen. »Ja«, sagte ich und fügte in verschwörerischem Ton hinzu: »Er saß in meinem Schrank.«
Nick winkte ab. »Bei der Hausbesichtigung, ich weiß, ich weiß. Man kann nichts dagegen machen, dieser Junge ist ein echter Bücherwurm, und dieser Schrank war sein Lieblingsleseplatz. Sein Kumpel Tucker kam früher an den Wochenenden her, aber das ist nun vorbei.« Er sah meinen Vater an und erklärte: »Die Familie ist nach Cincinnati gezogen. Mal ehrlich, warum sollte man die Weinberge hier gegen Ohio eintauschen? Lächerlich. Aber keine Sorge, Macy. Wird nicht wieder vorkommen.« Grinsend folgte er meinem schweigenden Dad die Treppe hinauf. »Wir wohnen seit siebzehn Jahren nebenan und waren schon tausendmal in diesem Haus.« Unter seinen Arbeitsstiefeln knarzte eine Stufe. Prüfend trat er mit dem Fuß darauf. »Die war schon immer ein Problem.«
Trotz meiner jungen Jahre merkte ich doch, welche Auswirkung dieser Satz auf die Haltung meines Vaters hatte. Eigentlich war er ein entspannter Typ, der sich nicht groß um Hahnenkämpfe scherte, aber Nicks selbstverständlicher Umgang mit unserem Haus weckte den harten Kerl in ihm.
»Das bringe ich in Ordnung«, sagte Dad mit tieferer Stimme als sonst, als er sich über die knarzende Stufe beugte. In dem Bestreben, mir zu zeigen, dass er jedes noch so winzige Problem in Ordnung bringen würde, fügte er leise hinzu: »Die Haustür ist auch nicht die neueste, aber die kann man leicht ersetzen. Und wenn du noch irgendwas siehst, sag mir Bescheid. Ich möchte, dass alles perfekt ist.«
»Dad«, erwiderte ich und stieß ihn sachte an. »Es ist doch schon jetzt perfekt.«
Während die Petropoulos-Jungen zum Möbelwagen trotteten, fummelte mein Vater an seinem Schlüsselbund, bis er zwischen all den Schlüsseln für andere Türen, die zu unserem anderen, dreiundsiebzig Meilen entfernt liegenden Leben gehörten, den richtigen fand.
»Ich weiß noch nicht, was wir für die Küche brauchen werden«, murmelte er zu mir gewandt. »Und wahrscheinlich muss noch einiges renoviert werden …«
Mit einem unsicheren Lächeln sah er mich an und stieß die Haustür auf. Die breite Veranda, die ums Haus herum zum hinteren Garten mit den dicken Bäumen verlief, erregte meine Aufmerksamkeit. Den Garten hatte ich mir noch gar nicht angesehen, und ich stellte mir vor, wie ich in diesem Wald nach Kobolden und Pfeilspitzen suchen würde. Vielleicht würde ich dort irgendwann einmal geküsst werden.
Vielleicht von einem der Petropoulos-Jungen.
Mir schoss die Röte in die Wangen, aber das verbarg ich, indem ich den Kopf senkte und meine Haare wie einen Vorhang vor mein Gesicht fallen ließ. Bislang hatte ich nur einen einzigen Schwarm gehabt, Jason Lee in der siebten Klasse. Wir kannten uns seit dem Kindergarten, aber dann tanzten wir auf einer Schulparty miteinander, nur ein einziges Mal und mehr als unbeholfen. Und sprachen danach nie wieder ein Wort miteinander. Offenbar kam ich mit allen gut zurecht, solange es auf der Kumpelebene blieb, aber sobald auch nur ein bisschen Romantik ins Spiel kam, verwandelte ich mich in einen verkrampften Roboter.
Wir bildeten eine Kette und transportierten die kleineren Kisten auf diese Weise ziemlich schnell zum Haus, überließen die Möbel aber den Großen. Elliot und ich trugen zu zweit einen Karton mit der Aufschrift Macy nach oben. Ich folgte ihm durch den langen Korridor in mein helles, leeres Zimmer.
»Das kannst du in der Ecke abladen«, sagte ich. »Danke.«
Er blickte zu mir und nickte, als er den Karton abstellte. »Sind das Bücher?«
»Ja.«
Elliot vergewisserte sich mit einem kurzen Blick, dass ich nichts dagegen hatte, klappte den Deckel des Kartons auf und spähte hinein. Dann holte er das oberste Buch heraus. Es war »Das Wunder der Unschuld«, in dem es um einen kleinen Jungen ging, der die Welt verbessern wollte.
»Hast du es gelesen?«, fragte er skeptisch.