
Sergej Lebedew
Kronos' Kinder
Roman
Aus dem Russischen
von Franziska Zwerg
FISCHER E-Books

Für »Kronos' Kinder« hat Sergej Lebedew in den Archiven von Halle und Berlin seine deutschen Wurzeln recherchiert. Lebedew arbeitete nach dem Studium der Geologie als Journalist. Seit dem Ukrainekonflikt ist ihm in Russland die journalistische Tätigkeit untersagt, daher veröffentlicht er in deutschen Medien. Gegenstand seiner Romane sind für den 1981 Geborenen die russische Vergangenheit, insbesondere die Stalin-Zeit mit ihren Folgen für das moderne Russland. Lebedew lebt zurzeit in Moskau.
Franziska Zwerg, geboren 1969, studierte in Berlin und Moskau Slawistik, Germanistik und Theaterwissenschaft und übersetzt zeitgenössische russische Literatur, u. a. von German Sadulajew, Grigori Kanowitsch, Dina Rubina.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Kirill ist die Hauptfigur und noch ein kleiner Junge, als er sieht, wie der Nachbar, ein Kriegsveteran, die Gänse im Dorf umbringt, weil er betrunken in ihnen die Deutschen zu erkennen glaubt. Das ambivalente Verhältnis von Russen und Deutschen zieht sich durch den ganzen Roman, der heranwachsende Kirill spürt, dass es für die die Erwachsenen um ihn herum ein großes Thema ist, so auch bei seiner Großmutter Karolina, die letzte Überlebende des deutschen Zweiges ist, der Familie Schwerdt. Der mittlerweile erwachsene Kirill geht auf den deutschen Friedhof in Moskau und sucht nach den Gräbern seiner Vorfahren und findet das Grab von Balthasar Schwerdt (1807–1883). Er war der erste Deutsche in der Familie, der als Arzt und Homöopath an den Zarenhof kam, dort fiel er aber bald in Ungnade und wurde Arzt in Moskau. Auf der Suche nach der Familiengeschichte geht Kirill in die Archive von Leipzig, Halle, Wittenberg, Münster und findet die Geschichten des 20. Jahrhunderts, irgendein Verwandter war immer involviert: im Russisch-Japanischen Krieg, der Revolution, dem Ersten Weltkrieg, Bürgerkrieg, Zweiten Weltkrieg, in der Stalin-Zeit. Wie auch in seinen bisherigen Romanen »Der Himmel auf ihren Schultern« und »Menschen im August« liegt Sergej Lebedews Hauptaugenmerk auf der Vergangenheitsbewältigung, die bekanntermaßen in Russland nicht stattfindet. Man versteht durch seinen neuen Roman »Kronos' Kinder« etwas mehr, warum das Verhältnis (seit Katharina der Großen) zwischen Deutschen und Russen so schwierig ist, daher ist es auch ein deutscher Roman aus der Sicht eines Russen erzählt.
Die Übersetzerin dankt dem Internationalen Schriftsteller- und Übersetzerhaus Ventspils.
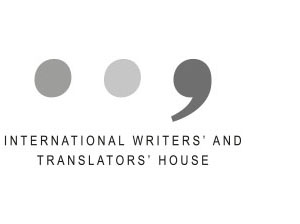
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
›Гусь Фриц‹ bei Wremja, Moskau 2018
© Sergej Lebedew, 2018
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Gerald Murphy, Watch (1925) / AKG Images / VG Bild-Kunst, Bonn 2018
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490806-9
Die Anmerkungen der Übersetzerin finden Sie am Ende des Buches.
Homer: Odyssee. Übersetzung von Johann Heinrich Voß: Insel Verlag, Frankfurt/M. 1990, Anm.d.Ü.
Doch kam er heim ins Zelt mit einem ganzen Tross
Gebundner Stiere, Schäferhunden, Hörnervieh,
Schlägt ins Genick den einen, andre stellt er hoch,
Trennt ihnen Kehle, Rückgrat durch, mißhandelt sie,
Als wären’s Männer – und greift doch nur Herden an.
Sophokles. »Aias«
Ein Laut.
Der Laut von Wasser, das steil in die Regentonne stürzt, die am Haus steht.
Die umgekehrte Fontäne schlägt auf den Boden der Tonne. Am Vortag geangelte Karauschen, winzig wie eine Kinderfaust, schwimmen besinnungslos hin und her. Gelber Schaum von Blütenpollen kreist im Wasser, rosa Apfelblüten, schwarzbraunes Laub vom Vorjahr und verschrumpelte Äpfel mit schwarzen Fäulnisflecken – der Sturzregen hat sie aus der Regenrinne gepresst. Auch Spinnweben und darin gefangenes Insekt sind zu sehen – ein Libellenflügel glitzert wie zerbrochner Quarz!
Alles, was ausgelebt hat und verwelkt ist, reißt das Gewitter ab und fort, auch das, was gerade erst entstand, noch schwach ist, sich kaum hält; die Reste des Vergangenen und die Knospen der Zukunft.
Am Morgen, wenn sich das Gewitter erschöpft hat, liegt im Gras rund um die Tonne das Gespei der übergeschwappten, nächtlichen Urgewalt: geschrumpfte Schaumflocken, zerknickte, zu letaler Durchsichtigkeit ausgewaschene Blüten. Die Karauschen treiben mit weißen Bäuchen nach oben, der Tod nimmt ihnen die einzige Würde der Kreatur, wie sichs gehört im Raum angeordnet zu sein.
Du stehst da, ein kleines Kind, die Wange noch warm vom Kissen. Und nichts und niemand tut dir leid: Nicht Fisch, nicht Blütenstand, nicht Knospen, als hättest du das schon dutzendmal gesehen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten; als sei dir von allen Lauten der Erde nur einer lieb.
Der Laut von Wasser, das steil in die Regentonne stürzt.

Kirill nahm noch einen Schluck Wein, zündete sich eine Zigarette an, schloss die Datei mit dem angefangenen Text, schob das Notebook weg.
Jetzt war niemand im Haus, er konnte drinnen rauchen. In der Ecke hatte er als Kind geschlafen. Nur das Sofa war verschoben. Und es regnete nicht. Auch wenn es dieselbe Jahreszeit war: Anfang Juli.
Warum hatte er den Text so begonnen, mit der Erinnerung an das Gewitter?
In der Ferne, an der Bahnstation, heulte ein Vorortzug auf – der letzte Richtung Moskau. Bis zum Morgen. Der Zug fuhr los, also wurde gerade der Bahnübergang geschlossen.
Kirill dachte daran, wie er sechs Stunden zuvor in der Autoschlange an diesem Bahnübergang gestanden hatte: Ein kühler Abend, Tau im Gras, geschwollene Tropfen auf heißen Motorhauben. Links von ihm – Häuser hinter blickdichten Zäunen, schweigend, ohne Licht. Rechts von ihm – ein gewundenes Flüsschen in einer Niederung, im Schilfgestrüpp, umgeben von Wiesen. Von dort, von den Wiesen, waren Schwaden eines dichten Nebels herangekrochen, der unter trügerischem Regenbogen im Scheinwerferlicht tanzte.
Windstille. Alle Geräusche vom Nebel geschluckt. Und da – ein diffuses Licht in den schemenhaften Nebelschwaden, das sich in einen hellgelben, beweglichen Kegel verwandelte. Alle Fahrer hatten sich dorthin umgedreht. Aus dem Halbdunkel näherte sich etwas, so bedrohlich wie die Aureole der Sonne – ein Zeichen künftiger Ereignisse, so ungeheuerlich, dass sie der stummen Materie dies Symbol entreißen konnten.
Ein Moment – und die unheimliche Empfindung verschwand. Bremsend war der Moskauer Vorortzug an den Bahnübergang herangerollt; grell hatte sein frontaler Scheinwerfer geleuchtet.
Eine Lichtkugel. Sie führte Kirill zurück über eine Assoziationskette zur Erinnerung an den nächtlichen Sturzregen.
Eine Lichtkugel. Dieses Bild verband er mit Großmutter Lina. Kirill schloss die Augen, versuchte, sich die Gewitternacht von damals vorzustellen.
Wieder war er ein Kind, wieder hörte er, wie das Radio durch ein Störrauschen und das singende Gestöhn der Funkwellen verkündete: »Im Gebiet Moskau wird vor starkem Sturm mit einer Windgeschwindigkeit bis zu zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Metern pro Sekunde gewarnt.«
Jenes Gewitter hatte sich wochenlang angekündigt, sie mit Hitze und Schlaffheit gepeinigt. Großmutter Lina hatte trotz Knochenschmerzen Stützen unter die fruchtschweren Apfelbaumzweige gestellt. Es war ein erntereiches Jahr, Großmutter sagte, sie könne sich nicht an eine solche Menge von Äpfeln erinnern, höchstens mal vor dem Krieg, im Juni einundvierzig.
An Tag sieben dann, als es schon schien, dass sich das Gewitter zerstreue, erschöpft von allzu langer Anstrengung, oder es woandershin ziehe, sich hinterm Horizont entlade, hatte das Radio vom Morgen an verkündet: »Im Gebiet Moskau wird vor starkem Sturm mit einer Windgeschwindigkeit bis zu zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Metern pro Sekunde gewarnt.«
Kirill glaubte der Warnung nicht: Das Himmelsgewölbe war fahl, die Gräser und Zweige bewegungslos; selbst das Wasser schien stillzustehen, geschwächt von der Hitze strömte es kaum noch im Waldbach.
Nach Mittag zeigte sich in der Ferne eine graue Wolkenwand. Als sie sie bemerkte, hörte Großmutter Lina auf zu essen – ein unglaublicher Vorgang, denn sie schwor auf die Vollendung alles Begonnenen, jeder Bewegung, Geste, Phrase –, und eilte in den Gemüsegarten, um Werkzeug und Sachen einzusammeln, und Kirill beauftragte sie, die Fenster fest zu verschließen; jeden Riegel.
Etwas an ihr hatte Kirill nie zuvor beobachtet. Als seien ihr schreckliche Gespenster auf den Fersen, für ihn unbegreifliche Katastrophen: Kriege, Feuersbrünste, Überschwemmungen. Aber dennoch wurde sie nicht hektisch, sondern sammelte die Dinge mit kargen, exakten Bewegungen ein, und ihre Schritte durchmaßen die kürzeste Strecke, als sei sie zuvor errechnet und eingeübt worden.
Sie holte gleichsam ihre Nächsten aus der Gefahr – die alte Zeltbahn zum Tragen von Heu, den Hocker, auf den sie sich beim Stachelbeersammeln setzten. An der Außentreppe trieb sich ein zugelaufener Kater herum, aber dem schenkte Großmutter keine Beachtung – die unsichtbare Kuppel ihrer Besorgnis deckte nur Menschen und Menschliches ab.
Kirill lief durch die Zimmer, überprüfte die Fensterriegel. Er trat zur Vortreppe hinaus, verstimmt durch Großmutters beunruhigte Vorsorge – ein Regen eben, was gab es da zu befürchten?
Dann deckten sie die Gewächshäuser ab. Kirill schleppte glatte Pflastersteine, um die Folie zu beschweren – und durch ihre Last verinnerlichte er allmählich die gewichtige Stärke des kommenden Sturms. Als Gurken und Tomaten abgedeckt waren, richtete er sich auf, drehte sich um – und erstarrte.
Verschwunden waren die konturierten, von Norden kommenden Wolkenzüge. Am Himmel hatten sich Farbe und Materialität verändert, als zerfräße ein fataler, galoppierender Wundbrand die Himmelskuppel.
Daraus zuckte wie aus einem Schlangenmaul eine violette Zunge, beleckte etwas hinter dem Wald.
Ein Donnerschlag, ohrenbetäubend.
Auf einmal pfiff der träge Wetterhahn aus Aluminium – ein Geschenk von Armeefreunden des Großvaters, geschmiedet in einem Flugzeugwerk. Dann brummte sein Propeller, verschwamm zu einer hellen Scheibe.
Der Wind stieß sanft gegen die Wände. Die mit Nägeln befestigten Scheiben zitterten, klirrten. Synchron wiegten sich die Baumkronen.
Der Wetterhahn verlangsamte sich, erstarrte wie eine Spinnangelrolle, wenn der Hecht den Köder berührt hat und verschwunden ist.
Regen setzte ein – tock, tock, tock, tock-tock, tock-tock-tock, tock-tock-tock-tock-tock … Große, reine Tropfen lärmten im Laub und auf dem Dach. Nichts Schlimmes. Ein sommerlicher Regenguss, vielleicht etwas stärker als sonst.
Wäre da nicht diese graue Himmelsgeschwulst gewesen.
Großmutter Lina, die sich einen Regenmantel übergeworfen hatte, ging über den Hof und sammelte alles aus Eisen ein – die auf dem Beet vergessene Hacke, die Schaufel, den Mülleimer, die in Seifenlauge eingeweichte Bratpfanne.
Bei Gewitter fürchtete sie die Blitze.
Schon vor einiger Zeit hatte sie ihren Sohn, Kirills Vater, gebeten, die hohen Birken auf dem Grundstück zu beschneiden. Hohe Bäume ziehen Blitze an, sagte sie. Sie schien zu meinen, die Elektrizität des Gewitters suche sie, wolle sie treffen.
Man hielt es für eine Grille: Jeder hat so seine Ängste. Auch Großmutter selbst lachte bei Gutwetter über ihre Furchtsamkeit. Aber nun näherte sich der Sturm, und Kirill fühlte, dass Großmutters Angst begründet war. Sie schien zu wissen, was genau geschehen könne, und sammelte alle Dinge ein, die etwas Ungutes anziehen und – in direktem wie im übertragenen Sinne – sein Leitmedium werden konnten.
Nachdem der Regen Gras und Blätter benetzt hatte, war er nun fast vorüber. Der Wetterhahn drehte sich apathisch.
Der Himmel schien gläsern, wölbte sich zur Erde nieder, und mittendrin verdickte sich giftiger, tintenschwarzer Modder.
Der Wetterhahn fing wieder an zu singen, wie eine Spinnangelrolle singt, wenn der Hecht den Blinker geschluckt hat und in der Tiefe verschwindet.
Kirill schaute instinktiv zum selbstgebauten Blitzableiter, der die Fernsehantenne überragte: ein entrindetes Holzstück mit einer Metallstange oben und einem Draht, der in die Erde führte. Großmutters angespannte Erwartung hatte sich auf ihn übertragen, er fühlte, dass diese dilettantische Vorrichtung jetzt ihr einziger Schutz war.
Das Lampenlicht erzitterte. Von oben stürzten die Wassermassen auf das Haus. Wegen der Feuchtigkeit beschlugen sofort die Scheiben. Aus den Regenrinnen fluteten tosende Ströme in die Tonnen, das Wasser peitschte so heftig gegen die Fenster, dass es durch die Risse der Verkittung drang.
Großmutter Lina zog im Flur ihren Regenumhang aus. Kirill stieg zum Dachboden hinauf, ein Stockwerk näher zum Donner.
Das Licht flackerte krampfhaft. Blaue Blitze zerschlitzten den Modder. Im Strudel des Regengusses kreiste das Apfellaub.
Ein Zweig brach ab an der Arkade, deren Rinde Großmutter von der Flechte kurierte. Der gegabelte Antonowka-Apfelbaum brach entzwei, die Bruchteile senkten sich, prallten auf die Erde und warfen dabei Äpfel in alle Richtungen. Die Baumkronen der hohen Birken wurden hin und her geworfen, in der Höhe unerreichbar für den Blick, es war nur zu sehen, wie sich im Wind die beleibten Stämme verzogen und zur Seite legten. Jede der Birken hätte aufs Haus stürzen, seinen dünnen, vom Dachstuhl gehaltenen First zerschmettern können.
Das Licht erlosch.
Hagel. Die Eisklümpchen, Zuckerkörnchen des Sommers, trommelten gegen die Scheiben.
Wasser tropfte von der Decke, drang durchs Dach – das alte Haus war nicht für einen solchen Sturm gemacht.
Mäuse liefen umher, kamen die Treppe hinauf, der Keller lief wohl voll, wie viele es waren!
Ein archaisches Licht warf lange Schatten – Großmutter hatte im Erdgeschoss eine Kerze angezündet.
Eigentlich gab es jede Menge Menschen ringsum, in den Nachbarhäusern. Aber er fühlte sich allein mit seiner Großmutter, in Wind, Nebel und Regen.
Gewöhnlich schien Großmutter Lina zu wissen, wo im Haus sich Kirill aufhielt, hatte ihn stets im Blickfeld ihrer zerstreuten, aber feinen Beobachtung. Jetzt war dieses Feld verschwunden. Großmutter Lina ging mit der Kerze umher und überprüfte erneut die Fensterriegel. Ihre Gestalt spiegelte sich in den beschlagenen Scheiben. Sie bewegte sich wie eine Mondsüchtige.
Ein Schlag – und das Fenster zerbarst, getroffen von Apfelbaumzweigen. Die Kerze fiel Großmutter aus der Hand, rollte über den Boden, aber erlosch nicht. Großmutter griff nach einem Schneidebrett, hielt das Loch im Fenster zu, als erwarte sie, dass von draußen jemand hindurchkriechte. Kirill hob die Kerze auf, merkte nicht, wie das heiße Wachs seine Finger verbrannte, und stellte sich hinter sie. In der Fensterscheibe daneben zeigte sich die Kerzenflamme – aber nicht schmal, mit spitzem Zünglein, sondern als leuchtende, regenbogenfarbige Kugel. Großmutter zuckte zusammen – und wich zurück, hielt das Schneidebrett vor sich wie ein Schild: Angstvoll wehrte sie diese flackernde Kugel ab.
Der Wind stieß durch das zerschlagene Fenster und löschte die Kerze; die Lichtkugel, die sich in der Scheibe gespiegelt hatte, verschwand.
Großmutter Lina sank zu Boden. Kirill stürzte zu ihr. Ihr Atem war schwach, still, aber leicht und rein, als atme keine gealterte, an Asthma leidende Frau, sondern das kleine Mädchen, das sie einmal gewesen war.
Eine Minute. Eine zweite, dritte. Ihr Atem veränderte sich nicht.
Er bemerkte an der Wand das weiße Schränkchen mit der Hausapotheke, in seinem Kopf tauchte das fahle Wort »Ohnmacht« auf, und dann das scharfe, stark riechende, schneidende Wort »Salmiak«.
Kirill führte einen mit Salmiak getränkten Wattebausch an Großmutters Nase. Er erinnerte sich daran, wie Großmutter mit Salmiak alte Flecken entfernt, den Silberring gereinigt, die Patina abgerieben hatte. Jetzt glaubte er an diese Substanz wie ein Alchemist, meinte, dass sie das aus seiner Großmutter vertreiben würde, was sich bei ihr einquartiert hatte und ein tiefes Atmen verhinderte. Der Salmiak ließ ihn nicht im Stich, Großmutter öffnete die Augen, schob seine Hand mit der Watte beiseite und sagte schwach:
»Es reicht, Papotschka, es reicht, das brennt …«
Kirill bemerkte in diesem Moment das »Papotschka« nicht, es klang für ihn wie »Lapotschka« – Großmutter nannte ihn so, wenn er sich übereifert hatte und ihm in seiner Beflissenheit Eleganz und Genauigkeit abhandenkamen – Lapotschka. Er war viel zu froh, um zu merken, dass da ein »P« anstelle des »L« gewesen war.
»Bring mir Wasser, bitte«, bat seine Großmutter. Wenn sie so höflich war wie immer, dann war sie wohl wieder bei vollem Bewusstsein und ihre seltsame Angst verschwunden.
Kirill half ihr aufzustehen. Er wollte fragen, warum sich Großmutter vor der leuchtenden Spiegelung im Fenster erschrocken hatte, fühlte aber, dass sie keine Fragen beantworten wollte.
»Ich gehe schlafen«, sagte er und küsste sie auf die Wange.
»Geh, mein Lieber«, sagte sie sanft. »Der Sturm legt sich schon.«
Er schloss hinter sich die Tür.
Der Regen peitschte nicht mehr, klopfte nur unregelmäßig und einförmig; alle Raserei war aus seinem Klang gewichen. Kirill fühlte sich erschöpft, als habe ihn ein Orkan in die Luft gehoben, zu Boden geworfen, an ihm gezerrt und gerissen, mit jähen Stößen geschlagen. Seine Muskeln schmerzten. Kirill wurde klar, dass er den Sturm zusammen mit den Apfelbäumen durchlitten, in Gedanken und Gefühlen gekämpft, ihre Stämme gestützt, ihre Zweige gehalten hatte. Er war völlig entkräftet, körperlich wie geistig. Ohne das Bettzeug zurückzuschlagen, fiel er auf sein Sofa in der Ecke und schlief ein. Das Wasser tropfte dumpf in die Regentonnen; er fühlte die Gespanntheit ihrer Metallringe.
Kirill schlief traumlos – auch für Träume braucht man Kraft; er stürzte in die Tiefe der Nichtexistenz.
Gegen Mittag wachte er auf. Kaum hatte er die Augen aufgeschlagen, lauschte er auf seinen Körper – er war leer und neu, wie unbewohnt.
Als er auf die Vortreppe kam, meinte er, noch zu schlafen und deswegen eine chaotische Welt zu sehen, in der die Dinge noch nicht in die Realität zurückgekehrt waren, ihren Platz gefunden, die gewohnte Ordnung angenommen hatten.
Den Weg von der Vortreppe versperrten Zweige des umgestürzten Apfelbaums. Leere gähnte anstelle der Baumkronen und Stämme, als habe sie ein Übeltäter beschlagnahmt, in eine andere Dimension verschleppt und damit die gewohnten Eckpfeiler des Sehens, Bewusstseins, Gedächtnisses entfernt.
Aus den zerbrochenen Stämmen floss schäumender Saft, aber das Laub welkte bereits; gestern war es noch voller Leben gewesen, nun war das Leben vergangen – rasch und restlos. Nur die vom Wind abgeschlagenen Äpfel leuchteten im Gras, abgespült vom Regen.
Die Pappel am Zaun war umgestürzt. Ihr Laub war ausgedünnt, aber immer noch glänzend und prall. Man hätte meinen können, die Pappel wüchse an ihrem angestammten Ort wieder an, wenn man sie aufhöbe. Die Apfelbäume, ausgelaugt vom Reifen ihrer Früchte, waren leblos. Der fruchtlose Pappelbaum hingegen erwies sich als standfester. Ein scheußliches Lebensgesetz zeigte sich Kirill darin.
Der Garten war völlig verwüstet. Die Folie der Gewächshäuser, die sie so mühsam geflickt hatten, war zerfetzt. Abgebrochen der Johannisbeerstrauch, die Pflaumenbäume, und nur der kleine, garstige Stachelbeerstrauch hatte überlebt, sich mit dornigen Zweigen verkrallt. Die Beete waren ausgeschwemmt, aus der Erde ragten die elenden Kinderleiber unreifer Möhren und Rüben. Gurkenranken steckten im Schlamm; winzige Gurken, die am Vortag noch ein zarter Flaum umhüllt hatte, der silberhelle Schweiß der Geburt, schwammen in Dreckpfützen.
Die Nachbarn hatten es am Vortag nicht geschafft, die Wäsche von der Leine zu nehmen. Jetzt hing das alte Kattunkleid mit den tiefroten Rosen am Zaun, Säuglingshemdchen leuchteten im Gras wie Zeugen einer verzweifelten Flucht: als habe sich jemand in der Finsternis in Sicherheit bringen wollen, verfolgt von den Dämonen der Nacht; die aufgewirbelte Spur dieser Jagd lag noch in der Luft, war zu riechen.
Erst jetzt bemerkte Kirill, dass in der frisch gewaschenen Gewitterluft ein Geruch nach Feuer lag; über dem Dorf stieg das Rauchwölkchen einer glimmenden Brandstätte auf.
Er wusste gleich, woher der Rauch kam, wessen Haus abgebrannt war.
Das Haus von Spieß, seit kurzem herrenlos.

Kirill erinnerte sich auch Jahrzehnte später an den gestorbenen Alten, als habe er ihn erst am Vortag gesehen.
Spieß – das verhieß schon sein Rufname, abgeleitet von seinem Rang als Oberfeldwebel – nahm im Dorf eine Sonderstellung ein und hatte eine besondere Ausstrahlung.
Dabei war er nur von mittlerer Größe gewesen, hatte eine unscheinbare Figur, ein gewöhnliches Gesicht, nun ja, es war pockennarbig, aber das kam vor; vernachlässigte Kleidung – ein Knopf abgerissen, die Manschetten am Hemd durchgescheuert –, so liefen viele Männer im Dorf herum.
Aber alle wussten, dass er zweimal fast »Held der Sowjetunion« geworden wäre und beide Male den »Goldenen Stern« nicht bekommen hatte. Mit seinen Orden und Medaillen, die er ansonsten in Hülle und Fülle besaß, prahlte er nicht, bewahrte sie in einer Schachtel unter der Hobelbank auf und zeigte sie niemandem – meins, hart erkämpft –, er schien ihnen auch keine besondere Bedeutung zuzumessen. Nie lud man ihn ein, vor einer Pioniergruppe aufzutreten oder an der Kriegsgräberstätte einen Kranz niederzulegen.
Nur die Scharfsinnigsten ahnten, dass Spieß grimmiger Neid plagte gegenüber jenen Offizieren und Kommandeuren, die seinem Blut all ihre »Roten Sterne« und »Roten Banner« verdankten, sowie ihre Kutusow- und Suworow-Orden [1] , welche ihm, dem Rangniederen, seinem Status nach nicht zustanden. Reichlich hatten sie sich Ruhm und Wohlstand vom großen Siegeskuchen abgeschnitten, mit Lastern und Militärtransporten deutsches Gut heimgeschleppt und später Memoiren über den ruhmreichen Kampf ihres Regiments oder ihrer Division geschrieben, mit Titeln wie »Unter dem Banner der Garde« oder »Frontwege«. Und wer war er gewesen? Ein Oberfeldwebel – solche Oberfeldwebel lagen massenhaft unter der Erde.
Spieß war hier im Dorf geboren worden, hatte im Krieg in der Aufklärung gedient, war in sein Dorf zurückgekehrt. Man munkelte – verstohlen –, Spieß habe in den späten vierziger Jahren krumme Dinger gedreht, Moskau war nah, und zwar mit ebensolchen Draufgängern wie er. Dann aber habe er damit aufgehört, sei Wächter in einem Gemüsegroßmarkt geworden, habe an illegalen Fuhren verdient. Aber das waren alles Gerüchte. Es kam vor, dass ein Miliz-Auto vor seinem Haus stand, dann war der Kriminalchef des Bezirks da, um eine Flasche mit ihm zu leeren, auch er ein Aufklärer, ein Frontkamerad.
Natürlich zollte man Spieß Respekt, dass er niemandem seine Orden unter die Nase hielt, aber nicht nur deshalb. Der Grund war ein anderer. Da hackt zum Beispiel jemand Holz mit einer Axt – ein friedliches Bild. In den Händen von Spieß jedoch bekam das Eisen – sei es eine Axt, eine Säge, ein Stemmeisen, ein krummes Gartenmesser – eine andere Bedeutung; unfriedlich wurde es, ungut. Die Zähne der Säge, die Klinge des Beils, die Schneide des Stemmeisens, übersatt von Birken und Espen, abgestumpft an Bastrinde und Mark, schienen auf einmal neu zu erwachen, bekamen Durst, nicht auf den Saft von hölzerner Unschuld, sondern auf salzig-heißes Blut; und das fühlten die Dörfler, deswegen war Spieß eben Spieß.
Nur seine unmittelbare Nachbarin, die Fedossejewna, eine Städterin, der Arbeit wegen ins Dorf versetzt, als linientreue Komsomolzin – nur sie urteilte anders über Spieß. Vor dem Krieg hatte sie seinen Nachbarn geheiratet, einen Vorzeige-Traktoristen. Und der war in seinem Panzer gleich hinter der Oder verbrannt. Als es dort gerade noch ein paar Dutzend »Tiger« und »Panther« gab, wurde er aus dem Hinterhalt von zwei »Katzen« erwischt, wie sie die deutschen Panzer nannten – die versengten den ganzen Zug, der gerade an einem Bewässerungskanal nach einem Übergang suchte.
Die Fedossejewna trauerte länger um ihren Mann, als es im Dorf üblich war. Dann wurde sie stellvertretende Schulleiterin – unterrichtete Geschichte – und wollte an der Schule ein Heimatmuseum einrichten, die Landsleute befragen, wie es im Krieg gewesen war, was sie erlebt hatten.
Daran entzündete sich dann auch der Zwist mit Spieß. Zuvor lebten sie besonnen, grüßten sich freundlich, Spieß half ihr sogar mit den Gewächshäusern – die Angelegenheit einer Witwe immerhin, das war ihm heilig. Auf eigene Weise achtete er sie für die lange Trauer, dafür, dass sie ihm treu blieb, dem fünfundzwanzigjährigen Gefallenen, seinem Freund aus Kindertagen, von dem das Bestattungskommando nur noch Asche und Ruß aus dem Panzer gekratzt hatte. Da musste sie doch der Teufel reiten, mit ihren Befragungen ausgerechnet bei ihm zu beginnen, und auch noch zwei Pioniere mitzubringen, einen Jungen und ein Mädchen, die das Gespräch mitschreiben sollten.
»Das frag mal besser deinen toten Mann«, antwortete Spieß der Fedossejewna auf ihre Bitte zu erzählen, wie er gewesen sei, der Krieg, damit die Kinderlein geschult werden am Veteranenvorbild. Und schloss die Tür.
Wäre ein Mann an ihrer Stelle gewesen, hätte Spieß einfach zugeschlagen. Nicht einmal sich selbst konnte Spieß eingestehen, wie sehr die Fedossejewna ihn getroffen hatte, denn eigentlich wollte er seine verhärtete Seele erleichtern. Also wusste sie um seinen geheimen Wunsch, das machte Spieß rasend. Über ihrem Zwist, dieser Verstimmung, hing bereits der Schatten eines Unglücks, den aber noch niemand sah.
Die Leute im Dorf wussten, dass Spieß im Juli, am Tag seiner Verletzung in der Schlacht am Kursker Bogen, die Fensterläden schloss und trank. Die einen mutmaßten, er würde Stalins Porträt von der Wand nehmen, ein Glas eingießen, es direkt unter den Schnurrbart stellen und mit dem Führer anstoßen. Andere erklärten, an diesem Tag packe ihn eine schlimme, angestaute Wut auf seine einzige Verletzung, die nicht sonderlich militärisch war – ein Minensplitter hatte ihm ein Stück Fleisch aus der Hinterbacke gerissen. Er trank im zugesperrten Haus, goss sich das volle Maß seines alten Hasses auf den Feind ein, trank viel – der Fusel wirkte kaum bei dem Verhärteten – und gegen Abend kam er heraus, ohne zu schwanken, mit festem Schritt – und begab sich auf die Suche nach den Deutschen.
Die Dörfler hatten Verständnis, erinnerten ihn nicht daran, dass der Krieg schon mehr als dreißig Jahre vorbei war. Sie sagten ihm, da seien wohl Deutsche gewesen, doch die wurden vertrieben von unseren Recken, genau vor einer Woche, verschwunden seien sie in Richtung Westen, hätten keine Garnison zurückgelassen, denn das Dorf sei ja klein, ein Brunnen nur. Sie brachten dem heldenhaften Befreier ein Glas Branntwein und ein hartgekochtes Ei, dazu graues, grobes Salz. Die reine Kraft liegt darin, sagte Spieß immer, der das feine, weiße Ladensalz verachtete.
Die Kinder versteckten sich in Straßengräben und Büschen, ein kostenloses Schauspiel war es für sie. Die Erwachsenen jedoch nahmen es ernst. Niemand machte Spieß danach Vorwürfe, von wegen – da geht er durchs Dorf und erregt Aufsehen. Selbst als Spieß den neuen Postboten verprügelte – die Arbeit machte den Sommer über jemandes Neffe, der war in einer modernen Feldjacke auf seinem Fahrrad unterwegs, die von weitem aussah wie eine deutsche Uniform, so dass Spieß meinte, ein deutscher Verbindungsmann habe sich hierher verirrt, die Deutschen waren ja oft auf Zweirädern unterwegs, und auch das Fahrrad war wohl kein heimisches, so schnittig, das kam wohl aus dem Baltikum – selbst als Spieß also den Postboten als »Informanten« fasste und ihn verprügelte, war das Dorf auf seiner Seite, und die Tante untersagte ihrem Neffen aufs allerstrengste, bei der Miliz Anzeige zu erstatten.
Einmal bekam die Fedossejewna im Frühjahr einen neuen Ganter, aus Polen oder Ungarn. Ein entfernter Verwandter, der in den sozialistischen Ländern arbeitete, hatte der Alten eine Freude machen wollen. Der Ganter war tatsächlich von feiner Abstammung – reinweiß wie frisch gefallener Schnee; der orangene Schnabel leuchtete heller als eine Mandarine; der Rumpf war gewaltig, aber nicht schwerfällig, als stünde ihm das Fliegen eher an als das Watscheln. Böse und grausam war er, biss den alten Ganter tot, obwohl der älter war und stärker; ein außergewöhnlicher Ganter also.
Die Fedossejewna nannte ihn Martyn – ihr gefiel der freche Klang des Namens, er passte zu diesem Ganter. Aber Spieß taufte den Ganter um. Als er an seinem Trinkertag auf die Dorfstraße trat, lief ihm der Ganter über den Weg, zischte. Spieß zählte Haustiere und Geflügel wie auch Waldtiere nicht zum Lebendigen. Er wurde geholt, um Schweine abzustechen und zu sengen, Geflügel zu schlachten, aus Jux schoss er Hasen in den umliegenden Wäldern, fuhr zu seinen Frontfreunden nach Sibirien, um einen Bären aus seiner Höhle zu holen, und nun war da dieser Ganter. Aber Spieß – trunken bis zur schrecklichsten Nüchternheit – schaute zum Ganter und sagte mit ungutem Lächeln, mit mörderischer Verwunderung:
»Der reinste Fritz! Ein Friiitz!«
Den Ganter mit seinem Blick betastend, über dessen langen Hals streichend, fügte er hinzu:
»Werde groß, Fritz, und wachse. Und dann …«
Der Ganter trat zurück – wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, er floh sonst weder vor Hund noch Katz. Verwirrt drehte er den Kopf, zischte Spieß dann aber noch hinterher, den Hals gespannt.
So bekam der Ganter seinen neuen Namen – Fritz. Die kleinen Jungs erzählten es weiter, die alten Weiber klatschten, und dann nannte das ganze Dorf den Ganter so, wegen seines zänkischen Gemüts und der fremdartigen Vornehmheit. Die Fedossejewna sträubte sich, aber auch der Ganter vergaß seinen ehemaligen Rufnamen, die Jungen neckten ihn – Fritzelein, leg Eierlein –, und er geriet in Aufregung, schlug aber nicht mit den Flügeln, sondern reckte seinen Hals und wollte zubeißen. Die Fedossejewna vergoss ein paar Tränchen – Spieß hatte ihr den Ganter gleichsam gestohlen, ihn zu seiner Gattung umgemodelt, aber dann gewöhnte sie sich daran, wurde sogar stolz und hielt ihren Ganter ebenfalls für einen Deutschen, auch wenn dieser weder die DDR noch die Bundesrepublik je gesehen hatte.
Drei Jahre darauf geschah es schließlich, Fritz war inzwischen ausgewachsen. Alles Kleingetier hatte er sich untertan gemacht, und schon wuchsen seine Jungen heran – vom Charakter her wie der Vater, Intriganten, nur seine schneeweiße Farbe hatte keiner geerbt, alle waren leicht grau geraten; ach, eine verdorbene Rasse –, sagten die Dörfler schadenfroh.
Kirill sah an jenem Tag alles mit eigenen Augen. Er spielte mit seinen Kameraden auf einem Sandhaufen Partisan: im Sand werden Wege angelegt, der »Lenker« – ein deutscher Fahrer – zieht einen Spielzeuglaster an einer Schnur, und die Partisanen haben Minen gelegt, Stöckchen, an denen Schnüre befestigt sind, und zieht man rechtzeitig daran, trifft das Stöckchen den Laster von unten, und der kippt um; schafft man es nicht, fliegt Sand in alle Richtungen und der deutsche Konvoi fährt weiter. Der Sandhaufen war beim Teich, nahe der Häuser von Spieß und der Fedossejewna.
Betrunken war Spieß an jenem Julitag, an dem ihm, der damals flach am Boden gekrochen war, ein deutscher Splitter den Hintern aufgeschlitzt hatte. Er trat vors Tor, starrte die Kinder an, und schon verging dem »Lenker« die Lust, den Lastwagen zu ziehen. Spieß kam auf sie zu, besah sich die Disposition, brummte – Scheißpartisanen –, schaute von einem zu anderen. Er mochte keine Kinder, nannte sie Pest, verfluchtes Elend; aber er rührte sie nie an. Zum ersten Mal bemerkte Kirill, was für riesige Hände Spieß hatte, als seien sie für einen Zweimeterriesen gemacht und Spieß im Hospital angenäht worden; er sah das graue Wolfshaar, das ihm auf den Fingern wuchs, die dicken, gelben Nägel.
»Husch, haut ab!«, kommandierte Spieß. Alle Freunde von Kirill verdrückten sich zum Zaun, die Straßengräben entlang; er aber musste in die andere Richtung, zögerte ein wenig, und Spieß hatte sich bereits abgewandt in der Gewissheit, dass seine Worte alles und jeden hinwegfegten.
Kirill verzog sich zum Sandhaufen.
Spieß ging indes zum Teich, und wieder sah Kirill seine riesigen Hände, die in Taschen wohl kaum Platz gefunden hätten; nicht menschlich waren sie, sondern bullig, bärenhaft.
Auf dem Teich schwammen die Gänse der Fedossejewna; Fritz stolzierte am morastigen Ufer entlang, bewachte die das Wasser erforschenden Gänsejungen. Als er Spieß sah, drehte sich der Ganter um und ging ihm entgegen; er zischte, seine Augen waren wütend, er erkannte seinen Beleidiger, Spieß hatte ihn, auch nüchtern, oft geärgert. Man hätte meinen können, Spieß wiche zurück, drehe sich weg, liefe sogar davon, denn ein Betrunkener konnte es mit dem schlauen und wendigen Ganter nicht aufnehmen, und Spieß’ Bosheit war matt, verfault, wie eine Salzgurke vom Vorjahr; der Ganter hingegen voll reiner, triumphierender Wut, als sinne er schon lange auf Revanche.
Aber Spieß schien nur auf den Angriff des Ganters gewartet zu haben. Mit einer unmerklichen Bewegung des Arms, der auf einmal allzu lang, teleskopisch geworden war, packte er den Ganter beim Hals, hob ihn hoch, presste die Hand zusammen, sperrte ihm die Luftzufuhr. Der Ganter zappelte, schlug mit den Flügeln, er war an die fünfzehn Kilo schwer – wie konnte man ein solches Gewicht mit ausgestrecktem Arm halten? Aber Spieß hielt ihn, und Kirill begriff, welche Kraft im Körper des Alten wohnte, eine zähe, klammernde Kraft, wie bei einem Schraubstock; das begriff er, als sei er selbst jener Ganter, als fühle er stählerne Finger an seinem Hals.
Der Ganter sackte zusammen, die Flügelenden zitterten leicht. Seine Augen, aus denen die Wut des Angriffs gewichen war, wurden sanft, rollten weg; und Spieß strich dem Ganter mit der linken Hand über den Kopf und sprach dabei:
»Das war’s nun, Fritz. Reingefallen. Schluss und aus, Fritz, wehr dich nicht. Das macht’s nur schlimmer. Das war’s Fritz, deine Zeit ist um, vorbei.«
Spieß schaute dem Ganter direkt in die Augen, und Kirill wurde klar, dass Spieß gerade keinen Vogel sah, sondern irgendeinen deutschen Gefreiten, einen Militärkoch oder einen jungen Adjutanten, der unglücklicherweise im falschen Moment aus der Deckung getreten war. Still musste dieser kleine Deutsche sterben – er war nutzlos, von niederem Rang –, durfte nicht schreien, nicht aufschluchzen, und deswegen begleitete Spieß den kleinen Deutschen in den Tod, flüsterte seine Worte fast zärtlich, damit dieser sich auf dem Totenweg nicht verirrte, keine Sekunde lang zurückwollte, gehorsam und diszipliniert starb, ohne unnötigen Aufruhr.
Kirill wollte hervorspringen, sich an Spieß’ Hand klammern, den Ganter befreien. Aber er fühlte, Spieß würde auch ihn, den Jungen, für jemand anderen halten: in diesem Moment sah Spieß weder Teich noch Gänse oder Dorfhäuser, er war ganz und gar dort, im Krieg, in den Sümpfen am Dnjepr oder in irgendeiner zerschossenen, deutschen Kleinstadt. Es gab keine Möglichkeit, ihn von dort herauszuholen, denn alles in seinem Kopf war verrückt; und wenn er an Kirills Stelle einen Kindersoldaten des Volkssturms sah, dann war das wirklich so; dann sah er ihn nicht unklar wie in einem trügerischen Traum, sondern mit letzter Gewissheit, und seine Erinnerung kleidete Kirill um, veränderte sein Gesicht, drückte ihm eine Panzerfaust in die Hand.
Furchtsam war Kirill schon immer gewesen, aber so fürchtete er sich zum ersten Mal. Er merkte, dass er sich eingenässt hatte. Der König aller Ängste war in Gestalt von Spieß gekommen und würgte den Ganter Fritz. Spieß glaubte, er töte einen leibhaftigen Deutschen; und der Schrecken bestand in der Möglichkeit selbst, dass so etwas geschehen konnte, denn das hieß, es gab keine Grundfeste, keine Gesetze zwischen den Menschen.
Spieß hatte Fritz mit beiden Händen beim Hals gepackt und zugedrückt. Der Kopf des Ganters begann sich zu drehen. Erst jetzt hörte Kirill, wie der Ganter schrie – nicht zischte, nicht schnatterte, sondern schrie. Der Laut ähnelte der menschlichen Rede, als mühe sich der Ganter zu erklären, er sei kein deutscher Soldat und riefe die Welt als Zeugen an. Aber der Kopf bewegte sich schon unnatürlich, wie Lebendiges sich nicht bewegen kann. Dann knirschte es, das raue Lebensfädchen riss, der Kopf kippte zur Seite; grüner Magensaft tropfte aus dem Schnabel.
Spieß legte den Ganter vorsichtig auf der Erde ab, stand da, starrte den verendeten Vogel an. Dann ließ er seinen Blick umherstreifen, erblickte wie von Neuem die anderen Gänse, die sich um den Teich drängten und leise schnatterten. Fritz’ Sohn, dem Alter nach der zweite Ganter der Herde, trieb sie zusammen und stellte sich ein winziges Stück voran, um seine Anführerschaft zu bezeichnen, Spieß dabei aber nicht mit Kühnheit zu reizen.
Kirill wollte rufen – fliegt, lauft weg, rettet euch! – aber es hatte ihm die Sprache verschlagen. Und Spieß murmelte mit kaltem Eifer:
»Die Fritzen! Uuuh, wie viele ihr seid! Die Fritzen!« Er ging zu seinem Haus, wiederholte nur »Uuuh! Uuuh!«, nicht wie ein Mensch oder ein kleines Waldtier, sondern als habe sich in ihm ein tiefer, fleischfressender Abgrund von der Größe eines Dinosauriermagens aufgetan, aus dem dieses Uuuh nun drang.
Kirill hatte ein wenig gehofft, Spieß würde noch ein Glas trinken gehen, und dann hätte er die Gänse ins Gebüsch, ins Schilf gejagt oder jemanden von den Erwachsenen gerufen. Spieß war im Haus verschwunden; Kirill wollte weglaufen, aber in ihm erwachte gleichsam ein Soldatengespür, das sagte: ruhig, versteck dich. Und richtig – Spieß kam mit seinem Jagdkarabiner auf die Veranda, darauf steckte ein Visier. Er hockte sich an den Zaun, schob den Lauf zwischen die Latten hindurch, schaute durch das Visier. Kirill glaubte, es würde ihm die Gänse näher bringen, Spieß’ Auge schärfen – die Optik, reines Glas konnte ja nicht lügen – und dann käme Spieß zu sich, würde begreifen, gegen wen er kämpfte an diesem heißen Julitag, wer sich am Teich verschanzte, die weißen Hälse reckte. Auf einmal bemerkte Kirill, dass Spieß’ Hosentaschen ausgebeult waren, vollgestopft mit Ersatzpatronen.
Der erste Schuss klang wie der Hieb einer Hirtenpeitsche. Die spitz zulaufende Karabinerkugel durchschlug den Ganter; Schuss, Schuss, Schuss, – die Gänse fielen, blutige Federbüschel wirbelten umher; Spieß schoss nicht daneben. Dann verklemmte sich der Karabiner, seine Finger ließen ihn im Stich, gehorchten nach dem Branntwein nicht mehr, luden die Patronen schief. Spieß rüttelte am Magazin und erstarrte – als sei vom Widerstand des störungsfreien Mechanismus auch in ihm etwas verrutscht.
Die Fedossejewna kam angelaufen, stürzte zu den Gänsen; die lagen im Gras, eine zuckte mit dem Flügel, Spieß hatte ein wenig danebengeschossen. Das Blut war aus der Ferne nicht zu sehen, aber man merkte, dass sie tot waren. Ein Mensch kann auch im Tod lebendig aussehen, ein Vogel hingegen liegt da wie ein Sack, alles hat ihm die Kugel genommen – die Anmut, den Charakter.
Spieß stand auf, drehte sich um – und schaute direkt zu Kirill, der sich hinter dem Sandhaufen versteckte. Kirill wollte sich im Sand vergraben, wusste aber, es war zu spät – Spieß hatte ihn entdeckt, mit jenem Blick entdeckt, der Gänse in Deutsche verwandelte. Kirill fühlte sich wieder als Ganter Fritz, spürte Hände an seinem Hals. Und er wusste, Spieß würde ihn töten, er unterschied nicht zwischen einem Jungen und einer Gans.
»Was hast du getan, Herodes! Herodes!«, die Fedossejewna stürzte sich auf Spieß und trommelte gegen seine Brust. »Herodes! Herodes! Herodes!«
Herodes; dieses Wort, das Kirill nicht kannte, versetzte Spieß einen Schlag, drang in seinen trunkenen Kopf. Vielleicht hatte er sich als Kind die Worte des Popen eingeprägt, schließlich hieß das Dorf früher nicht Tschapajewka, sondern Tschassownaja, nach der Kapelle über der Quelle und der Kirche, in der sich nun ein Lagerraum der Kolchose befand.
Kirill meinte, Spieß würde die Fedossejewna niederschlagen. Niemand durfte ihn anrühren, und sie hatte ihn am Hemdkragen gepackt. Aber Spieß setzte sich auf die Stämme nieder, schüttelte den Kopf, und dann kippte er zur Seite um. Die Fedossejewna vergaß die Gänse, rannte ins Haus, wobei ihr unreiner Unterrock von den abgetragenen Absätzen hochgeworfen wurde. Sie kam mit einem Eimer wieder und übergoss Spieß schwungvoll mit Brunnenwasser, eiskalt.
Er kam zu sich. Die Leute lugten hinter ihren Zäunen hervor, traten aber nicht auf die Straße, wussten, dass die beiden die Sache unter sich ausmachten. Spieß schüttelte angewidert seine nassen Ärmel, schaute sich um, als wisse er nicht, wer und wo er sei. Er sah die Fedossejewna mit dem Eimer und fragte friedlich, nur etwas befremdet:
»Bist du übergeschnappt, Alte? Das ist mein Tag heute. Mein Recht zu trinken.«
Spieß war so leise geworden, dass Kirill hinter dem Sandhaufen hervorkam, um ihn besser zu sehen: Wo war der Mörder, der drei Minuten zuvor auf Gänse geschossen hatte? Da saß ein harmloser Alter, trocknete sich in der Sonne, und Kirill meinte, einen schlechten Traum gehabt zu haben, der sich nicht wiederholen würde.
Aber dann begriff Kirill: Er würde sich wiederholen. Es käme ein Tag, ebenso klar, nichts Böses verheißend, und Spieß träte heraus, wirr vom Branntwein, und wen er auch träfe – einen Hofhund, ein Milchkalb, einen Elektriker mit Leiter – jeder wäre ein Faschist. Und wieder würde er, Kirill, es nicht schaffen zu fliehen, weil die anderen pfiffiger, schlauer, mutiger waren, er aber jener, der für Spieß’ Gemetzel herhalten musste, dazu verdammt war, der Ganter zu sein.
Für dieses Wissen begann Kirill Spieß zu hassen, es würde ihm von nun an keine Ruhe mehr lassen; als sei sein ganzes Leben im Voraus bestimmt.
Spieß bemerkte inzwischen die toten Gänse. Er schwieg, dann fragte er die Fedossejewna düster:
»War ich das?«
»Du«, antwortete die Fedossejewna und fing auf einmal an zu weinen, nicht so wie sonst, mit faden Tränen, sondern schluchzend, bitter und hilflos. Selbst ein Kleinkind hätte begriffen, dass sie Spieß liebte.
Spieß hickste, einmal, zweimal, dreimal, als hätten ihn die großen Dämonen bereits freigegeben, und nun kämen kitzelnde Dämonenjungen aus seinem Mund gekrochen, harmlos, aber zudringlich wie Fliegen; immer noch schluchzend klopfte ihm die Fedossejewna auf den Rücken und greinte:
»Nicht du, nicht du warst das! Das ist der verfluchte Krieg, der in dir sitzt!«
Kirill fühlte, dass die Fedossejewna Spieß verziehen hatte, voll und ganz, und dass sie ihm noch Dutzende Male verzeihen würde, selbst wenn er das ganze Dorf in Brand steckte, alles unschuldige Vieh abschlachtete. Und würde Spieß ihn, Kirill, niederschießen, dann würde die Fedossejewna um ihn weinen – aber verzeihen.
Spieß’ Schluckauf verging. Er umarmte die Fedossejewna leicht, brachte sie ins Haus, ließ jedoch nicht den Blick von den getöteten Gänsen, als wolle er sagen – meine Schuld, das weiß ich, aber anschuldigen lasse ich mich nicht.

Als Kirill im Frühjahr darauf ins Dorf kam, war Spieß nicht mehr am Leben. Man sagte, er habe im Winter jagen wollen und sei umgekommen. Viel Schnee habe gelegen, Hasen seien über den schneeverwehten Zaun gesprungen, um am Apfelbaum junge Zweige anzuknabbern. Unter der Schneedecke habe Spieß ihn nicht bemerkt, den alten Verbindungsgraben aus dem Krieg, sei mit einem Ski hineingeraten, gestürzt und habe sich das Bein gebrochen; offene Fraktur. Aber er kapitulierte nicht, löste die Skier, versuchte, ins Dorf zu kriechen, schoss mit seinem Gewehr, dachte, es hört jemand und begreift, dass er in Not ist.
Er hätte sich wohl nach Hause geschleppt, aber da setzte ein starker Schneesturm ein, überwehte die Skispur, er kam davon ab, verirrte sich. Nach dem Schneesturm wütete Frost, der vereiste den Wald, die Luft zwischen den Tannen erstarrte – kein Laut, kein Rascheln, alles eingezwängt in den Eisgriff, und nur das frierende Wasser dehnte sich aus in den Stämmen, brach von innen das eiskalte Holz.
Der Frost war es auch, der Spieß’ Herz zum Stillstand brachte. Man fand ihn steifgefroren, holte ihn mit einem Schlitten aus dem Wald, so wie man Brennholz transportiert. Im Dorf wurde getuschelt, der Verbindungsgraben sei ja ein Überbleibsel von den Deutschen, und das hieße, ein Deutscher, gefallen im Winter einundvierzig, habe Spieß aus dem Jenseits am Bein gepackt und in den Tod gerissen.
Von Spieß’ Tod erfuhr Kirill zufällig, hörte ein Gespräch der Nachbarn. Die Welt schien ihm nun geräumiger – als habe der tote Alte zuvor einen gewaltigen Platz darin eingenommen; als sei eine bedrohliche Wolke vom Himmel verschwunden.
Den Teich mit den Gänsen mied Kirill, spielte auch nicht mehr auf dem Sandhaufen. Die Gänse weideten wie immer, der neue Ganter, ein Spross von Fritz, war jetzt das Leittier, und Kirill war erstaunt, dass die Gänse sich an nichts erinnerten, weiter ihr Gänseleben führten, für das der vergangene Sommer irgendwo in weiter Ferne lag; keine Erinnerung – keine Angst. Kirill wollte lernen, sich nicht zu erinnern, zwang sich zum Vergessen von Kleinigkeiten, zum Beispiel, was sie am Sonntag zum Frühstück gegessen hatten – und merkte verzweifelt, dass sein Gedächtnis, ganz im Gegenteil, immer zupackender, tiefer, eigenmächtiger wurde, als sei Kirill nur sein Dienstbote. Er träumte davon, böse Erinnerungen auslöschen zu können, Dinge und Orte, die ihn an seine Angst erinnerten, zu vernichten.
Als er nun nach dem Gewitter erriet, dass ausgerechnet das leerstehende Haus von Spieß abgebrannt war, lief Kirill sofort los – der Pfad überschwemmt, Spritzer fliegen, Frösche hüpfen beiseite –, schob den Haken vom Tor, eine Kette klirrte, hinterm Zaun kläffte ein Hund. Schon sah er die Biegung, die drei Kiefern – sie hatten dem Gewitter standgehalten; und da …
Ein Haufen schwarzer, fürchterlicher Balken; das Feuer bereits gelöscht, aber unten, in den Ziegeln des Fundaments, in den Kohlen und der Asche, war die Glut noch lebendig; und schmutziger, stinkender Rauch stieg über der Brandstätte auf.
Das Haus war niedergebrannt. Kirill meinte, da sei wohl eine Gasflasche explodiert. Aber dass es völlig zerstört war …
»Ein Blitz, ein Blitz war das«, flüsterte jemand. »Direkt in die Antenne.«
Kirill hatte das Gefühl, die Leute zweifelten, ob es wirklich ein Blitz gewesen sei oder es den Nachbarn nur so vorkam. Aber sie glaubten bereits daran: kein Stück Kohle war aus dem Ofen gerollt – ein Blitz war’s! So klang es bedeutsamer, unheimlicher.
»So hat es Gott gewollt«, sagte einer der Alten, sagte es mitleidlos, ohne Traurigkeit, als erkenne er das höchste Urteil an.
Kirill stand da und konnte nicht glauben, was geschehen war. Die Fedossejewna schluchzte, gestützt von ihren Freundinnen, und obwohl er wusste, dass es schändlich, ungut war, dankte er dem Gewitter, sah die unbeirrt am Teich weidenden Gänse und meinte, sie alle hätten Spieß überwunden, und sicher gäbe es nun keine Angst mehr.
Aber eine Woche später verließ er mit seiner Mutter das Dorf, und an der Station »Belorusskaja« stieg ein Alter in die Metro, der übermäßig warm angezogen war; wahrscheinlich quälte ihn das Rheuma. Andere verdeckten ihn, Kirill sah nur die Hand – vor dem Hintergrund eines alten Mantels und eines geckenhaften, weißen Filzumhangs, den eines Obersts oder eines Generals, unten mit Lacklederbesatz und dreifacher Ziernaht durchsteppt. Kirill erkannte diese Hand, die scheinbar leblos, kraftlos herunterhing, dabei doch voll alter Kraft war, einer Kraft nicht des Fleisches, sondern der Knochen selbst, uralt und versteinert.
Kirill meinte, es sei Spieß, also lebte er noch, oder hatte sich wiederbelebt, war in die Stadt gekommen, mit dem Vorortzug, und in die Metro umgestiegen. In seiner Angst versteckte sich Kirill hinter seiner Mutter, beobachtete ihn heimlich: Er meinte, Spieß sei ihn holen gekommen, suche ihn.
Die Menge strömte auseinander, und Kirill sah, dass der alte Mann ein anderer war und Spieß kein bisschen ähnlich. Der Alte stieg zwei Stationen später aus, wobei er sich auf einen Stock stützte und mit seinen Filzstiefeln schlurfte; Kirill jedoch hatte seine Hand vor Augen. Und alles war wieder da:
»Werde groß, Fritz! Werde groß, und dann …«
Die Angst, die Kälte, das Vorgefühl des Untergangs – und die erneuerte Erkenntnis, dass es unter den Menschen solche wie Spieß gab, und solche Ganter wie Fritz –, das Leben führt sie zusammen, denn sie sind füreinander bestimmt, und mit dem Tod des einen Spieß’ vom Dorf war nichts, gar nichts vorbei.
entzogen