

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
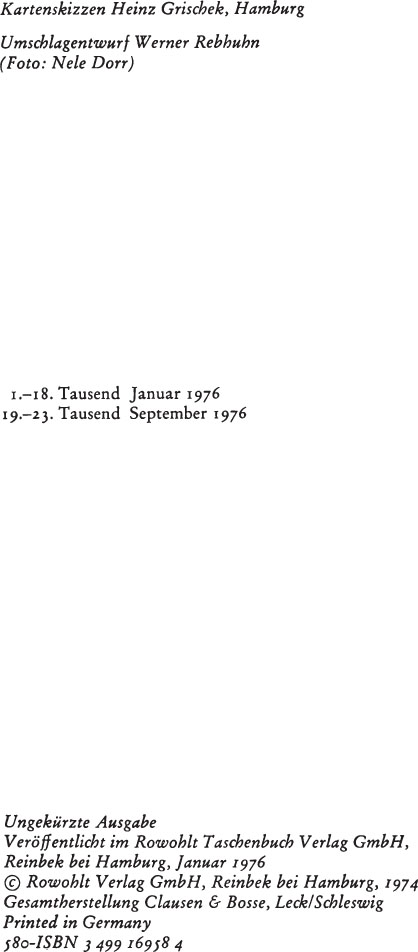
ISBN Printausgabe 978-3-499-16958-8
ISBN E-Book 978-3-688-11325-5
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-11325-5
Reich (1933), S. 29
Geruch, Geschmack, Tast- und Gleichgewichtsempfindungen sind in der Literatur kaum erwähnt; schon gar keine Bemerkungen findet man über die Entwicklung der Tiefensensibilität bzw. den Muskelsinn.
Neben diesen beiden Autoren sei speziell Jean Piaget erwähnt, der durch minuziöse Beobachtungen an seinen drei Kindern mich dazu anregte, ein genaues Verhaltensinventar bei Kleinkindern aufzunehmen. Ferner sei auf die Monographie von Schaffer und Emerson (1964 a) hingewiesen, die einen Grundpfeiler in der Erforschung der Entwicklung des Sozialverhaltens beim Kleinkind darstellt. Nicht vergessen werden dürfen Ainsworth (1967) und ihre Studie über das Kontaktverhalten von Ganda-Kindern (Afrika), die zusammen mit der Reihe: Determinants of infant behaviour, hg. von Foss, die Beobachtungen für die spätere Gesamtdarstellung von Bowlby (1969) lieferten. John Bowlby hat meiner Ansicht nach die bahnbrechendste Arbeit geleistet, um ein neues Bild über das Kleinkind zu entwerfen. Von seinen Ideen und Denkmodellen bin ich stark beeinflußt worden.
Für das Verhaltensinventar wurden ferner die folgenden Autoren berücksichtigt: Griffiths (1954), Illingworth (1963) und Shirley (1933), ferner die Kleinkindertests von Hetzer und Wolf (1928), von Frankl und Wolf (1932), von Brunet und Lézine (1965). Alle diese Autoren werden in meiner Arbeit selten oder gar nicht zitiert, waren aber für die exakte Ausarbeitung des Verhaltensinventars von großer Bedeutung.
Siehe S. 33ff
Bühler und Hetzer (1927)
Vgl. André-Thomas und Saint-Anne Dargassies (1952)
Peiper (1961) meint, daß dieser Greif- oder Anklammerungsreflex stärker ausgebildet sei bei Frühgeburten, während Schneeberger (1958) der Ansicht ist, daß der Reflex, im Geburtsmoment wohl vorhanden, jedoch besonders erst zwischen der zweiten bis sechsten Lebenswoche ausgebildet ist.
Prechtl (1958)
Bühler und Hetzer (1927)
(1932) aus Spitz (1967)
Frantz (1965; 1967); vgl. die Ergebnisse von Bower (1971); siehe dazu S. 19
Hingewiesen sei hier auch auf Ergebnisse von Dement und seinen Mitarbeitern über Schlaf- bzw. Traumstörungen bei Schizophrenen; siehe Gulevich u.a. (1967) und Zarcone u.a. (1968; 1969)
Wolff (1969); Schaffer und Emerson (1964 a)
Vgl. auch Clauser (1971)
Gesell und Amatruda (1965)
Prechtl (1958)
Ripin und Hetzer (1930)
Bühler und Hetzer (1927)
Piaget (1936)
Bühler und Hetzer (1927)
Brunet und Lézine (1965); Herzka (1967)
Lézine (1965)
Gesell u.a. (1950)
Gesell und Amatruda (1965)
Gesell und Amatruda (1965)
Vgl. auch die bereits zitierten Beobachtungen von Fantz (1965; 1967)
Siehe auch Bower (1966); Ball und Tronick (1971)
Brunet und Lézine (1965)
Hetzer und Tudor-Hart (1927)
Siehe Ainsworth und Bell (1969); Bowlby (1969)
Bühler und Hetzer (1927)
Koch (1968); Lézine (1965); Schaffer (1966)
Bühler und Hetzer (1927)
Bühler und Hetzer (1927); Gesell und Amatruda (1965)
Bühler und Hetzer (1927); Piaget (1936)
Lézine (1965)
Vgl. auch das Körpererforschen, S. 22
Bühler und Hetzer (1927); Illingworth (1963)
Hetzer (1928)
Bühler und Hetzer (1927); Gesell und Amatruda (1965); Piaget (1936)
Bühler und Hetzer (1927); Gesell und Ilg (1937); Piaget (1936)
Gesell und Ilg (1937); Ripin und Hetzer (1930)
Gesell und Ilg (1937); Gesell und Amatruda (1965)
Vgl. Bühler und Hetzer (1927); Kaila (1932); Spitz und Wolf (1946); Ahrens (1954)
Ainsworth (1967); Bowlby (1969)
Aus Eibl-Eibesfeldt (1970), S. 245
(1960) aus Bowlby (1969)
Gesell und Amatruda (1965)
Bühler (1931)
Piaget (1936)
Hetzer (1931); s.a.Bühler und Hetzer (1927); Gesell und Amatruda (1965); Piaget (1936; 1937)
Shirley (1933)
Brünet und Lézine (1965); Gesell und Amatruda (1965); vgl. auch die Arbeit von Clauser (1971)
Brunet und Lézine (1965); Gesell und Amatruda (1965); Illingworth (1963)
Ainsworth (1967)
Vgl. auch Ainsworth (1967)
Untersuchungen über Fremdenangst siehe Ainsworth (1967); Freedman (1961); Morgan und Ricciuti (1969); Rheingold (1969); Schaffer und Emerson (1964 a; 1964 b). Auf die Ansichten von Spitz (1967) über die Fremdenangst – er nennt sie «Achtmonatsangst» – brauche ich hier nicht einzugehen, da seine Theorien durch Bowlby (1969) widerlegt wurden.
Tennes und Lampl (1964)
Morgan und Ricciuti (1969)
Ainsworth (1967); Benjamin (1963); Schaffer und Emerson (1964 a); Tennes und Lampl (1964)
Tennes und Lampl (1964)
Bowlby (1969)
Ebd.
Der Begriff secure base stammt von Blatz (aus Ainsworth und Wittig [1969]); eine adäquate deutsche Übersetzung existiert nicht. Am ehesten ist der Begriff mit ‹Rückhalt› (wörtlich: ‹Sicherheitsbasis›) zu übersetzen.
Ainsworth (1967; 1969)
Vgl. dazu Bowlby (1973)
Gesell und Amatruda (1965)
Bühler bzw. ihre Mitarbeiter haben Reihenuntersuchungen an Kleinkindern durchgeführt und konnten auf diese Weise Standards für die durchschnittlich ‹normale› Entwicklung des Kleinkindes schaffen. An Hand ihrer Testaufgaben kann festgestellt werden, ob ein Kind frühreif oder retardiert ist.
Lenneberg (1964) aus Herzka (1967)
Vgl. S. 32
Aus Eibl-Eibesfeldt (1967)
Gesell (1948), S. 8. («Jedes Kind folgt in seiner Entwicklung einem ganz bestimmten Muster. Aber dieses Muster ist nur die Variante einer allgemeinen Grundstruktur. Diese Grundstruktur ist genetisch determiniert. Umweltfaktoren verstärken, beeinflussen und modifizieren, aber geben nicht den eigentlichen Anstoß für den Fortgang der Entwicklung.»)
Unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript
Ebenso eindrucksvoll wie diese Zeitangaben sind die Fotos von Geber (1958), aus welchen die Frühreife der Ganda-Kinder auch an ihrem Ausdruck ersichtlich wird.
Der Gesell-Test ist nach demselben Prinzip wie der Bühlersche Kleinkindertest aufgebaut. Vgl. Kap. 1, Anm. 68
Geber und Dean (1956)
Zusammen werden Mensch und Affe zur Ordnung der Primaten gerechnet. Die Herkunft des Menschengeschlechts von den Affen datiert man heute auf 15 bis 35 Millionen Jahre zurück.
Languren und Paviane sind zwei Vertreter der Altweltaffen, während die Totenkopfaffen zur Neuen Welt gehören.
Harlow (1960)
Beschrieben von P. Jay (1963)
Das Affenkind ist mit seinem Bauch dem Bauch der Mutter zugewendet.
Siehe S. 93
Vgl. das Triebmodell von Szondi (1960), Bd. 2
Vgl. S. 65ff
Siehe S. 44, 54
Harlow (1963)
Beschrieben von De Vore (1965)
Southwick (1965)
Die Gruppengröße bei Papio ursinus beträgt zwischen 40 bis 80 Individuen.
Beschrieben von Du Mond (1968) und Rosenblum (1968)
Carpenter (1964)
Der Begriff ‹Tante› wurde von Hinde (1965) und Rowell (1963) eingeführt und wird unabhängig vom Grad der Blutsverwandtschaft benutzt.
Hinde (1965)
Itani (1959)
Deag und Crook (1971)
So auch Kummer, Götz und Angst beim Mantel-Pavian (Papio hamadryas). Bei Javaner-Affen (Macaca fascicularis) in Gefangenschaft bringen neue Leittiere (Alpha-Tiere) auch Junge um, die nach der Machtübernahme geboren wurden (mündliche Mitteilung von Angst).
Mason (1970) über Schimpansen; Hess (1970; 1973) über Gorillas
Mason (1970)
Vgl. auch die verschiedenen Tragarten beim Gorilla in Gefangenschaft, Hess (1970)
Rogers (1970)
Hess (1970), S. 88
Vgl. auch Hess (1970)
Siehe S. 49
Aus van Lawick-Goodall (1971), S. 137f
Van Lawick-Goodall (1966)
Ähnliche Beobachtungen machte Hankey an freilebenden Schimpansen-Kindern (mündliche Mitteilung).
Nach Hankey kann eine Mutter ihr eineinhalbjähriges Kind am Trinken hindern, andererseits kann es unter Umständen bis zur Geburt des neuen Geschwisters an der Brust trinken. Herumgetragen werden die Kinder bis zum ca. dritten Lebensjahr, das heißt alle drei- bis vierjährigen Kinder laufen selbständig hinter der Mutter. Teilweise schlafen Kinder bis zum 6./7. Lebensjahr bei der Mutter (mündliche Mitteilung).
Dies gilt nicht nur für die Schimpansen allein. Bei den Javaner-Affen ist die Mutter-Tochter-Beziehung die engste soziale Beziehung mit Ausnahme der von Mutter-Kleinkind (mündliche Mitteilung von Angst).
Vgl. Portmann (1956; 1969)
Siehe S. 14
Gesell und Amatruda (1965)
Gesell und Ilg (1937)
Aus Bowlby (1969)
Eibl-Eibesfeldt (1967)
Siehe S. 16
Harlow (1960; 1961)
Vgl. auch Bowlby (1969) und Hassenstein (1970)
Über die Bedeutung des Körperkontakts vgl. auch Morris (1972)
Hassenstein (1970)
Über die verschiedenen Tragarten siehe zum Beispiel Ploss und Renz (1911), das Fotobuch von Reich (1963) sowie Bernatzik (1968), ferner auch die verschiedenen ethnologischen Berichte und Reportagen über Naturvölker.
Hassenstein (1970)
Eibl-Eibesfeldt (1967), S. 232
Freedman (1961); vgl. die von Hess postulierten Fluchtreaktionen. Ebenfalls bei Mäusen postuliert Dimond (1970) Angst vor fremden Tieren, und zwar von dem Zeitpunkt an, da sie beweglicher werden.
(1969) und mündliche Mitteilung
Harlow und Harlow (1965); Hinde (1965)
Rowell (1963)
Hinde aus Bowlby (1969)
Hinde (1965)
Vgl. dazu die von Hess (1959) postulierten Furcht- bzw. Fluchtreaktionen nach erfolgter Prägung.
Zeitlich ganz anders gelagert ist dagegen diese außerartliche ‹Fremdenangst› oder ‹Fremdenflucht› bei den Nesthocker-Jungen ausgebildet. Solche außerartlichen Objekte lösen bei ihnen nicht Annäherungsversuche, sondern ab Geburt Flucht- oder genauer: Furchtverhalten aus. Siehe S. 71f
Hassenstein (1970), S. 15
Vgl. S. 32
Der Begriff des Territoriums muß insofern eingeschränkt werden, da es sich dabei in der Regel um Gebiete handelt, die gegen arteigene Individuen verteidigt werden, was vom Kleinkind natürlich nicht in der ursprünglich gemeinten Weise gilt.
Bowlby (1969), S. 195
Bei Säuger-Jungen spreche ich nur ungern von Fremden- oder Trennungsangst, weil beide Begriffe vom Menschenkind her übernommen wurden. Wahrscheinlich müssen für die Säuger, eventuell auch für die Affen, eigene Begriffe geschaffen werden. Mindestens müßte korrekterweise immer vom Fremdenangstmechanismus, Fremdenfluchtverhalten oder aber von den Vorläufern der Trennungsangst gesprochen werden. Deshalb habe ich die betreffenden Begriffe in diesem Kapitel immer in Anführungszeichen gesetzt.
Schneirla (1963) an Katzen; Reingold (1963) an Hunden
Vogel (1969)
Schneirla u.a. (1963); Vogel (1969)
Rheingold (1963)
Schneirla u.a. (1963)
Rheingold (1963)
Vgl. dazu die Vorformen bei den Nesthockern, wie ich sie bei den Hunden oben beschrieben habe.
Vgl. S. 41ff
Dabei gilt: Die nicht individuell gerichtete Kontaktphase verbringen alle Affenkinder in der beschriebenen totalen Abhängigkeit von der Mutter. Über den Vergleich der Prägungsphase mit der Phase der totalen Abhängigkeit einerseits bzw. mit dem Ablösungsprozeß andererseits bei den verschiedenen Primaten, siehe S. 77f
Unabhängigkeitsphase nach Harlow (1960)
Solche Umrechnungsfaktoren wurden vor allem an Fixpunkten wie der sexuellen und der vollen adulten Reife gewonnen. Die Daten hierfür lauten für den Menschen: ca. 12. bis 15. bzw. 18. bis 20. Lebensjahr; Gorilla: 7. bzw. 9. bis 12. Lebensjahr; Languren: ca. 3. bzw. 5. Lebensjahr (Schenkel [1964]; Jay [1965]). Zu den Angaben über Menschenaffen will ich anmerken, daß sie insofern relativ gut mit den Menschen verglichen werden dürfen, weil ihre Körpergröße bzw. -gewicht ungefähr demjenigen des Menschen entspricht und zudem die Tragzeit ebenfalls ungefähr dieselbe ist, nämlich acht Monate. Die Interpretation von Portmann, daß das Menschenkind ein Jahr zu früh geboren werde, muß somit fallengelassen werden.
Eibl-Eibesfeldt (1967)
Vgl. S. 41
Schenkel (1964); Hayes (1951)
Siehe S. 24f
Schenkel (1964)
Siehe Hess (1970)
Siehe S. 189f
Vgl. hierzu auch das kulturelle Transmissions-Phänomen bei den Primaten; Etkin (1964); s.a.Eibl-Eibesfeldt (1967), S. 224: «Beim japanischen Stummelschwanzmakaken (Macaca fuscata) konnte man verfolgen, wie sich neue Ernährungsgewohnheiten bildeten und in der Gruppe ausbreiteten. Ein Affentrupp auf der Koshima-Insel wurde ab 1952 regelmäßig mit Süßkartoffeln gefüttert. 1953 sah man zum erstenmal, daß das anderthalbjährige Weibchen Imo die Kartoffeln am Ufer eines Süßwasserbaches wusch. Sie hielt die zu waschende Kartoffel in einer Hand und putzte den Sand mit der anderen Hand im Wasser ab. Diese ‹Erfindung› breitete sich im Laufe der Jahre in der Gruppe aus, und zwar zunächst innerhalb der engeren Familien und innerhalb der Gruppen von Spielgefährten. Später wurde die Gewohnheit immer von der Mutter auf die Kinder übertragen. 1962 wuschen bereits ¾ aller über zwei Jahre alten Affen Kartoffeln … Zuerst wuschen die Affen ihre Kartoffeln nur im Süßwasser. Allmählich benützten sie auch Meerwasser dazu, wobei einige offensichtlich Geschmack am Salz fanden und dazu übergingen, ihre Kartoffeln zu würzen, indem sie diese während des Fressens immer wieder ins Salzwasser tauchten.»
Begriff nach Schultz-Hencke; die Phase des primären Narzißmus nach Freud; Phase des normalen Autismus nach Mahler; präorale oder sensorische Phase nach Riemann; die ungerichtete Kontaktphase nach meiner eigenen Nomenklatur
Vgl. auch die Untersuchungen von Graber (1972), Hau (1973), Joffe (1969) und Kruse (1969), die sich mit der pränatalen Situation des Kindes beschäftigen.
Eibl-Eibesfeldt (1970)
Vgl. auch Freud, nach dem das Fremde immer außenbefindlich, zugleich schlecht ist und somit abgelehnt wird (‹Die Verneinung›, Bd. 14, S. 16)
Siehe S. 189
Siehe Bedeutung des Körperkontakts
Klein aus Fornari (1970)
Hassenstein (1970)
Freud, ‹Jenseits des Lustprinzips›, Bd. 13
Siehe S. 58f
Erikson (1957)
Riemann (1967)
Nach Freud bzw. Schultz-Hencke; die symbiotische Phase nach Mahler; die von mir so benannte Prägungsphase
Vgl. das Plaudern, S. 79
Das Schreien des Kindes in der oralen Phase ist somit mit dem Verlassenheitsrufen von Nesthocker-Kindern vergleichbar.
Vgl. S. 80
Gesetz nach Schafer und Emerson (1964 a), siehe S. 28f
Nach Freud; separation-individuation process nach Mahler, wobei die erste Subphase der Individuation bereits in der oralen Phase liegt; Autonomie nach Erikson; der von mir so benannte Ablösungs- und Trennungsprozeß
Erkundungs- und Neugierde-Verhalten nach Hassenstein (1970)
Vgl. Kap. 3, Anm. 47
Siehe Definition der Bindung, S. 27ff, 61f
Bei fast allen Naturvölkern schläft das Kind bei der Mutter, und zwar meist länger als zwei Jahre.
Sogenannte temper tantrums; siehe S. 40, 129, 178
Siehe S. 41
Parin u.a. (1971)
Die urethrale und phallische Phase nach Freud bzw. Schultz-Hencke
Vgl. auch S. 74f
Vgl. die Arbeiten von Harlow
Die Mutter als Zufluchtsstätte darf nicht verwechselt werden mit dem Begriff der Mutter als secure base, zu der das Kind durch einen inneren Zwang, und das heißt ohne äußeren Anlaß, immer wieder zurückkehrt.
In dieser Phase liegt nach psychoanalytischer Auffassung der Ödipus-Komplex. Vgl. auch meine Einschränkungen zum Entwicklungsmodell, S. 10f
Der folgende Abriß über die spezielle Neurosenlehre orientiert sich an der Neopsychoanalyse von Schultz-Hencke. Im wesentlichen habe ich mich auf die drei Autoren Hau (1968), Riemann (1967; 1970) und Schwidder (1959) gestützt.
Auch (primär) narzißtische Persönlichkeit, siehe zum Beispiel Kohut (1973); Bereich der Grundstörung nach Balint (1970)
Trotz Störung eines bestimmten Erlebens wird versucht, durch die Entwicklung von anderen Erlebnisweisen die ursprüngliche Verhaltenslücke auszufüllen. Analoges Beispiel aus der Hirn-Physiologie: Fällt ein Nervenzentrum im Gehirn aus, kann ein anderes Zentrum hypertrophiert werden und teilweise die Funktion des ursprünglichen Zentrums übernehmen.
Angst hier im erweiterten psychoanalytischen Sinne, nämlich als psychisches Korrelat des somatischen Schmerzes: Angst entsteht überall dort, wo dem betreffenden Menschen ein Triebbedürfnis zur Lösung eines Konflikts zur Verfügung stehen müßte, ihm aber nicht zur Verfügung steht, weil es nicht vorhanden ist oder nicht zur Verfügung stehen darf wegen innerpsychischer Ablehnung der betreffenden Triebstrebung. In solchen Situationen entstehen Unheimlichkeitsgefühle oder Bedrohungssensationen, womit diese Art von Angsterleben in einer engen Beziehung zur ursprünglich biologischen Angst als Lebensbedrohung steht.
Interessieren dürfte in diesem Zusammenhang eine klinische Beobachtung von Balint (1970): Auf die Ebene der Grundstörung regredierte Patienten haben oft den Wunsch nach irgendeiner Form des körperlichen Kontakts mit dem Analytiker (vgl. das Grundbedürfnis des Kindes in der intentionalen Phase, S. 187 f).
Vgl. die Antriebsblässe beim schizoiden Menschen bzw. den Ambivalenzkonflikt bei der zwanghaften Persönlichkeit.
Vgl. die ähnlichen Versuche von Erikson (1957) und Kardiner (1939; 1945)
Beschrieben von Burrows und Spiro (1957), wobei ich vor allem die Feldbeobachtungen von Spiro ausgewertet habe; vgl. auch Spiro (1949ff)
Beschrieben von Lewis (besonders 1951)
Beschrieben von Fischer, Gladwin und Sarason, Goodenough u.a., wobei ich für die Kinderbehandlung Fischer (1950), für die Kultur im allgemeinen Gladwin und Sarason (1953) und für die Landrechte ausschließlich Goodenough (1951) ausgewertet habe.
Beschrieben von Linton in Kardiner (1939)
Bei den Marquesanern herrscht Polyandrie, das heißt die meisten Frauen haben mehr als einen Mann.
Siehe Literaturverzeichnis, S. 268ff
Siehe Kap. 6, Anm. 2
Vgl. den Bericht von Bates und Abbott (1959)
Vgl. die Empfindlichkeit des neugeborenen Kindes auf Wärme- bzw. Kälteschwankungen, S. 14
Devereux (1955)
Spiros Antwort vom 1. April 1970 auf eine Anfrage von mir brachte leider keine Klärung.
Persönliche Mitteilung von Spiro vom 1. April 1970
Ebd.
Vgl. die Affenkinder, die an ihren Fingern saugen, wenn sie von ihren Müttern getrennt werden.
Aus Burrows (1963), S. 26–31
Ähnliches gilt für die Exkretionsausdrücke; beispielsweise ist es für einen Mann unmöglich, sogar vor seiner eigenen Frau darüber zu sprechen.
Dasselbe gilt mit Einschränkungen natürlich auch für das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell, S. 99ff
Die Melancholie darf auch als depressive Psychose bezeichnet werden.
Bd. 10, S. 427–446
Vgl. ihre Schreiausbrüche bis zum stundenlangen, passiven Weinen.
Siehe den Begriff der ‹Monotropie› nach Bowlby, S. 28 bzw. die biologische Bedeutung der Prägung, S. 61
Damit habe ich die Lücke im Erleben der zwangsneurotischen Persönlichkeit beschrieben. An ihrer Stelle kann sich auch eine Haltung entwickelt haben, das heißt ein überstarkes Nein-Sagen: Der Geiz.
Daß die ‹analen› Charakterzüge der Ifaluk nicht durch die Sauberkeitserziehung geprägt werden, brauche ich nicht näher zu erläutern.
Siehe S. 221
Parin u.a. (1971)
Die Kanufahrten können auch als eine sozialisierte Form von starken Weglauftendenzen gelesen werden.
Der melancholische oder depressive Wahn nach Bleuler besteht in 1. Versündigungswahn, 2. Krankheitswahn und 3. Verarmungs- oder Verhungerungswahn: Eine bei den Ifaluk perfekt vorhandene Trias.
Auch hier wieder erscheint die depressive Partnerverlustangst (Riemann) bzw. die melancholische Angst vor Ausstoßung aus der Gemeinschaft (Freud).
Dabei muß zwischen verschiedenen Arten der Dunkelangst unterschieden werden. Dunkelangst in Richtung pavor nocturnus (nächtliches Aufwachen durch massives Erschrecken) gehört eher zur zwangsneurotischen Persönlichkeit. Von hier sind alle Übergangsformen bis zur schizoiden Dunkelangst zu finden, die gar nicht mehr erlebt werden muß (vgl. dazu die eher depressive Dunkelangst der Trukesen). Auf dasselbe Phänomen habe ich bereits bei den Alus allgemein hingewiesen: Die Ifaluk haben keine bewußt erlebte Angst vor ihnen, sondern kennen entsprechende Verhaltensregeln, die so perfekt eingehalten werden, daß keine Angst entstehen muß.
Bewunderung als Kompensation von mangelnder echter Anerkennung und Zuneigung ist ein typisch schizoides Bedürfnis. Vgl. hierzu die überdimensionalen Riesenkräfte von Superman, der amerikanischen Comic-Figur!
Eine ähnliche Abwehr in unserer Kultur besteht darin, daß ein Mann bzw. eine Frau beim Koitus an einen anderen denkt, womit die Angst vor Nähe und Hingabe abgewehrt oder verarbeitet werden soll.
Die sogenannte Ich-Schwäche des Schizophrenen, das heißt die Zerrissenheit zwischen Es-Impulsen und Über-Ich-Forderungen, wobei die dazu notwendige Steuerung oder Egoifizierung fehlt (Benedetti [1971]).
Benedetti (1970)
Der Mann seiner ‹Mutter›, das heißt seiner Tante, in dessen Hütte er teilweise lebt; im Traum erzählt er von den beiden, daß sie ihn töten wollen.
Spiro (1950), S. 196
Ebd, S. 195
Ebd., S. 192
Ebd., S. 154f.
Vgl. Kap. 6, Anm. 3
Ganz kraß ist diese enorme Umstrukturierung und Veränderung erkenntlich, wenn man die beiden Feldberichte von Redvield (1926/27) und von Lewis (1943/44; 1947/48) miteinander vergleicht, die nur rund zwanzig Jahre auseinanderliegen.
Vgl. dazu die auf S. 244 näher erläuterten experimentellen Untersuchungen von Lipton (1965)
Kluckhohn (1947)
Hitchcock und Minturn (1963)
Vgl. S. 58f, 87f
Vgl. S. 181ff, 188
Madsen (1960)
Ferner kennen die Tepoztlaner Diarrhöe, Augenentzündungen bei Kleinkindern, Husten, Schlaf- und Ruhelosigkeit, zu viel Urinieren oder aber auch Mutismus.
Vgl. die Ifaluk: Zwischen den einzelnen Landparzellen bestehen keine Abgrenzungen.
Vgl. die ‹Dunkelangst› der Ifaluk, ihre Befürchtung, des Nachts im Busch von Alus angegriffen zu werden.
Nach der Revolution wurde eine Demokratie eingeführt, wobei der Präsident alle Jahre neu gewählt wird.
Vgl. S. 87f
Die Psychoanalyse kennt solche Phänomene etwa in der Form, daß beispielsweise hinter einem starken Zwangscharakter schizoide Lücken verborgen liegen oder schizoide Ängste abgewehrt werden.
Aus Lewis (1964), S. 40
Vgl. u.a. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910); Eine Kindheitserinnerung aus «Dichtung und Wahrheit» (1917); Aus der Geschichte einer infantilen Neurose (1918)
Lewis (1964), S. 8
Ebd., S. 51
Ebd., S. 219
Vgl. Kap. 6, Anm. 4; Krämer (1932) bezeichnet die Bewohner der Truk-Inseln als Truker. In dieser Arbeit habe ich das Wort Trukesen aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch übernommen.
Die Beobachtungen über die Kleinkinder stützen sich in erster Linie auf die unveröffentlichte Arbeit von Ann Fischer (1950), die anhangsweise ein über fünfeinhalb Stunden laufendes Beobachtungsprotokoll eines ca. drei Monate alten Kindes enthält. Für zusätzliche Daten stütze ich mich auf die Arbeit von Gladwin und Sarason (1953).
Mündliche Mitteilung von Parin
Vgl. die Ernährung mit Wasser auf Ifaluk. Die Art und Weise, wie ein Kind mit Kokosmilch ernährt wird, ist aus dem Bericht von Fischer leider nicht ersichtlich.
Leider beschreibt Fischer die psychische Abnormität dieser Mutter nicht genauer. Trotzdem darf vermutet werden, daß diese Frau ein Stück der Latenz, die unbewußten Wünsche und Regungen der anderen Trukesen-Frauen auslebt.
Fischer (1950), unveröffentlichtes Manuskript, Appendix A
Schriftliche Mitteilung von Ann Fischer vom 12. Dezember 1969
Es kann sich somit von der Brust nicht mehr lösen! Vgl. hierzu die geistesgestörte Mutter, die – wenn sie ihr Kind einmal an die Brust gelegt hat – es nicht wieder wegnehmen kann.
Fischer (1950), S. 116
Gemeint sind die Ethnologen.
Zur Erklärung des Begriffs s.S. 228f
Man vergleiche dazu auch unsere Dracula- bzw. Vampir-Vorstellungen.
Siehe Goodenough (1971)
Natürlich würde in diesem Zusammenhang interessieren – und Kannibalismus ist auf Truk unbekannt –, welche Unterschiede in der Kinderbehandlung der Trukesen zu einem effektiv kannibalistischen Volk zu finden wären: Dies ist jedoch deshalb praktisch unmöglich, da der Kannibalismus heute völlig im Aussterben begriffen ist; vgl. Spiel (1972).
Vgl. ihre Eifersucht und ihre Vergiftungsangst, S. 184f
Unter dem Begriff Boden verstehe ich im folgenden immer den auf dem Land liegenden Humus.
Wer die rechtmäßigen Erben eines Clans oder auch einer Korporation sind, habe ich der Einfachheit halber bisher weggelassen und möchte auch hier nicht näher darauf eingehen, weil die betreffenden Regeln äußerst komplex sind.
Vgl. dazu die so ganz anders strukturierten Ursprungslegenden bzw. ‹Kriege› der Ifaluk.
Von hier aus kann auch verstanden werden, daß ein Mann immer erst den Leiter seiner Korporation befragen muß, bevor er sein Land an seine Kinder vererbt, weil somit der Besitz oder besser die momentane Benutzung des Bodens an einen anderen Clan übergeht.
Aus Gladwin und Sarason (1953), S. 236; vgl. die Ernährungsangst der Ifaluk, die den totalen Nahrungsverlust befürchten, bedingt durch Aussterben der gesamten Vegetation oder die totale Zerstörung durch den Taifun.
Unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript; vgl. auch die übrigen Arbeiten von Zauner
Zu deutsch: Überlebenschance oder vielleicht Überlebenswert. Unter survival value versteht die Biologie folgendes Phänomen: Treten im Laufe der Evolution irgendwelche Veränderungen auf (auch Mutationen genannt, wenn sie durch das Erbgut bedingt sind), so werden diejenigen von der Natur aus jeweils ausgeschieden, die der betreffenden Art keine Vorteile bringen. Der survival value ist somit negativ. Dieselben Veränderungen können sich aber unter Umständen als äußerst nützlich für die Weiterentwicklung der Art auswirken, dann wird von einem positiven oder hohen survival value gesprochen, und man versucht zu präzisieren, worin dieser konkret besteht.
Vgl. S. 60
Peiper (1966)
Ebd. (1966); Lipton u.a. (1965)
Diesen Hinweis verdanke ich Fräulein Dr. E. Staehelin.
Krickeberg (1956)
Groth-Kimball (1961)
Morley (1946)
Vgl. S. 242
Diese und die folgenden Exkurse in die Geschichte erheben nicht den Anspruch einer exakt historischen Analyse. In erster Linie soll damit die heutige Einstellung und Beziehung zum Kind verständlicher gemacht werden.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Plato dafür eintrat, man solle die Kinder durch Wiegen und Singen in den Schlaf schaukeln, damit sie nicht weinen. Darüber spottete der Naturwissenschaftler Aristoteles und meinte, daß Schreien die Gesundheit des Kindes kräftige (aus Peiper [1966]).
Lipton u.a. (1965); Peiper (1966); über die Wickelmethode in Rußland und Osteuropa bis in die heutige Zeit vgl. Benedict (1949) und Gorrer (1950).
Salber und Feinleib (1966)
Aus Klaus und Kennell (1970; 1972)
Über die beruhigende Wirkung des Saugens am Schnuller siehe S. 16
«Muß es bei ihrem Kind zu Kieferfehlbildungen kommen? Über eine halbe Million unserer Kinder haben gesundheitsschädliche Kieferverformungen … 60 Prozent sind Folgen hartnäckigen Daumenlutschens … Lassen Sie es nicht soweit kommen … Ein Fehlbiß beeinflußt nachteilig die Gesichtsform und behindert das berufliche Fortkommen der Jungen und die Heiratsaussichten der Mädchen. Bekämpfen Sie die Unsitte des Finger- und Daumenlutschens rechtzeitig durch erzieherische Maßnahmen und [durch] … Daumexol … Erhältlich in allen Drogerien und Apotheken.» Anzeige aus: Spielen und lernen5 (1973), S. 24.
Vgl. Bowlby (1973), der auf den Zusammenhang von Trennung und Aggression hinweist.
Vgl. Devereux (1955)
Vgl. Peiper (1966)
Begriff nach Schultz-Hencke
Für die neueren Bücher und Publikationen einerseits und für die Weiterentwicklung der Therapie-Methoden von Franz Renggli in Richtung pränatale Psychologie/Psychotherapie andererseits siehe seine Website:
www.franz-renggli.ch
Was ist eine Kultur? Was ist das Charakteristische an der Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr? Welchen Einfluß hat die Kinderbehandlung auf die Kultur? Eine Antwort auf diese Fragen kann gefunden werden, wenn die Ergebnisse dreier Wissenschaftsgebiete, nämlich der Psychoanalyse, der Ethnologie und der Verhaltensforschung, miteinander verbunden werden.
Seit mehr als fünfzig Jahren stellt die Psychoanalyse Sigmund Freuds die These auf, daß die ersten drei Lebensjahre insofern die entscheidendste Lebensphase ist, als hier alle wesentlichen Charakterzüge des später erwachsenen Menschen ausdifferenziert werden. Wilhelm Reich hat das in seiner ‹Charakteranalyse› (1933) so formuliert: «Jede Neurose baut sich ausnahmslos auf Konflikten der Kindheit vor dem vierten Lebensjahr auf.»[1] Zu diesen Vorstellungen kommt die Psychoanalyse durch die Beschäftigung mit dem erwachsenen psychisch kranken Menschen, indem sie von seinen Konflikten, Erlebnisweisen und Ängsten Rückschlüsse zieht auf die frühe Kindheit. Dadurch war es ihr möglich, das sogenannte psychoanalytische Entwicklungsmodell zu schaffen, das sich mit den Ängsten und Bedürfnissen des Kleinkindes beschäftigt und diese zu verstehen versucht.
Die vorliegenden ethnologischen Feldberichte über heute lebende Naturvölker enthalten dagegen – mindestens zum Teil – detaillierte direkte Beobachtungen sowohl über das Kleinkind als auch über den Erwachsenen, das Gruppenleben und das heißt die Sozialstruktur und schließlich über die Kultur selbst, wobei ich hier unter Kultur das Gesamt an religiösen Vorstellungen, Idealen, Zeremonien, Institutionen und Gesetzen verstehe. An Hand dieser Berichte ließe sich also fragen, ob Querverbindungen zwischen der Mutter-Kind-Beziehung einerseits und der Kultur als Ganzem andererseits hergestellt werden dürfen. Dazu müßte aufgezeigt werden, wie im einzelnen durch die Kinderbehandlung – und das heißt durch die Mutter-Kind-Beziehung – im ersten Lebensjahr die Erlebnis- und Verhaltensweisen, die Bedürfnisse und Ängste der Erwachsenen in einem bestimmten Volk beeinflußt werden. Genau dieses Ziel setzt sich das vorliegende Buch.
Die hauptsächliche Schwierigkeit einer solchen Untersuchung bestand darin, die Kinderbehandlung, wie sie in den ethnologischen Berichten beschrieben ist, adäquat beurteilen und auswerten zu können. Die einzige hierfür geeignete Methode ist das erwähnte Entwicklungsmodell der Psychoanalyse. Jedoch ist dieses Modell in unserer Kultur und für unsere Kultur geschaffen und daher auf fremde und das heißt Naturvölker kaum anwendbar.
Es war deshalb notwendig, ein neues Modell über die Entwicklung des Kleinkindes zu erarbeiten. Dazu griff ich auf die Verhaltensforschung zurück, die zu ähnlichen Ergebnissen wie die Psychoanalyse gekommen ist, und zwar durch direkte Beobachtung allerdings an Jungtieren. So konnte beispielsweise Konrad Lorenz an seinen Prägungsversuchen demonstrieren, daß bei allen höheren Tieren (Vögeln und Säugern) in der ersten Zeit nach der Geburt irreversible Lernprozesse ablaufen, die das ganze Leben des betreffenden Individuums grundlegend beeinflussen. Daher habe ich zunächst die bis heute bekannten und beobachtbaren Verhaltensweisen des Kleinkindes zusammengestellt, sodann die stammesgeschichtlichen Vorformen der Mutter-Kind-Beziehung im Tierreich näher untersucht, und zwar deshalb, weil sich der Mensch erst in der geologischen Neuzeit aus affenartigen Vorfahren entwickelt hat. Damit aber gelang es, Ursprung und Funktion der kleinkindlichen Verhaltensweisen, der Bedürfnisse und Ängste, neu zu erklären. Mit Hilfe dieses biologischen Fundaments war es nun auch möglich, das ‹alte› psychoanalytische Entwicklungsmodell neu zu sehen, wesentlich auszubauen und innerhalb des Modells neue Akzente zu setzen, und zwar so, daß dieses neue Modell nicht mehr nur auf das Kleinkind in unserer Kultur anwendbar ist, sondern den Schlüssel bildet für die Auswertung ethnologischer Feldberichte. Damit konnte ich auch die Anfangsfragen zu klären versuchen, nämlich: Wie sehen die soziokulturellen Folgen der Mutter-Kind-Beziehung aus?
Allerdings sei noch ausdrücklich auf die folgende Einschränkung hingewiesen: Innerhalb meines Entwicklungsmodells habe ich mich allein auf das Sozialverhalten des Kleinkindes und auf seine Ich-Entwicklung konzentriert. Mindestens zwei große Trieb- oder Verhaltensbereiche bleiben damit unberücksichtigt, nämlich das sexuelle und vor allem das aggressive Verhalten, und zwar aus folgenden Gründen:
Bis heute fehlen detaillierte Beobachtungen über die Entwicklung von aggressivem Verhalten im ersten Lebensjahr. Bis heute kann nämlich bei der Beobachtung von aggressivem Verhalten beim Kleinkind noch nicht genügend unterschieden werden, ob es sich dabei um eine ‹normale› Entwicklung oder bereits um pathologische Phänomene, und das heißt um Symptome, handelt. Diese Unsicherheit ist bedingt durch die noch immer nicht eindeutig faßbaren Konzepte rund um das Phänomen der Aggression. Um es überspitzt zu formulieren: Innerhalb der Verhaltensforschung gibt es darüber so viele Konzepte, wie es Autoren gibt. Hier sei nur auf die beiden am weitesten voneinander abweichenden Meinungen hingewiesen. Die behavioristische Schule eines B.F. Skinner versucht, alle Aggressionsphänomene als Reaktion auf Enttäuschung oder Frustration zu erklären. Jede Art von Aggression ist somit ‹erlernt›. Dagegen stellt die Ethologie – begründet durch Konrad Lorenz – die These auf, daß es sich bei der Aggression um angeborenes Verhalten handelt. Eine Annäherung der beiden Standpunkte könnte vielleicht das Konzept eines Schutztriebes (des Paroxysmaltriebs P) nach Szondi bilden, wonach jedes Individuum, das in seiner Geborgenheit oder in seinem Schutzbedürfnis verunsichert wird oder sich sogar bedroht fühlt, unter anderem oder je nach Situation sich mit einer genetisch determinierten Bereitschaft von Angriffsverhalten wehren muß, und zwar mit dem Ziel, den Feind oder die Gefahr unschädlich zu machen. Angriff – und die polare Gegenstrebung: die Flucht – haben nach diesem Konzept die Funktion der Verteidigung und das heißt des Schutzes. Aber auch damit ist das Phänomen der Aggression in keiner Weise geklärt. Wird dieses Konzept allerdings auf das kleinkindliche Verhalten angewendet, so ist in jedem Schreien des Kindes – verstanden als Hilfeappell oder aber als Suchen nach Schutz bei der Pflegeperson – eine nicht zu übersehene oder sogar wesentliche aggressive Komponente mitenthalten.
Dies gilt mit Modifikationen auch für das sexuelle Verhalten des Kleinkindes. Oder umgekehrt formuliert: So schwere sexuelle Fehlprägungen wie beispielsweise der Fetischismus kann seinen Ursprung nicht erst im ca. dritten bis fünften Lebensjahr haben, sondern seine Wurzeln müssen ins erste Lebensjahr zurückverfolgt werden.
Diese beiden Einschränkungen, das Unberücksichtigtlassen des aggressiven und sexuellen Verhaltens in meinem Modell über das Kleinkind, aber muß sich der Leser immer vor Augen halten, um meine Ausführungen über das Kleinkind nicht einseitig zu verstehen.
Abschließend möchte ich meinem Lehrer in Zoologie und Anthropologie, Herrn Professor Adolf Portmann danken, der in mir das Interesse weckte für die Entwicklung des Menschen und ganz besonders für die Situation des Kindes im ersten Lebensjahr. Obwohl Professor Portmann in meiner Arbeit selten zitiert wird, ist meine Art des Denkens grundlegend durch ihn geprägt worden. Danken möchte ich auch allen Ausbildungsdozenten des Psychoanalytischen Instituts in Freiburg i. Br. (DPG), insbesondere dem Leiter, Herrn P.D. Dr. Theodor Hau. Durch seine vielen Anregungen und sein Wissen über die kleinkindliche Situation wurde meine Arbeitsweise stark beeinflußt. Ebenfalls möchte ich mich bei der Werner Reimers-Stiftung bedanken, durch deren Unterstützung diese Arbeit ermöglicht wurde. Besonders danken aber muß ich Herrn Dr. Wolfgang Ahlbrecht, Dr. Walter Angst, Professor Bernhard Hassenstein, Frau Elisabeth Hau, Herrn Dr. Paul Parin, Dr. Leopold Szondi, Dr. Peter Weidkuhn und Fräulein Dagmar Werner, die mein Skriptum gelesen und mir mit Ratschlägen, Hinweisen und vor allem Diskussionen weitergeholfen haben und mich so zu neuen Untersuchungen anregten. Ebenso danke ich meiner Lektorin beim Rowohlt Verlag, Frau Elisabeth Raabe, für ihre sorgfältige Redaktion und ihre Zusammenarbeit.
Ganz herzlich danken möchte ich schließlich meiner Frau, die während zweier kritischer Jahre an meiner Arbeit mitgeholfen hat.
F.R.
Grundbaustein aller künftigen Überlegungen ist das Verhaltensinventar, worunter die rein äußerlich beobachtbaren Verhaltensweisen des Kleinkindes im ersten Lebensjahr verstanden werden. Diese werden im folgenden so genau wie möglich dargestellt, wobei auf eine Interpretation weitgehend verzichtet wurde. Innerhalb dieses Verhaltensinventars habe ich die folgenden Verhaltensbereiche besonders berücksichtigt:
1. Die motorische Entwicklung, wozu auch die Manipulationsfähigkeit gehört, das heißt wie sich das Kind den Reizen und Gegenständen der Umwelt zuwendet und wie es sich mit ihnen beschäftigt.
2. Die Entwicklung der Sinnesorgane, wobei ich mich auf die Hör- und vor allem auf die Sehreize beschränken mußte, da bis heute fast nur darüber gearbeitet wurde.[1]
3. Die Äußerungen des Kindes. Welche Äußerungsmöglichkeiten besitzt das Kind, in welchem Alter und wofür setzt es diese ein?
4. Das Sozialverhalten.
Bei der Zusammenstellung dieses Verhaltensinventars stütze ich mich vor allem auf zwei Autoren, auf Charlotte Bühler und auf die von ihr zwischen 1925 und 1935 begründete Wiener Schule und auf den Amerikaner Arnold Gesell. Gesell beobachtete eine sehr große Anzahl von Kindern und konnte von daher sehr genau die einzelnen Reifeschritte des Kindes beschreiben, wann sie zum erstenmal auftreten, worin ihre Vorformen liegen, wodurch sie abgelöst oder wie sie verfeinert werden usw. Charlotte Bühler dagegen hatte vielmehr das gesamte Verhalten des Kindes im Auge, angefangen vom Schlaf über die Stimmungslage bis zu den vorwiegenden Interessen des Kindes, wofür und in welchem Alter.[2]
Im übrigen will das nun folgende Verhaltensinventar die Entwicklung aller Kinder, unabhängig von der Behandlungsmethode durch die Mutter, also unabhängig von Kultureinflüssen aufweisen. Da aber praktisch alle zitierten Beobachtungen an europäischen oder amerikanischen Kindern gemacht wurden, kann der Einfluß der Behandlungstechnik natürlich trotzdem nicht ganz ausgeklammert werden.[3]
In den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt verbringt das Neugeborene die meiste Zeit, nämlich etwa zwanzig Stunden am Tag, im Schlaf oder Dämmerzustand. Neben dieser außerordentlich langen Schlafzeit fällt als weiteres Merkmal die Hilflosigkeit des Kindes auf. So kann es beispielsweise die Lage seines Rumpfes nicht verändern, seinen Kopf nicht aufrecht halten usf. Seine Arme und Beine führen unkoordinierte, ungeordnete und unregelmäßige Bewegungen durch, die vom Kind scheinbar nicht beachtet und daher von Bühler als «impulsive» Bewegungen bezeichnet werden.[1]
Wenn man das Verhalten des Neugeborenen ganz allgemein als hilflos bezeichnet, so muß dies dahingehend ergänzt werden, daß alle seine lebenswichtigen Verhaltensweisen reflexhaft, und das heißt unabhängig von seinem Willen, gesteuert werden. Von den vielen am Neugeborenen und Kleinkind beschriebenen Reflexen[2] will ich hier nur zwei erwähnen. Allgemein bekannt ist der Greifreflex: Werden die Handflächen des Kindes mit einem Gegenstand stimuliert, zum Beispiel mit einem Stab, dann schließen sich seine Finger so stark, daß es die Last des freischwebenden Körpers eine Zeitlang tragen kann.[3] Ein zweites und sehr wichtiges reflexhaftes Verhalten ist das rhythmische Brustsuchen: Wird das Kind in die Trinklage gebracht, dreht es seinen Kopf seitlich hin und her; wird bei diesem Suchen seine Lippen- oder Mundregion durch den Brustnippel oder die Flasche berührt, öffnet es den Mund und versucht den Nippel mit dem Mund zu fassen.[4]
Bei dem Verhalten des Neugeborenen seiner Umwelt gegenüber kann ferner festgestellt werden, daß es auf die meisten Sinnesreize ablehnend reagiert, das heißt durch sie gestört wird. Auf heftige Sinnesreize, seien es Geräusche, Veränderungen der Lichtintensität oder Lageänderungen, antwortet es mit Schreck, zum Beispiel Augenaufreißen, unruhigen Bewegungen oder sogar mit Schreien.[5] Ganz empfindlich reagiert das Kind ferner auf Temperaturschwankungen.
Zum besseren Verständnis sei dies ablehnende Verhalten am Beispiel des Sehens näher erklärt. Von Senden[6] untersuchte den Beginn und die Entwicklung der optischen Wahrnehmung bei erwachsenen Personen, die infolge eines angeborenen grauen Stars blind zur Welt gekommen waren und deren grauer Star später operativ entfernt wurde. Diese Menschen sahen keine Formen, sondern nur verschiedene Intensitäten von Helligkeit bzw. Dunkelheit, und sie mußten erst mühsam lernen zu sehen, zum Beispiel eine ganz bestimmte Konfiguration von Helligkeitsverschiebungen mit dem ihnen bekannten Geräusch, daß jemand durch die Tür eintrat, zu kombinieren, so daß sie schließlich auch sahen (!), daß jemand durch die Tür in ihr Zimmer trat. Vor allem sei auch auf das Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung solcher Menschen beim erstmaligen Empfinden von Lichteindrücken hingewiesen. Die operierten Patienten erlebten das ‹Sehen› als einen psychischen Streß, für viele war es eine Qual, und einige wollten wieder blind werden.