

Zum Buch
GEORGE MICHELSEN FOY, Jahrgang 1952, lehrt Kreatives Schreiben an der New York University und ist Autor zahlreicher Romane und Sachbücher. Er war Stipendiat des National Endowment for the Arts und schreibt u. a. für den »Rolling Stone«, »Boston Globe«, »Harper’s« und die »New York Times«. Als passionierter Segler, der bereits als Maat auf Frachtern in der Nordsee und als Kapitän eines eigenen Fangschiffs vor der Ostküste Nordamerikas zur See fuhr, lag es für ihn nahe, sich irgendwann auch dem Thema Seefahrt zu widmen. George Michelsen Foy lebt mit seiner Familie in Cape Cod, Massachusetts, und in New York.
George
Michelsen Foy
NORD
WÄRTS
Warum uns das Navigieren
erst zu Menschen macht
Aus dem Amerikanischen
von Leon Mengden

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Finding North« im Verlag Flatiron Books, New York.
Copyright © 2016 by George Michelsen Foy
Copyright © 2019 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with Flatiron Books.
All rights reserved.
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/Mariia Burachenko; Shutterstock/arigato
Redaktion: Joern Rauser, Rauser & Madlung Lektorate
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-19394-2
V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für meine Familie
1 Angst
2 Die Stavanger Paquet
3 Die Vögel, die Erinnerung und die Londoner Taxifahrer
4 Auf den Spuren meines Ururgroßvaters
5 An der Kultstätte der Götter der Navigation
6 Das »Entdecker-Gen«
7 Abenteuer im GPS-Handel
8 Stellares Kuddelmuddel
9 Navigation und Sex
10 Schlechte Breite
11 Colorado: Das dunkle Herz des GPS
12 Entdeckungen auf der Seekarte
13 Odysseus in Haiti
14 Der Aufbruch
15 Die Schattenseite der Cybernavigation
16 Auf See
17 Navigieren oder sterben?
18 Die Reise – und was es davon zu berichten gibt
19 Die Politik der Navigation
20 Halvors Hochzeit
21 Nordwärts
Danksagung
Anmerkungen
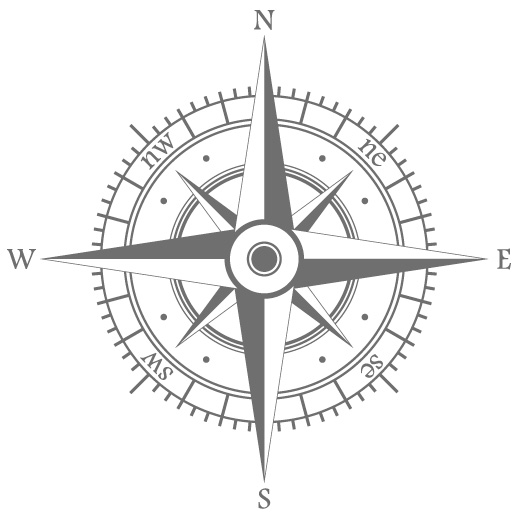

Am Anfang dieser Geschichte steht, wie bei so vielen Geschichten, die Angst – die Urangst, die auf jenen Augenblick vor einer so endlos langen Zeit zurückgeht, als wir aus dem Mutterleib hervorgezogen wurden und uns in einer gänzlich unvertrauten Umgebung wiederfanden, deren grelle Helligkeit uns blendete und in der wir uns, umgeben von lauter fremden Wesen, irgendwie zurechtfinden mussten.
»Wohin« lautet die vordringlichste Frage einer jeden Kreatur, wenn es darum geht, dem Angriff eines Widersachers entweder zu entgehen oder sich ihm durch Gegenwehr zu stellen – und eben nicht »wann«, »wie« oder »wer«. Die Beantwortung dieser Frage ist seit jeher der erste Schritt zum Überleben. Vom Anbeginn unseres Daseins war die Navigation, die Kunst der Bestimmung des eigenen Standorts und der Entscheidung, in welcher Richtung es nun weitergehen sollte, unser Schlüssel zum Selbsterhalt.
Ich weiß nur zu gut, dass ich Schwierigkeiten damit habe, mich zu orientieren. Erst neulich wieder ist es mir gegen Ende einer langen nächtlichen Autofahrt, die mich von New York City über die Interstate 195 in den Südosten von Massachusetts führte, passiert, dass ich auf einmal merkte, wie mir die Augen zuzufallen drohten; also steuerte ich den nächsten Rastplatz an, schaltete den Motor aus und schlief sofort ein. Als ich wieder aufwachte, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wo ich mich befand oder wie ich dort hingekommen war: Warum saß ich in tiefster Dunkelheit zusammengekrümmt in diesem engen, kalten Raum? In diesem Augenblick hätte ich sonst wo sein können: von Außerirdischen entführt – oder das Gedächtnis verloren haben und nach Turkmenistan verschleppt worden sein. In gewisser Weise war ich wieder so hilflos wie ein neugeborenes Kind. Und da ergriff urplötzlich eine ganz eigentümliche Angst Besitz von mir, die mich mehrere Minuten lang davon abhielt, um Hilfe zu rufen oder mich von der Stelle zu rühren – oder jedenfalls kam es mir so vor; in Wirklichkeit mögen wahrscheinlich bloß ein paar Sekunden vergangen sein. Aber diese Panikattacke wurde noch durch die unvermittelt aufflackernde Erinnerung an ähnliche Situationen verschlimmert, in denen es mich an Orte verschlagen hatte, die zwar nicht von dem Dunstschleier einer bleiernen Müdigkeit weichgezeichnet waren, an die ich mich aber nur noch undeutlich erinnern konnte.
Dieses Gefühl korrespondierte mit dem jähen Entsetzen, mit dem ich blitzschnell eine Bestandsaufnahme dessen vornahm, was ich erkennen oder ertasten konnte, nachdem die Panik das motorische Zentrum meines Nervensystems lahmgelegt hatte: das Lenkrad, die Windschutzscheibe und dahinter den hoch aufragenden Pfosten der Straßenbeleuchtung und den dunklen Schatten eines Kiefernwäldchens. Ich weiß noch genau, welche Erleichterung mich durchströmte, als sich auf meiner geistigen Landkarte geophysikalische Anhaltspunkte miteinander verknüpften, anhand derer ich eine zuverlässige Positionsbestimmung vornehmen konnte. So setzte auch die damit verbundene Erinnerung wieder ein – an das Auto, an den Rastplatz und an die Straße. Die Umgebung kam mir vertraut vor; ich konnte also nicht mehr allzu weit von meinem heimischen Herd entfernt sein, und wie sich denn auch bald herausstellte, trennte mich bloß noch eine knappe Dreiviertelstunde in östlicher Richtung von dem Haus, in dem mein todkranker Bruder auf mein Eintreffen wartete.
Das Leben bringt ständige Veränderungen – und darum Bewegung – mit sich; und da es sich beim Navigieren um die Kunst der Berechnung des Punktes handelt, an dem wir uns befinden, ferner des Weges, der uns an diesen Punkt geführt hat, und schließlich der Strecke, auf der wir unseren Weg fortsetzen werden, scheint es keineswegs übertrieben, wenn wir behaupten, dass Navigation in ihren unendlich vielfältigen Formen nicht bloß ein immens wichtiges Überlebenswerkzeug, sondern sogar den Dreh- und Angelpunkt des Lebens an sich darstellt. Unter den gängigen Vorstellungen von dem, was das Leben ausmacht, steht das Wissen um unseren Standort darin und den einzuschlagenden Weg zur Erreichung eines bestimmten Zieles an vorderer Stelle. »Das Gehirn hat sich nicht entwickelt, um die Welt wahrzunehmen und zu denken. Wir haben unser Gehirn aus einem einzigen Grund, nämlich, um anpassungsfähige und komplexe Bewegungen auszuführen«1, hat Daniel Wolpert, Neurowissenschaftler an der Universität von Cambridge, einmal gesagt. Indem man Bewegung erzeugt, findet man zu einer Position und einer Richtung. Durch das Navigieren hat sich unser Gehirn erst entwickelt.
Navigation ist ein so unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens – und dabei in allen seinen Entwicklungsphasen so selbstverständlich –, dass wir sie nur selten als das erkennen, was sie ist. Darin geht es uns ähnlich wie den sprichwörtlichen Blinden, die einen Elefanten an verschiedenen Stellen berühren und dann zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen, um was es sich dabei handelt – einen Torbogen, eine Mauer oder einen Feuerwehrschlauch. Wir navigieren, wenn wir das Büro des Kollegen Smith in einem Flügel des Firmengebäudes suchen, in dem wir noch nie gewesen sind; wir navigieren, wenn wir an der Ostküste der Vereinigten Staaten vorhaben, einem Freund in San Francisco eine E-Mail zu schicken und ihn uns dabei im Dunkel der einsetzenden Abenddämmerung dreitausend Meilen weit entfernt in Massachusetts vor unserem geistigen Auge vorstellen. Selbst wenn wir um drei Uhr morgens an einem uns vertrauten Ort aufwachen, weil uns der Sinn nach einem Glas Wasser steht, setzen wir automatisch unsere navigatorischen Fähigkeiten ein, um nach und nach die dazu erforderlichen Schritte auszuführen: Wir rollen uns vom Bett herunter, stolpern an der Kommode vorbei und über die im Zimmer verteilten Joggingschuhe hinweg, verlassen das Schlafzimmer durch die Tür und biegen dann nach links ab, wobei wir einen Arm ausgestreckt halten, um uns im dunklen Flur mit den Fingern an der Wand entlangzutasten, bis wir den Wasserhahn in der Küche erreicht haben. Dieser Vorgang läuft so unbewusst ab, dass wir für denjenigen, der nun behaupten wollte, wir würden uns durch unsere eigenen vier Wände navigieren, vermutlich nur ein mitleidiges Lächeln übrig hätten.
Und doch führen während der kurzen Reise von unserem Bett zum Spülbecken das Bewegungs- und das Speicherzentrum unseres Gehirns eine ganze Reihe von Berechnungen durch, die die Entfernung, den Kurs und – anhand von passierten Wegpunkten – die voraussichtliche Restdauer des Weges betreffen. Ihre Komplexität wird nicht etwa dadurch gemindert, dass wir uns ihrer überhaupt nicht bewusst sind; sie entsprechen – auch, was, jedenfalls relativ gesehen, ihre Zuverlässigkeit anbelangt – weitgehend denen, die ein Navigator im Zweiten Weltkrieg mit Hilfe von Kursdreieck, Bleistift und Generalstabskarte anstellte, um die Flugroute eines Bombers von Südengland nach Berlin und zurück zu berechnen.
Mein Erlebnis auf der Route 195 hat mich einigermaßen mitgenommen, obwohl ich während der bisherigen etwas mehr als dreißig Jahre meines Erwachsenenlebens allerhand herumgekommen und an vielen ungewöhnlichen Orten aufgewacht bin: in einem Maisfeld im Südwesten Frankreichs; in einem indonesischen Bordell; auf dem Dach eines Hauses in Damaskus sowie nach einer leichtsinnigerweise durchfeierten Nacht in einem U-Bahn-Waggon in der Bronx; doch generell kann man sagen, dass ich mir stets bewusst gewesen bin, was oder wen ich vorfinden würde, sobald ich meine Augen öffnete.
Wenn ich heute an dieses Erlebnis zurückdenke, sehe ich es so, dass es nicht der Augenblick des Erwachens war, der mir so sehr zugesetzt hatte, sondern vielmehr der damit verbundene panische Schrecken. Denn ich war schon bei zwei früheren Gelegenheiten in eine solch extreme, geradezu lähmende Panik versetzt gewesen, und beide Male war sie dadurch ausgelöst worden, dass ich die Orientierung verloren hatte.
Die darauffolgenden Monate sind von aufgewühlten Gefühlen und von Verlustschmerz geprägt. Mein Bruder stirbt, und meine Frau und die Kinder und ich müssen nicht nur mit dem emotionalen Schock, sondern auch mit den rechtlichen und finanziellen Folgen seines Todes fertigwerden. Wenn ich mich bisweilen gedanklich von den alltäglich notwendigen Tätigkeiten, die unser Leben bestimmen, losreiße und mir vor Augen führe, dass Louis nicht mehr bei uns ist, bekomme ich das Gefühl, mich zu verlieren – so wie damals auf der Route 195. Rührt daher vielleicht meine zunehmende Entschlossenheit, nicht bloß der Ursache für meine Neigung zu navigatorischen Zusammenbrüchen auf die Spur zu kommen, sondern möglichst alles über die Kunst der Navigation, die so bestimmend für unser Leben ist, in Erfahrung zu bringen? Oder sollte man im Gegensatz dazu meinen, dass ich mich trotz jener Erfahrung nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen will?
Ich finde die Vorstellung, nach den Gründen für ein solches persönliches Defizit zu forschen, allerdings nicht übermäßig erhebend. Also beschließe ich stattdessen, meine Nachforschungen an einem Punkt zu beginnen, der so weit als nur möglich vom Spektrum unseres Bewusstseins entfernt ist, und zwar auf der Ebene einer Zelle, die noch in der Entwicklung begriffen ist und nicht einmal weiß, in welchem Teil des Körpers sich der ihr zugewiesene Platz befindet. Während ich diverse wissenschaftliche Abhandlungen aus Deutschland, Israel und Taiwan sichte, stelle ich zufällig fest, dass eine der bedeutendsten Koryphäen auf dem Gebiet der Zellforschung an derselben Hochschule lehrt wie ich; also mache ich mit Dr. Stephen Small von der New York University in Manhattan einen Termin aus.
Um zu Dr. Small zu kommen, muss ich mich auf den Weg zu ihm machen, also navigieren. Von unserem Haus im Südosten von Massachusetts ausgehend folge ich zunächst der Interstate 195, um dann in Providence, Rhode Island, auf die Interstate in Richtung New York zu wechseln. Ich habe kein Navigationsgerät in meinem Wagen, also orientiere ich mich an dem in meinem Jeep eingebauten Kreiselkompass und am Stand der Sonne auf ihrem Weg gen Südwesten. Sobald ich in Manhattan bin, kenne ich mich auch schon wieder aus und finde problemlos zu einer Straße in der Nähe der White Horse Tavern in Greenwich Village. Dort suche ich mir einen Parkplatz und gehe zu Fuß weiter in südöstlicher Richtung auf den Campus der New York University zu, der sich auf mehrere Gebäude in den Straßen um den Washington Square herum verteilt. Ich finde den Weg zu meinem Ziel, indem ich bestimmte Orientierungspunkte und geografische Muster wiedererkenne und sie dann mit einer Landkarte oder einem Stadtplan in meinem Kopf abgleiche. Diesen Vorgang bezeichnet die Wissenschaft als »Vektororientierung« oder auch als »Pfadintegration«; er ist die Grundlage dessen, was man gemeinhin als Orientierungsgabe bezeichnet.
Auch Stephen Smalls Arbeit befasst sich mit dem Orientierungssinn, allerdings auf einer etwas grundlegenderen Ebene. Als Leiter der biologischen Fakultät der NYU untersteht ihm ein Forschungslabor, in dem man hinter das Geheimnis zu kommen sucht, wie sich eine beliebige Zelle ihren Weg durch den Fötus sucht, um Teil des linken Auges, der Leber oder eines Zehs am rechten Fuß zu werden.
Small ist ein drahtiger Typ, misst stolze einsneunzig und sprüht nur so vor Energie; er verfügt über ein Lächeln, das einen sofort für ihn einnimmt, hat ein umgängliches Wesen und trägt sein graues Haar kurz geschnitten. Er empfängt mich in seinem Eckbüro in der obersten Etage des Silver Building der Universität von New York City. Von diesem geradezu göttlichen Aussichtspunkt beobachte ich, wie die stecknadelkopfgroßen Touristen unten durch den Washington Square Park schlendern.
Small führt mich in das Forschungszentrum für Entwicklungsbiologie im angrenzenden Brown Building. Schwere Stahltüren schützen das Institut vor unerwünschten Besuchern; sieht man dann die grau und weiß getünchten Wände dahinter, kommt man sich erst recht wie in einer Anstalt vor. Bis an die Decke reichende Regale sind mit Glasbehältern, Glasröhrchen und Flaschen vollgestellt, allesamt nummeriert und mit farbigen Etiketten gekennzeichnet; an den Arbeitsplätzen davor stehen Mikroskope, Computer und weitere Glasröhrchen. An winzigen Apparatschaften blinken Kontrolllämpchen in unterschiedlichen Rhythmen; Dutzende von Doktoranden sind eifrig damit beschäftigt, irgendwelche Justierungen vorzunehmen, die mir natürlich nichts sagen.
Viele seiner Experimente führt Small mit der Drosophila melanogaster durch, der gemeinen Obstfliege, einem Insekt aus der Familie der Taufliegen. Diese Fliegen entstehen nämlich aus relativ großen Larven, an denen es sich gut herumdoktern lässt. Regelmäßig sind Millionen Exemplare davon als unfreiwillige Rekruten Bestandteil der Forschungsarbeit des Institutes. In einer Kammer mit einer konstanten Raumtemperatur von vierundsechzig Grad Fahrenheit – knapp achtzehn Grad Celsius – wird der durchschnittliche Lebenszyklus der Insekten verkürzt; von einem der Regale in diesem Raum nimmt Small ein ungefähr sechs Zentimeter langes Glasröhrchen.
Darin sind die entscheidenden Entwicklungsstadien im Leben einer Obstfliege kondensiert. Obstfliegen im Teenageralter – kaum einen Millimeter lange, winzige braune Maden – krabbeln rebellisch unterhalb des Verschlusses herum. »Sehen Sie diese winzigen weißen Pünktchen?«, fragt Small und zeigt dabei auf den Boden des Röhrchens. »Das sind die Embryonen.« Dann wendet er sich an einen seiner Assistenten: »Haben Sie mal ein Präparat für mich?« Nachdem er eine Weile in allerhand Kästchen herumgesucht hat, reicht ihm der junge Mann ein durchsichtiges Rechteck, das Small unter das Objektiv eines der Mikroskope schiebt. Dann winkt er mich zu sich heran. »Schauen Sie mal hier«, sagt er. »Ist das nicht schön?«
Es ist in der Tat hübsch anzusehen. Mehrere Hundert Obstfliegenembryos schwimmen auf der wässrigen Lösung des Objektträgers, und jedes einzelne stellt ein mit Tausenden von winzigen Flecken durchsetztes ovales Gebilde dar, und jedes einzelne dieser Fleckchen ist ein Zellkern. Und jeder dieser Zellkerne enthält wiederum eine bestimmte Menge eines Proteins namens Bicoid, wobei die Zellkerne an dem einen Ende des Embryos so viel Bicoid in sich gespeichert haben, dass sie beinahe schwarz erscheinen; allerdings verdünnt sich diese Konzentration zum anderen Ende hin zunehmend, sodass ein bemerkenswert gleichmäßiger Übergang von hell zu dunkel entsteht. Der Effekt erinnert an einen winterlichen Sonnenuntergang, bei dem die Schneewolken so dicht sind, dass die Färbung des Himmels allmählich von einem lichten Silberschein am oberen Rand, wo die Sonnenstrahlen ihre Wirkung noch entfalten können, zu einer zunehmenden Verdunkelung dort, wo am Horizont die Nacht hereinbricht, übergeht – das Bild einer Winterlandschaft, wie der Pointilist Seurat sie gemalt haben könnte, und so, wie seine einzelnen Farbtupfer zusammengenommen erst ein Gemälde bilden, so hat auch hier jedes Fleckchen seine ganz entscheidende Aufgabe zu erfüllen.
»Was Sie da vor sich sehen, ist ein Morphogengefälle, auch Morphogengradient genannt«, erklärt mir Small. Es könne wohl kaum ein anschaulicheres und überzeugenderes Beispiel für eine Positionsbestimmung auf der Grundlage des Erkennens von verschieden hohen Proteinkonzentrationen geben. Morphogen ist ein Signalstoff, ein Molekül, das sich in benachbartes Gewebe ausbreitet; abhängig von seiner Konzentration in den umgebenden Gewebezellen vermittelt das Morphogen durch das Maß seiner Entfernung von der Quelle eine Art Positionsinformation, sodass die sich entwickelnden Zellen, quasi dem in ihrer DNA gespeicherten Navigationssystem folgend, zur Außenseite, der Peripherie des Embryos wandern, wo bereits unterschiedliche Grade an Bicoid konzentriert sind – entsprechend hoch nahe der Quelle und weniger hoch in zunehmender Entfernung von ihr.
Man muss sich die Zelle wie den Besucher eines Wirtshauses vorstellen, der einen Platz am Tresen ergattern möchte; dieser Tresen ist an dem einen Ende ziemlich belagert, während sich der Andrang der Gäste zum anderen Ende hin zunehmend in Maßen hält; der Erfolg auf der Suche nach einem Platz wird also von der Konzentration der Gäste an dem Punkt des Bartresens abhängen, an dem sich der neu hinzugekommene Gast gerade befindet. Und auf die gleiche Weise wird die Position, die die Zelle an der Peripherie findet – und somit die exakte Konzentration von Morphogen –, bestimmen, welche Strukturen in der Zelle des sich entwickelnden Insekts an exakt dieser Stelle der Zellmembran, mit der sich die Zelle von ihrer Umgebung abgrenzt, entwickelt werden.
Der Blick in das Okular eines weiteren Mikroskops offenbart Embryonen an einem weiter fortgeschrittenen Punkt ihrer Entwicklung. Hier sieht man in jedem Embryo eine Reihe schwarzer Furchen, die im rechten Winkel von der Längsachse des Embryos, also quasi seiner Bauchseite, abgehen. Dies sind Zellen, die ihren Weg zu einer bestimmten Position des Morphogengradienten – oder, um bei unserem Bild zu bleiben, am Bartresen – gefunden haben und sich von hier aus zu einem Flügel, einem Auge oder einem Fühler weiterentwickeln, je nachdem. Das dadurch entstehende Muster erinnert an einen Strichcode, der in einem durchsichtigen Ballon eingeschlossen ist.
Die Forschungen von Wissenschaftlern wie Small und seinen Kollegen sind von ebenso essenzieller Wichtigkeit wie die Orientierung eines jeden Lebewesens in seiner Umgebung überhaupt. Wenn sich entwickelnde Zellen so bewegen, wie es sein sollte, nämlich auf die verschiedenen Sektoren des Morphogengradienten zu, entsteht aus dem Embryo eine ganz gewöhnliche Obstfliege – oder eben ein Hund oder ein Mensch. Geht das jedoch nicht seinen vorgeschriebenen Weg, können monströse Fehlentwicklungen die Folge sein. In dieser sehr frühen Phase des Lebens können eine schiefgegangene Navigation oder ein derangierter »Strichcode« gravierende genetische Defekte zur Folge haben; Smalls Forschungen aber dienen dazu, uns eines Tages zu einem Verständnis dessen zu führen, wie solche Defekte zustande kommen und wie sie verhindert werden können.
Der Zelle ist es egal, ob aus ihr eine Larve, ein Embryo oder ein Monstrum erwächst, denn die Zelle weiß nicht, was sie tut und hat auch kein Mitspracherecht dabei, was aus ihr wird.
Als ich Smalls Institut verlasse, verlaufe ich mich – wie es einem halt passiert. Das Silver Building und das Brown Building waren ursprünglich zwei nebeneinanderliegende, aber separate Gebäude, und obwohl sie inzwischen miteinander verbunden sind, befinden sich die jeweiligen Stockwerke doch nicht auf ein- und derselben Ebene, sodass die oberste Etage des Silver sechs Fuß über der entsprechenden Etage des Brown liegt. Aus reiner Bequemlichkeit entschließe ich mich, nicht wieder die Stufen zurück und hinauf in das Silver Building zu steigen, von wo wir gekommen waren, sondern mich stattdessen eine Etage tiefer zu begeben – wo ich vor einer verschlossenen Tür stehe, die mir den Weg zurück ins Nachbargebäude versperrt. Also gehe ich noch eine Treppe tiefer in das darunterliegende Stockwerk, wo ich zwar eine unverschlossene Tür finde, hinter der ich aber wiederum auf eine verwirrende Anordnung verschiedener Korridore mit lauter verriegelten Türen stoße, sodass ich schon sehr bald überhaupt keine Ahnung mehr habe, in welche Richtung ich mich wenden soll.
In diesem Moment fällt mir etwas ein: Bevor die NYU die Räume übernahm, beherbergten die obersten Stockwerke des Brown Building die Triangle Shirtwaist Factory. Und diese Erkenntnis versetzt mir so etwas wie einen kleinen Schock, denn wäre ich auf der Suche nach einer Örtlichkeit, die wie keine andere ein Inbegriff dafür ist, wie gefährlich es sein kann, die Orientierung zu verlieren, hätte ich mir kein passenderes Beispiel aussuchen können.
Triangle Shirtwaist war nämlich ein Sweatshop, ein »Schwitzraum«, also ein Billiglohnbetrieb, in dem fast fünfhundert Arbeiterinnen und Arbeiter, hauptsächlich junge Frauen und Mädchen, manche davon erst dreizehn Jahre alt, ausgebeutet wurden, indem man sie – im Schweiße ihres Angesichts – Männerbekleidung herstellen ließ. Als am Nachmittag des 25. März 1911 um 16 Uhr 15 in den Räumen der Textilmanufaktur ein Feuer ausbrach, breiteten sich die Flammen, die in den überall zuhauf herumliegenden Baumwollresten reichlich Nahrung fanden, mit erschreckender Geschwindigkeit auf den drei obersten Stockwerken des Gebäudes aus, das heute unter dem Namen Brown Building bekannt ist.
Max Blanck und Isaac Harris, die Eigentümer von Triangle Shirtwaist, wussten in den Räumlichkeiten ihres Unternehmens gut genug Bescheid, um sich mitsamt ihren Kindern, deren Gouvernante und dem Vorarbeiter auf das Dach retten zu können, von wo aus sie sich in einem angrenzenden Gebäude in Sicherheit brachten. Aussagen von Überlebenden zufolge wäre es durchaus möglich gewesen, dass auch eine gewisse Anzahl von Arbeiterinnen und Arbeitern vor den Flammen und dem Rauch hätten fliehen können, indem sie auf das Dach kletterten, doch war ihnen in ihrem Betrieb nie etwas anderes gezeigt worden als ihr unmittelbarer Arbeitsplatz, sodass nur sehr wenige von ihnen überhaupt wussten, wo ein Fluchtweg zu suchen war. Zwar waren die beiden Notausgänge durchaus als solche gekennzeichnet, doch waren deren Türen verschlossen, um die Arbeiter und Arbeiterinnen daran zu hindern, eine unerlaubte Pause einzulegen oder eventuelles Diebesgut hinauszuschaffen. Da es ihnen nicht möglich war, sich in dem brennenden Gebäude so weit zu orientieren, dass sie einen Ausweg aus den Flammen hätten finden können, ließen 146 Angestellte ihr Leben, weil sie entweder im Haus verbrannten oder den Tod fanden, als sie sich aus den Fenstern stürzten, um dem Feuer zu entkommen: Man fand sie entweder grässlich verstümmelt auf dem Straßenpflaster oder aufgespießt und durchbohrt auf dem Stacheldrahtzaun, der das Grundstück in jenen Jahren umschloss.
Ich für mein Teil finde dann schließlich doch wieder den Weg zurück zum Treppenhaus und hinüber ins Silver Building, wo ich in den Fahrstuhl steige. Ich glaube nicht an übersinnliche Dinge und auch nicht an Geister oder Gespenster, aber ich werde den Gedanken an diesen verheerenden Brand nicht los, und die verzweifelten Schreie der Mädchen, die die Vorstellung davon evoziert, hallen in meinem Kopf wider, als ich in das spätsommerliche New York hinaustrete, das in Sonnenlicht getaucht und von Autohupen und lebhaftem Treiben erfüllt ist. Hier schlägt mir die schweißige Hitze ins Gesicht, und der Geruch von Hot Dogs steigt mir in die Nase. Auf dem Washington Square finde ich eine freie Parkbank, auf der ich mir die Aufzeichnungen noch einmal durchlese, die ich während meines Gesprächs mit Small hastig notiert habe – und um darüber nachzusinnen, was sie mir sagen mögen.
Morphogene haben keine Vorstellung davon, ob sie gut oder schlecht gesteuert werden oder wie die Konsequenzen einer misslungenen Navigation aussehen würden. Zellen, denen natürlich jegliches Bewusstsein abgeht, können nicht über ihr Tun bestimmen und wissen somit auch nichts von der noch so latenten Furcht, die einen überkommt, wenn man sich vor die Entscheidung gestellt sieht: Soll man nach links oder nach rechts rennen, um den Flammen zu entkommen? Soll man oder soll man nicht einen heftigen Wind von Norden einplanen, der das Flugzeug in südliche Richtung abtreiben könnte, wenn man als Pilot die Flugroute nach Berlin berechnet?
Wir Menschen haben uns – im Gegensatz zu den Morphogenen – immer wieder in weitgehendem Maße durch das Wissen definiert, das man braucht, um seine Position zu bestimmen und sich zu unbekannten Gestaden hinauszuwagen – sei es zu Forschungszwecken, um Handel zu treiben oder um Krieg zu führen. Dieses Wissen wurde von Menschen erlangt, die neue Länder oder Erdteile oder Möglichkeiten, aus der Beobachtung der Sterne Erkenntnisse zu ziehen, entdeckt haben – und dies oft um eines hohen Preises willen. Die auf diesem Weg gewonnenen Einsichten vermehrten dann das überlieferte Gesamtgut dessen, was wir über Navigation wissen – sei es durch schriftliche Niederlegung oder durch mündliche Weitergabe der Kunde. Und diese Überlieferung wiederum ermöglichte es der nächsten Generation, weitere Entdeckungen zu machen. Obwohl dieser ganz bewusste, von Abenteuerlust bestimmte Aspekt des Navigierens eigentlich keiner weiteren Erläuterung zu bedürfen scheint, dient er doch dazu, den gewaltigen Unterschied zwischen der drei Meter von mir entfernt sitzenden französischen Mutter, die sich intensiv mit der GPS-Funktion ihres Smartphones beschäftigt, und den Tauben, die ihr Dreijähriger vor sich herjagt, zu beleuchten.
Die Orientierungsgabe, wie sie zum Beispiel Brieftauben, aber auch unzähligen weiteren Lebewesen – wie etwa Seeschwalben und Aalen – zu Eigen ist, funktioniert so differenziert wie präzise und dabei gänzlich instinktiv – so mechanisch und verinnerlicht wie die des Morphogens. Sie dient Lebensformen, die keine Ahnung haben, wieso, ob überhaupt und auf welche Weise sie navigieren, als Leitstern, während wir Menschen mit unseren gewichtigen Gehirnen und unserem ausgefeilten vernunftbegabten Denken unsere natürliche Orientierungsfähigkeit längst eingebüßt haben – und ganz gewiss haben wir eine solche auf einer früheren Stufe unserer Evolution einmal besessen.
Ich frage mich manchmal, ob der Preis, den unsere Spezies dafür bezahlen musste, ein Bewusstsein zu erlangen, nicht in dem Verlust unserer Fähigkeit, uns instinktiv zurechtzufinden, bestanden hat. Oder war – um die Kausalgleichung einmal umzudrehen – der Verlust unserer instinktiven Fähigkeiten und die daraus erwachsene Notwendigkeit, uns Navigationswerkzeuge zuzulegen, der Grund dafür, dass wir überhaupt je ein Bewusstsein erlangt haben? Könnte es sein, dass die Angst, sich zu verlaufen, die verkehrte Richtung einzuschlagen, nicht bloß ein linkisches Nebenprodukt unserer Psyche ist, sondern eine wichtige Komponente unseres Bedürfnisses, uns fortzubewegen?
Falls dies der Fall ist, könnte es meiner Meinung nach erforderlich sein, den Effekt solcher Hilfsmittel wie dem mit GPS ausgestatteten Mobiltelefon, von dem die Maman am Washington Square immer noch wie besessen war, neu zu bewerten. GPS und ähnliche Technologien haben während der vergangenen zwanzig Jahre die hart erkämpften navigatorischen Fähigkeiten des Menschen überflüssig werden lassen. Jeder Einzelne von uns ist, ohne dass uns dies groß aufgefallen wäre und ohne umfängliche Unterweisung, zu einem Navigator geworden, dem Größen auf diesem Gebiet – wie etwa Ferdinand Magellan, James Cook oder Sacajawea, die indianische Sklavin, die seinerzeit die berühmte Expedition von Lewis und Clark westwärts bis zur Pazifikküste geführt hat – kaum das Wasser reichen können. Für den Preis eines Smartphones oder einer Internetverbindung können wir uns mit erstaunlicher Präzision zu jedem Punkt des Globus leiten lassen und brauchen dabei nichts, aber auch gar nichts, darüber zu wissen, wie das möglich geworden ist.
Aber muss für solche Annehmlichkeiten nicht auch ein Preis bezahlt werden? Vergeben wir uns in gewisser Weise etwas, wenn wir all unser Vertrauen auf das GPS und verwandte Technologien setzen? Unterminiert die mit diesen Errungenschaften einhergehende Unmöglichkeit, verloren zu gehen, nicht unsere Fähigkeit, neue Wege zu suchen und zu finden, sowohl topografisch als auch im übertragenen Sinne? Und ist das Unbehagen angesichts unvertrauter Orte – wie etwa die Panik, die mich auf dem Rastplatz ergriff oder sogar die Urangst des Neugeborenen – nicht etwas, dessen wir bedürfen, um unserem Forschungsgeist auch weiterhin frönen zu können oder zu wollen, ob der sich nun auf die Weiten des Weltraumes oder die Dynamik von Quarks richtet? Es scheint mir ausgesprochen wichtig, dass wir einmal untersuchen, wie diese Veränderungen unser Leben beeinflussen.
Langsam senkt sich der Abend über den Washington Square. Die Sonne, die in einer Stunde untergehen wird, dehnt die Schatten der Häuser gen Westen, und die bald einsetzende Dunkelheit sorgt dafür, dass es die Sonnenanbeter aus dem Park zurück nach Brooklyn treibt. Auch mich hält es nicht mehr auf meiner Parkbank, denn ich verspüre ein Bedürfnis zu handeln, das seine Dringlichkeit zu einem gewissen Teil aus der Angst schöpft, die ich einmal empfunden habe.