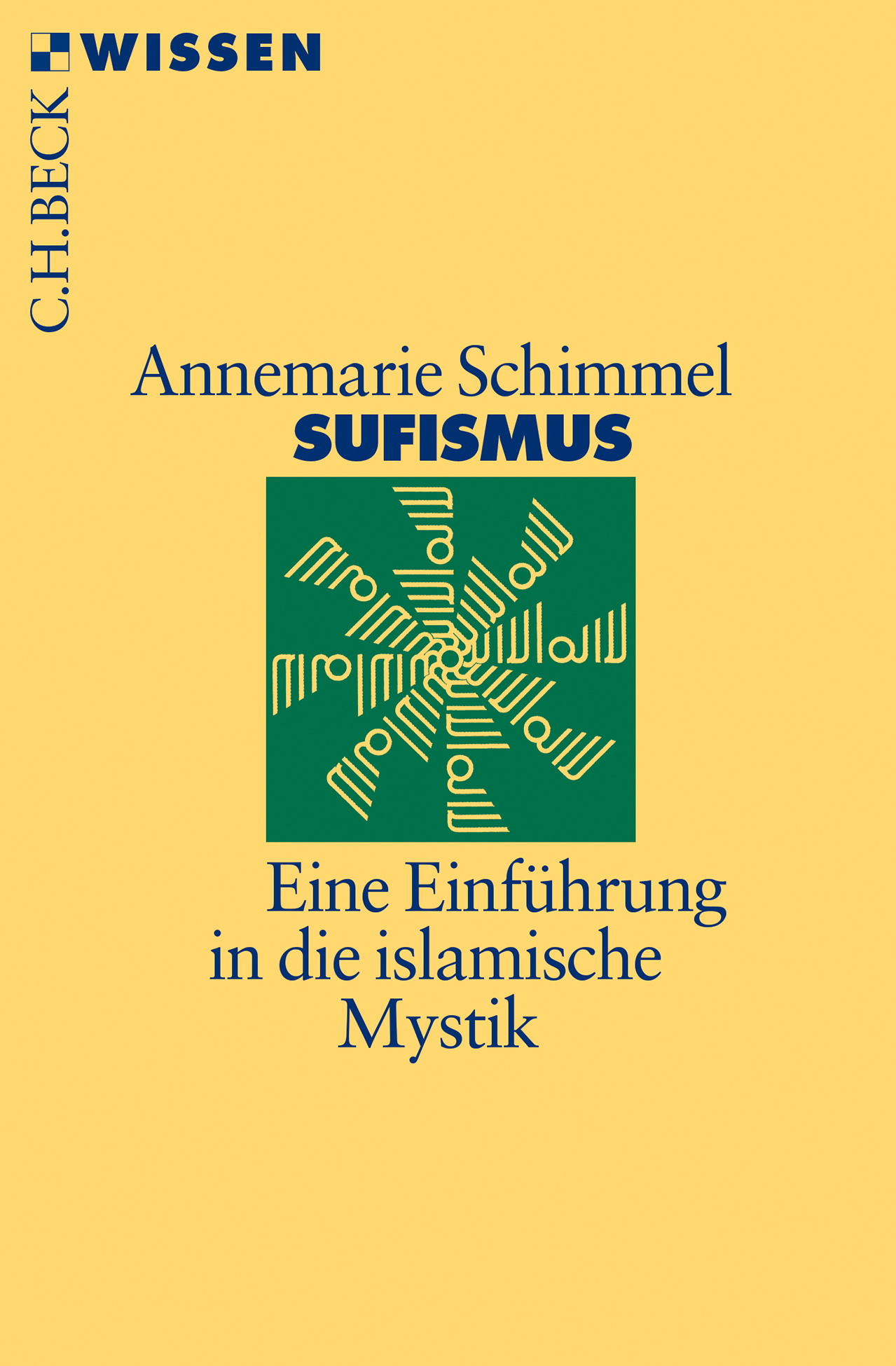
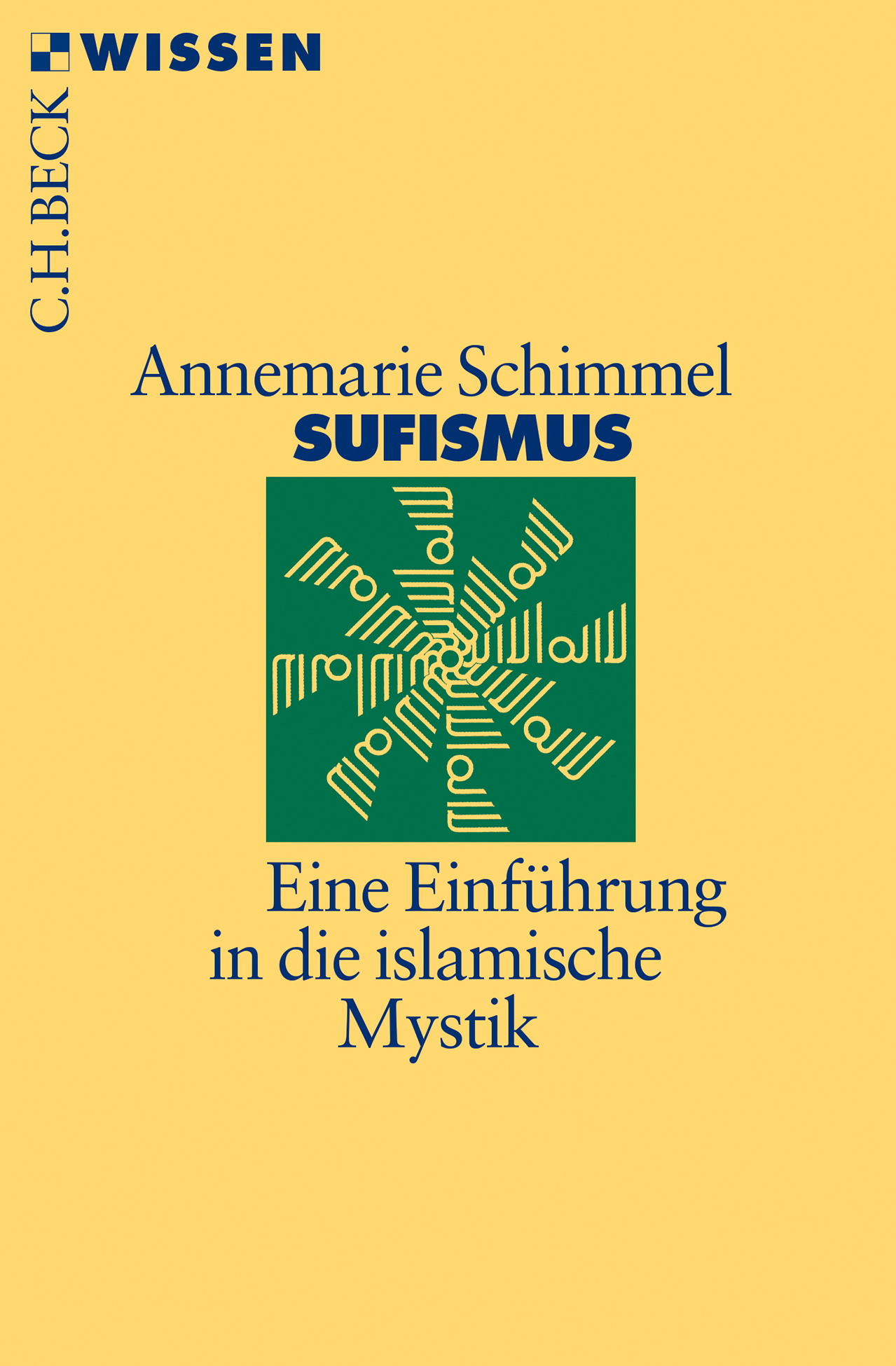
Annemarie Schimmel
SUFISMUS
Eine Einführung
in die islamische Mystik
Verlag C.H.Beck

Als die europäischen Orientalisten sich erstmals um 1800 mit dem Sufismus und dabei vor allem mit dem Phänomen der umherschweifenden, heulenden und tanzenden Derwische befassten, schien es ihnen, als habe dieser sehr wenig mit dem Islam zu tun. Auch heute fasziniert viele westliche Beobachter gerade die scheinbare Ferne des Sufismus vom orthodoxen Gesetzesislam. In der vorliegenden Darstellung zeigt Annemarie Schimmel hingegen, dass der Sufismus aus islamischen Wurzeln gewachsen ist, und beschreibt seine Entwicklung von der Entstehung im 8. Jahrhundert bis zu seinen heutigen Erscheinungsformen. Sie führt in die zentralen Begriffe der islamischen Mystik ein und schreitet die Stationen der Sufis auf ihrem Weg zur Gotteserkenntnis ab. Die bedeutendsten Sufi-Heiligen und ihre religiösen Praktiken werden ebenso vorgestellt wie die wichtigsten Werke der klassischen Sufiliteratur.
Annemarie Schimmel, 1922–2003, lehrte zuletzt als Professorin für Indo-Muslimische Kultur in Harvard und Bonn. Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorate, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1995). Ihre Publikationsliste umfasst mehr als hundert selbständige Veröffentlichungen. Bei C.H.Beck erschienen u.a. ihre Autobiographie «Morgenland und Abendland» (4. Aufl. 2003) sowie eine Anthologie mit Texten des Mystikers ʿAttar, «Vogelgespräche und andere klassische Texte» (2. Aufl. 2014).
Prolog
Einleitung
1. Die Entwicklung des Sufismus
Zum Begriff «Sufismus»
Sufi-Praktiken
Die Initiation durch den Meister
Die Stufen des Sufi-Weges
2. Mystische Gottesliebe
3. Theosophische Mystik
4. Sufismus und Literatur
5. Orden und Bruderschaften
Zur Organisation des Sufismus
6. Volkstümlicher Sufismus
7. Sufismus in moderner Zeit
Epilog
Anhang
Literaturhinweise
Verzeichnis der erwähnten Koranstellen
Glossar
Register
«Sufi» schrieb eine amerikanische Studentin in den Fragebogen, Spalte ‹Konfession›, der für das Seminar in Religionsphänomenologie zwecks Statistik ausgelegt war. «Sufi?», fragte ich. «Was tun Sie denn da?» – «Nun, wir tanzen Sufi-Tanz, und wir lesen Rumis Gedichte!» – «Können Sie denn Persisch?» – «Nein, wieso? Es gibt doch Rumi auf Englisch!»
Nun, die philologisch getreue Übersetzung von Dschalaladdin Rumis großem Lehrgedicht, dem Mathnawī, überträgt zwar den Inhalt korrekt und makellos, lässt aber kaum etwas von der Schönheit der Poesie ahnen; und bei den sehr freien Übertragungen auf Grund englischer Prosaübersetzungen wird oftmals der Sinn verbogen, die wunderbaren Wort- und Sinnspiele übergangen. Ich seufzte. «Haben Sie denn auch den Koran studiert?», fragte ich das Sufi-Mädchen. Sie sah mich ungläubig an: «Wieso? Wir sind doch Sufis, keine – wie sagt man – Mohammedaner …!» Ich schüttelte den Kopf. «Ein Sufi ist aber ein muslimischer Mystiker!», erwiderte ich. «Ach nein, wir lieben alle Religionen. Es kommt doch nur auf die Liebe an …!», sagte sie strahlend. Noch einmal versuchte ich es: «Was wissen Sie denn vom Propheten Muhammad?» Wie ich gefürchtet hatte, wusste sie gar nichts über ihn, der für jeden genuinen Sufi der Bezugspunkt seiner Initiationskette, der erste wahre Sufi überhaupt ist. Und so gab ich auf.
Aber was tun, wenn ein vielgelesener Schriftsteller kühn behauptet, dass Goethe, St. Franziskus, Napoleon und viele andere Sufis gewesen seien? Wie kann man da vom allgemeinen Publikum eine tiefere Kenntnis der Geschichte und des Wesens des Sufismus erwarten? Und in der Tat sind die Fragen, was Sufismus wirklich sei und wodurch sich ein Sufi auszeichne, kaum korrekt und allgemeingültig zu beantworten.
Der Sufismus ist, so eine Erklärungsmöglichkeit, die innere Dimension des Islam; aber er hat, wie jede mystische Strömung einer Weltreligion, ungezählte Facetten. Wenn man ihn beschreiben will, steht man bald vor einem blühenden Garten mit duftenden Rosen und klagenden Nachtigallen, die zu Symbolen für die göttliche Schönheit und die Sehnsucht der Seele werden, bald vor einer Wüste theoretischer, dem Uneingeweihten kaum verständlicher Abhandlungen in überaus kompliziertem Arabisch; dann wieder leuchten die eisigen Gipfel der höchsten theosophischen Weisheit in der Ferne auf, nur wenigen erreichbar. Der Sucher selbst verliert sich in einem bunten Markt volkstümlicher Sitten und Gebräuche, bevölkert von seltsamen Gestalten, deren Bewegungen und Worte oft von Drogen beeinflusst sind, oder aber er findet den Sufi, der das Herzensgebet übt, in der Stille einer abgelegenen Klause. Ein andermal tritt uns der Sufi als erfolgreicher Geschäftsmann entgegen, der seine Kraft für seine Arbeit aus den nächtlichen Meditationen empfängt, die ihn auf eine andere Ebene tragen.
Wie kann man ein solches Phänomen recht beschreiben?
Dazu kommt noch Folgendes: Als die europäischen Orientalisten sich erstmals um 1800 mit dem Sufismus zu befassen begannen und dabei vor allem die augenfälligen «Sufis», die umherschweifenden, heulenden, tanzenden Derwische, beschrieben, schien es ihnen, als habe der Sufismus sehr wenig mit dem Islam zu tun, und vielleicht ist einer der Anziehungspunkte, die dieses Phänomen für den westlichen Leser oder Beobachter so faszinierend machen, gerade seine scheinbare Ferne vom Gesetzes-Islam. Die Tatsache, dass einige führende Sufis im Laufe der Jahrhunderte hingerichtet worden waren, bestärkte die Beobachter in ihrer Vorstellung einer Dichotomie zwischen dem «offiziellen», Schariʿa-gebundenen Islam und dem Sufismus, und man übersah, dass der echte Sufismus aus islamischen Wurzeln gewachsen ist.
«Der Sufi ist der gute Muslim», schreibt William C. Chittick und folgt damit der alten Formulierung, dass «Sufismus ganz und gar rechtes Benehmen, gute Sitten» sei. Jedoch: «Der Sufi ist jemand, der nicht ist», lautet ein anderes altes Wort, das die Sufis sehr liebten, weil es treffend das Ziel des Mystikers andeutet, das auch mit dem schönen Ausdruck Meister Eckharts, entwerden, umschrieben werden kann. Entwerden in dem unbeschreiblichen göttlichen Wesen, so wie der Tropfen im Ozean, das war es, was viele der Sufis erhofften, aber sie wussten: Der Weg ist lang und sehr schwierig, und nur wenige können hoffen, ihr Ziel zu erreichen, das sie in immer anderen Symbolen und wechselnden Metaphern im Laufe der Zeit ausgedrückt haben.
Unter den Sufis gibt es große einsame Meister, die in ständiger Abtötung den harten Weg zu gehen suchen; es gibt begnadete Lehrer, die es verstehen, Menschen anzuziehen und in die Geheimnisse des Glaubens und der Liebe einzuweihen; es gibt ungebildete, simple Seelen, des Lesens und Schreibens nicht kundig, deren Ausstrahlung so stark ist, dass sie das Gnadengeheimnis wortlos dem Sucher einfach durch ihr Dasein und Sosein zeigen können. Es gab philosophisch-theosophisch geschulte Denker, die gewaltige Systeme erbauten, welche dann von späteren Generationen wieder vereinfacht und dabei oft verflacht wurden, und gottestrunkene Sänger, deren Lieder durch die Jahrhunderte erklungen sind, sei es in Nordafrika oder in Indien, in Anatolien oder Iran. Allen aber ist eines gemeinsam: die Suche nach dem höchsten Prinzip, ob man dieses nun als – wie Jacob Böhme sagen würde – «Ungrund» der Gottheit bezeichnet oder als den göttlichen Geliebten, ob man sich der unvorstellbaren Schönheit in Liebesüberschwang naht oder die Manifestationen Gottes Ebene für Ebene zu durchschreiten und so die «Schleier der Unwissenheit» zu heben versucht. Der Weg ist notwendig, und er ist lang und hart, selbst wenn es geschehen mag, dass die göttliche Gnade hin und wieder einen Sucher so anzieht, dass sie ihn in einem plötzlichen ekstatischen Erleben zur Vollendung bringt, wobei der Schock der Erleuchtung manchmal dazu führt, dass sich der Verstand umnachtet oder, wie es besser heißen sollte, «umtagt».
Nicht intellektuelles Wissen ist das letzte Ziel der Sufis, sondern existentielle Erfahrung; und wenn sie, die sich immer wieder daran zu erinnern suchten, dass Bücher nichts nützen, um das letzte Mysterium zu erfahren, auch ungezählte Bücher geschrieben haben, die oft nicht viel spannender sind als die von ihnen verachteten haarspalterischen juristischen und zum Teil auch theologischen Traktate, so wussten sie doch, dass es nicht auf die schwarzen Buchstaben ankam, sondern darauf, «das Weiße zwischen den Zeilen zu lesen», das heißt, den inneren Sinn der Worte, wie er von Generation zu Generation weitergegeben wurde, zu erfassen. Diese Haltung macht es für den wissenschaftlichen Erforscher des Sufismus schwer, korrekte Aussagen zu machen, da die dem Forscher bekannten «historischen» Fakten oft in der Überlieferung keine Rolle spielen: Was gilt, ist die Botschaft des Sufismus.
Für den Sufi ist, wie für jeden Muslim, das im Koran offenbarte Gotteswort Zentrum und Grundlage seines Lebens.
Der Koran, zwischen den Jahren 610 und 632 dem Propheten Muhammad zunächst in Mekka, dann in Medina offenbart und durch den dritten Kalifen ʿOthman (reg. 644–656) in seiner jetzigen Form redigiert, ist für den Muslim das offenbarte unerschaffene Gotteswort, das von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht und zur Zeit Muhammads in klarer arabischer Sprache niedergesandt wurde, um die vorhergehenden heiligen Bücher – Tora, Psalter und Evangelium – zu vollenden und ihre Irrtümer bzw. Fehlinterpretationen zu korrigieren. Teile aus den 114 Suren (Kapiteln) des Korans, die mit Ausnahme der 1. Sure, der Fātiḥa (Die Eröffnende), in absteigender Länge angeordnet worden sind, werden in den fünf täglichen Gebeten im arabischen Urtext rezitiert, und die Fātiḥa wird bei den Muslimen häufiger verwendet als das Vaterunser im Christentum; Fātiḥa wird geradezu zur Bezeichnung jedweder religiösen Handlung.
Muhammad, um 570 in der alten Handelsstadt Mekka geboren, wurde bei seinen Meditationen in der Höhle Hira nahe Mekka durch eine Offenbarung berufen «zu rezitieren», und die Stimme des Offenbarenden – der als Gabriel, der Bringer der Gottesbotschaften an alle Propheten, identifiziert wurde, befahl ihm «Iqra!», «Rezitiere – oder: Lies – im Namen deines Herrn …!» (Anfang von Sure 96). Es war die Kaufmannswitwe Chadidscha, die ihren um einiges jüngeren vertrauenswürdigen Helfer Muhammad in zweiter Ehe geheiratet und ihm eine Reihe von Kindern geboren hatte, die ihm über seinen ersten Schock hinweghalf, den das unerwartete Erlebnis verursacht hatte: Sie bestätigte ihn in seinem Glauben an die Echtheit und göttliche Herkunft der Offenbarungen und stützte ihn auch, als die Offenbarungen eine Weile ausblieben, doch dann mit neuer Kraft einsetzten und von den Pflichten zur Nächstenliebe, zum Almosengeben und zum Glauben an den einen und einzigen Gott, Schöpfer, Erhalter und Herrn des Gerichtstages, sprachen – jenes Gerichtstages, auf den sich die Frömmigkeit so sehr konzentrieren sollte. Chadidscha starb 619; drei Jahre später wanderte Muhammad mit seinen Getreuen in das nördlich gelegene Yathrib (bald madīnat annabī, «Stadt des Propheten», Medina, genannt) aus, wo er sowohl religiöse als auch politische Funktionen übernahm und im Laufe der folgenden Jahre seine Macht konsolidierte, bis er 630 im Triumph in seine Heimatstadt einzog. Zwei Jahre später starb er in Medina.
Der Koran ist das Zentrum des Islam; er ist das «buchgewordene Gotteswort», dessen Sprache für alle Gläubigen von staunenerregender Schönheit und daher unübersetzbar ist: Jede Übersetzung kann nur eine Annäherung an den Sinn des heiligen Buches geben, und im Gebet müssen seine Verse (āyāt, «Zeichen») auf Arabisch rezitiert werden. Für den Sufi hatte jeder Vers, jedes Wort des Korans einen tieferen Sinn, und die Geschichte der Koranauslegungen in den verschiedenen Glaubensrichtungen und vor allem im Sufismus spiegelt im Grunde sämtliche möglichen religiösen Haltungen der Muslime wider. So ist die Kenntnis und rituelle Rezitation des Gotteswortes ein wichtiger Aspekt des Sufismus, und die größten Sufi-Meister haben immer wieder erstaunliche Schlüsse aus den heiligen Worten gezogen oder aber ihre Werke aus der Meditation des Korans verfasst. Père P. Nwyia hat von einer «Koranisierung des Gedächtnisses» im frühen Sufismus gesprochen; denn durch die ständige tiefe Meditation des Korans sah der Sufi alles in der Welt gewissermaßen durch den Koran. Und war schon der gesamte Koran ein Zentrum frommen Lebens, so fanden die Sufis auch in einzelnen Versen besondere Botschaften, die für ihre Haltung und für ihr Leben grundlegend wurden – so die Aufforderung, Gottes häufig zu gedenken (Sure 33,41), da «durch das Gedenken an Gott die Herzen stille werden» (Sure 13,28); sie wussten, dass alles in der Welt ein Zeichen ist, das Gott «in den Horizonten und in den Seelen» gesetzt hat (Sure 41,53) und dessen Betrachtung zu Gott, dem Schöpfer, führt; sie lernten, dass Gott zu Beginn der Welt die künftigen Menschen aus den Lenden des erstgeschaffenen Adam gezogen und zum Gehorsam verpflichtet hatte, indem Er sie ansprach: «Bin Ich nicht euer Herr?» (Sure 7,172). Und sie lernten ebenso, dass Er, den die Blicke nicht erreichen (Sure 6,103), gleichzeitig dem Menschen näher ist als seine Halsschlagader (Sure 50,16) und dass Ihm die schönsten Namen gehören (Sure 59,24), ja, dass alles geschaffen ward, um Ihm zu dienen und Ihn anzubeten (Sure 51,56).
Muhammad nun, der, wie es heißt, des Lesens und Schreibens unkundig, ummī, war (Sure 7,157), war das reine Gefäß für das Gotteswort; im Sufismus genießt er eine besonders hohe Stellung und gilt als das eigentliche Ziel der Schöpfung. Der Koran lehrt, dass er die Reihe der vor ihm lebenden und lehrenden Propheten als «Siegel der Propheten» abschließt (Sure 33,40) und dass Gott und die Engel den Segen über ihn sprechen (Sure 33,56); so wurden diese Segenssprüche, die ṣalawāt-i scharīfa oder, in Indien, durūd, zu einem wichtigen Teil der Erziehung, und in vielen Sufi-Bruderschaften ist diese Formel oder ein anderer Segensspruch für den Propheten unabdingbarer Teil des Lebens, den der Fromme je nach Anweisung täglich mehr oder minder häufig wiederholen wird. Ungezählte Handbücher frommer Erziehung enthalten die schönsten Formeln für die Prophetenverehrung; um das lebendig zu erfahren, genügt es, in Marrakesch am Grabe des großen Sufi al-Dschazuli (gest. 1495) der Rezitation der dalāʾil al-chairāt zu lauschen, einer Sammlung von Anrufungen des Propheten und Segenssprüchen, die das Zentrum der religiösen Übungen der dortigen Sufis sind.
Muhammad, der nie behauptete, Wunder wirken zu können, da sein Beglaubigungswunder der Koran war, wird schon in früher Zeit von Wundergeschichten umgeben; Tiere und Pflanzen erkennen ihn als Propheten an, und alles, was schön ist, hängt nach islamischer Vorstellung in irgendeiner Weise mit ihm zusammen:
Du selbst bist schön, dein Namʾ ist schön,
Muhammad!
singt der türkische Volksdichter Yunus Emre (gest. um 1321). Die Segensmacht des Propheten zeigt sich darin, dass der Name Muhammad in seinen verschiedenen Aussprachen (Mehmet, Muh, Mihammad u.Ä.) eigentlich jedem muslimischen Knaben gegeben werden sollte, ebenso wie seine anderen Namen Ahmad, Mustafa und selbst die koranischen Suren-Namen Ṭāhā (Sure 20) und Yāsīn (Sure 36). Seine Schönheit manifestiert sich in allen Dingen: Ist nicht die duftende Rose aus den Schweißtropfen erwachsen, die während seiner Himmelsreise von ihm auf die Erde fielen?
Die Himmelsreise, miʿrādsch, des Propheten – aus Sure 17,1 entwickelt – wird für den Sufi das Vorbild für seine eigene Reise in die unmittelbare Nähe Gottes, und die islamischen Literaturen, vor allem die persisch-türkische Sufi-Dichtung, enthält die farbenreichsten Schilderungen dieses wunderbaren Erlebnisses, in dem der Sufi ein Vorbild für seinen himmelwärts führenden Weg sieht.
Andererseits wurden die Aussprüche des Propheten und die Berichte über seine Werke und Taten, ḥadīth, zur Richtschnur des praktischen Verhaltens der Muslime, und die Sufis standen ihren orthodoxen Kollegen nicht nach, wenn es sich um die Nachfolge des Propheten selbst in den kleinsten Einzelheiten des Rituals handelte:
So versuchte der Schiraser Sufi Ibn-i Chafif (gest. 982 als Hundertjähriger), auf Grund eines ḥadīth das Pflichtgebet auf Zehenspitzen zu verrichten, «und das ist sehr schwer», wie er treuherzig hinzufügt. Doch der Prophet erschien ihm im Traume und sagte, dies sei nur für ihn selbst nötig; der Sufi solle sich nicht damit abquälen …
Neben den Sammlungen der prophetischen Überlieferungen findet man auch das sogenannte ḥadīth qudsī, ein außerkoranisches Gotteswort, und viele dieser Worte preisen den Propheten, wie etwa das laulāk-ḥadīth: «Wärest du nicht, so hätte Ich die Himmel nicht geschaffen», soll Gott gesagt haben, ebenso wie in späterer Zeit, etwa vom 12. Jahrhundert an, das angebliche Gotteswort anā Aḥmad bilā mīm (Ich bin Ahmad [= Muhammad] ohne das m), d.i. Aḥad (Einer), im Ostteil der islamischen Welt unter den Sufis sehr beliebt wurde. Denn Muhammad wurde im Laufe der Zeit zum insān kāmil, zum Vollkommenen Menschen; das Erste, was Gott geschaffen hatte, war sein Licht, und Sein Prophet ist gewissermaßen die Nahtstelle zwischen dem urewigen Gott und dem Geschaffenen. So hoch die Stellung Muhammads in der Mystik aber auch sein möge, der Gedanke einer Inkarnation wird im Islam strengstens abgelehnt. Der höchste Rang, den der Mensch erreichen kann, ist der des «Dieners Gottes»; denn in seinen beiden höchsten Erlebnissen wird der Prophet im Koran als ʿabduhu, «Sein Diener», bezeichnet: am Beginn von Sure 17,1: «Gepriesen sei Der, der reiste zur Nacht mit Seinem Diener …», und Sure 53,10: «Er offenbarte Seinem Diener, was Er offenbarte.»
Damit ist auch die Stellung des Menschen umschrieben, der, wie der Prophet, ein vollkommener Diener Gottes sein soll. Hier also liegen die Grundlagen des Sufismus: in der Anerkennung der absoluten Macht des nur durch Seine Zeichen erkennbaren Gottes, im vollen Vertrauen auf die koranische Offenbarung und in der Verehrung des Propheten Muhammad.
Aber wie und warum konnten sich solche Bewegungen überhaupt im Islam entwickeln? Nach dem Tode Muhammads 632 und zur Zeit seiner ersten Nachfolger dehnte sich das islamische Reich in erstaunlicher Geschwindigkeit aus; der Fruchtbare Halbmond, Iran und Nordafrika wurden erobert, und im Jahre 711 überschritten die muslimischen Heere die Meerenge von Gibraltar (dschebel ṭāriq, «Berg des Tariq», benannt nach dem jungen Heerführer Tariq). Im gleichen Jahr erreichten sie Sind, das heutige südliche Pakistan, und überschritten den Oxus, Amudarya, nach Zentralasien. Alle diese Randgebiete sollten zu wichtigen Zentren islamischer Kultur werden.
Zu ebendieser Zeit entwickelten sich kleine Gruppen von Frommen – gewissermaßen Proto-Sufis – vor allem im Irak, wo der große Prediger Hasan al-Basri (gest. 728) asketische Frömmigkeit predigte und praktizierte, die der immer stärker werdenden Verweltlichung entgegenwirken sollte. Die ihm nahestehenden Asketen lehnten alles Weltliche ab und konzentrierten sich auf die Lektüre und Meditation des Korans; nächtliche Andachten und Gebete wurden geübt (denn obgleich das nächtliche Gebet im Koran erwähnt wird, wurde es nicht in den Kanon der fünf Tagesgebete einbezogen, galt aber und gilt noch bei den Frommen als besonders verdienstvoll). Man meditierte über die koranischen Gerichtsandrohungen und weinte über seine Sünden, in ständiger Furcht vor dem Gerichtstag, an dem man auch über die kleinste Tat Rechenschaft würde ablegen müssen. Furcht Gottes stand im Zentrum des Lebens. Die frühen Asketen hatten auch Kontakte mit christlichen Eremiten im Irak und in Syrien, und es gab einen gewissen Austausch zwischen den beiden Gruppen, die gleichermaßen von der Vergänglichkeit und Nutzlosigkeit aller irdischen Freuden wussten und nur Gott ersehnten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Rolle, die Jesus in der frühen Asketik spielt. Er, von der Jungfrau Maria geboren (Sure 19), im Koran als letzter Prophet vor Muhammad und gewissermaßen als sein Wegbereiter gepriesen, wird zum Modell der Gottesliebe und Milde und hat im Sufismus noch immer seinen Platz als großer «Arzt der Herzen».
In die recht finstere asketische Frömmigkeit kam ein etwas anderer Ton durch eine Frau – zumindest sagt das die Überlieferung: Rabiʿa von Basra (gest. 801), als weltabgewandte Asketin berühmt, drückte ihre Gottesliebe in kleinen kunstlosen Versen aus. Am berühmtesten ist die Geschichte, dass sie durch Basras Straßen ging, eine Fackel in der einen, einen Eimer Wasser in der anderen Hand; nach dem Sinn ihres Tuns befragt, antwortete sie: «Ich will Wasser in die Hölle gießen und Feuer ans Paradies legen, damit diese beiden Schleier verschwinden und niemand mehr Gott aus Höllenfurcht oder Hoffnung aufs Paradies anbetet, sondern allein um Seiner ewigen Schönheit willen.» Diese Geschichte wurde später vom Kanzler Ludwigs des Heiligen nach Europa gebracht und erscheint wieder in den Schriften des französischen Quietisten Camus (1644). Sie klingt auch wider in einigen modernen europäischen Kurzgeschichten, wie z.B. Max Mell, «Die schönen Hände».
Es ist ebendiese Gottesliebe, die Rabiʿa verkündete und die in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Zentrum des Sufismus wurde.
Der Begriff «Sufismus» leitet sich ab von ṣūf, «Wolle», und weist auf das Wollgewand der Asketen hin, wenngleich man versucht hat, das Wort vom griechischen sophos, «Weisheit», oder vom arabischen ṣafā, «Reinheit», abzuleiten; auch vermuteten einige frühe Exegeten, die Sufis seien gewissermaßen die Nachfolger der ahl aṣ-ṣuffa, der «Leute der Vorhalle», die fromm und bescheiden im Hofe des Propheten lebten. Der Mystik fern oder feindlich gegenüberstehende Muslime werden freilich oft erklären, dass Sufismus, taṣawwuf, nicht islamisch sein könne, da das Wort oder seine Wurzelbuchstaben nicht im Koran vorkämen; es sei ein verwerflicher menschlicher Versuch, Gott nahezukommen; und der habe zu Bräuchen geführt, die nichts mit dem strengen echten Islam zu tun hätten. Diese Meinung herrscht vor allem in Saudi-Arabien vor, aber auch in «islamistischen» Gruppen zwischen Nordafrika und Pakistan.
ʿ