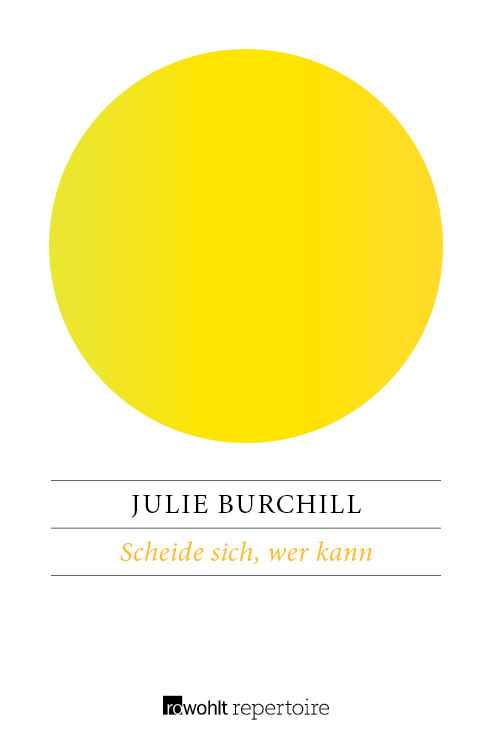
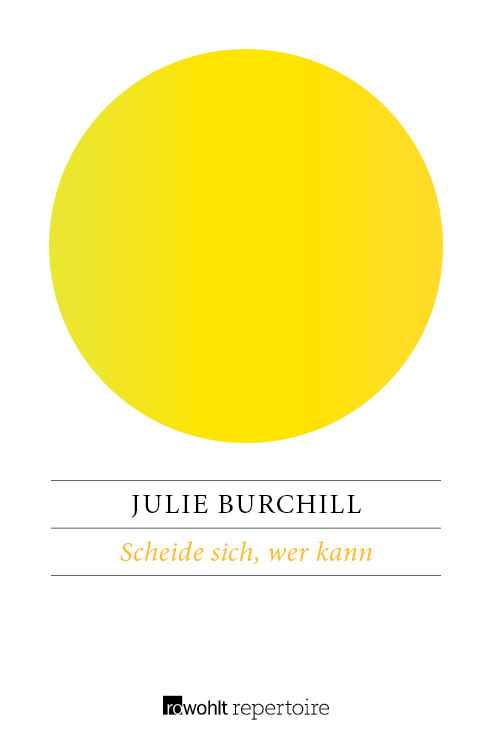
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
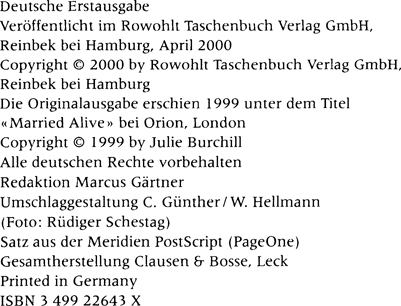
ISBN Printausgabe 978-3-499-22643-4
ISBN E-Book 978-3-688-11583-9
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-11583-9
Für Daniel
Ich erwachte gegen Mittag, fühlte mich buchstäblich zum Kotzen und fing natürlich sofort an zu jammern.
«Warum ausgerechnet ich, Gott?» (überflüssige Frage), «Nie wieder!» (physikalisch möglich, bei meiner Vergangenheit aber äußerst unwahrscheinlich) – und als nächstes wünschte ich mir meine Mutter herbei. Traurig, was? Eine tragische Farce. Geradezu mitleiderregend. Und das ist, nebenbei bemerkt, englisches Understatement in Reinkultur.
Ich rannte ins Bad. Die einzige Gelegenheit seit meinem Schulabschluß, bei der ich zu rennen pflege – wenn ich kurz vorm Kotzen stehe. (Ich schätze, das sagt einiges über mein Leben aus. Irgendwie teeniemäßig.) Also umklammere ich die Kloschüssel – als wollte ich beten oder hätte gerade erfahren, daß Daniel Day-Lewis mal hier gesessen hat –, kotze und denke dabei an meine Mutter. Nicht gerade Tätigkeiten, denen man so nachgehen sollte, schon gar nicht gleichzeitig, oder?
Ich dachte an die Entschuldigungen – jetzt kann ich es ebensogut zu Ende erzählen –, in denen meine Mutter immer schrieb, ich hätte am Dienstag nachmittag einen Anfall von «Gallenfieber» erlitten, damit ich mich um die Doppelstunde Sport drücken konnte. Zuerst mußte ich selbstverständlich tun, als würde ich kotzen; man probiere es ruhig zu Hause aus, aber bloß keinen Erwachsenen um Rat bitten. Mein bester Trick bestand darin, eine Bird’s-Eye-Fertigmahlzeit im Kochbeutel zuzubereiten – Rindfleischeintopf mit Knödeln war nicht übel, das samtdunkle Braun sah wirklich bedenklich aus –, den größten Teil davon herunterzuschlingen und dann einige Löffelvoll in der Toilettenschüssel zu verschmieren. Sobald ich hörte, wie meine Mutter die Tür aufschloß, taumelte ich, in Tränen aufgelöst, die Treppe hinunter und wies mit empörter Geste ins Obergeschoß unserer Vorstadt-Doppelhaushälfte, so als kniete mein nackter Onkel gestiefelt und gespornt auf meinem jungfräulichen Bett.
«Geh nicht rauf!» krächzte ich. «Ich konnte noch nicht –»
Denkste, sie eilte gehorsam wie ein Lamm die Treppe hinauf und entdeckte das dampfende Desaster. Ich bekam meine Entschuldigung, und wenn sie ihre Spendierhosen anhatte, sogar den ganzen Tag frei. Phantastisch! Dann konnte ich nachmittags herumsitzen, Corona kippen, House Party in der Glotze gucken und die herrliche Aussicht im Spiegel genießen.
Man sollte meinen, ihr wäre irgendwann aufgefallen, daß ich mich immer nur von Rindfleischeintopf mit Knödeln übergab, oder? Und sie hätte mir schlicht geraten, es zur Abwechslung mal mit dem Kochbeutel-Kabeljau in Kräutersoße zu versuchen. Gehirnnahrung. Aber meine Mum war kein Einstein, nicht mal ein Epstein. Allerdings mit tollen Beinen, und die scheint sie mir vererbt zu haben. «Die besten Freunde eines Mädchens sind ihre Beine», sagt Matt immer – ich meine, er sagt es immer. «Aber selbst die besten Freunde müssen mal auseinandergehen!» Genialer Witz, was? Lieber Leser, ich habe tatsächlich einmal über seine Witze gelacht.
Ich schwankte zurück zum Bett und schaute mich zaghaft im Loft um – ganz behutsam, Zentimeter für Zentimeter, wie ein häßliches Mädchen vor dem Spiegel. Der Anblick schrie förmlich nach Linderung durch Augentropfen – es gibt nur wenig, das deprimierender wäre als die Trümmer des Wohllebens. Und es stand erstaunlicherweise alles so deutlich vor mir wie am vergangenen Abend – das heißt, in den frühen Morgenstunden, denn wir hatten bis in die Puppen gefeiert.
«Warum sagt man eigentlich bis in die Puppen?» hatte Zoë gefragt und mit der Bollinger-Flasche auf mich gezeigt.
«Hm …»
«Weil du dann so besoffen bist, daß du dir wie eine Puppe in den Kokon pinkelst!»
Wir fielen beinahe um vor Lachen. Ja, lieber Leser, genau diese Art Abend war es.
Die Art Abend, für den man den Begriff «Cocooning» erfunden hat, weil man sich ernsthaft fragt, weshalb überhaupt jemand ausgeht, wenn er nicht gerade einen Eimer Drogen kaufen will. Wodka Absolut auf Eis, Ella auf dem Plattenteller und Zoe auf meinem Gesicht – kleiner Scherz! Ich bin doch eine anständige verheiratete Frau. Ich konnte den Loft sehen, der tagsüber wie die Eisstation Zebra aus dem gleichnamigen Film wirkte, höhlenartig wie ein dunkler Mutterschoß – keine Sorge, ich habe meine Assoziationen im Griff, ich lasse mich nur von den Besten analysieren.
«Ich gehe zur Analyse», erzählte ich meiner Mutter.
«Hat das was mit Verdauungsstörungen zu tun, so wie bei Prinzessin Diana?» fragte sie, ganz Ohr, dafür ohne Hirn.
Der Loft wirkte anheimelnd, gedämpftes Licht, Rotholzboden und das kitschige künstliche Kaminfeuer, über das meine Freundinnen lachen, während sie sich die Hände daran wärmen. Feuerzungen lecken über Zoe, Lucy, Emma und mich hinweg. Zoë, Lucy und diese verdammte Emma – drei kleine Mädchen aus der Public School! Auch das sagt etwas über mein Leben: Als ich in meiner ursprünglichen Umgebung zur Schule ging, hießen meine Freundinnen Susan und Julie. Und zwar alle. Um sich zu unterscheiden, trugen sie Namen wie heute die Rapper – Julie B. und Susan T. Total cool. Wenn ich heute mein Telefonregister aufschlage, überfallen mich Horden von Cressidas, Carolines und Clemencies, dazu noch die liebsten und besten, die Zoës, Lucys und Emmas.
«Hier spricht Emma – Emma Young», sagt eine von ihnen am Telefon.
«Ja, ja», falle ich ihr barsch ins Wort, «was glaubst du wohl, wie viele Emmas ich kenne?»
Da sie ein braves Mädchen ist, erwidert sie nichts darauf, aber ich weiß, was sie denkt. Sie denkt, du meine Güte, Nicole hat ihre Wurzeln verloren. Allerdings weiß sie nicht, daß Nicole dabei auch ihr verflixtes A verloren hat. Ich kam als Nicola Sharp zur Welt, doch auf der Kunstschule kam es mir gewöhnlich vor; zu spät ging mir auf, daß ein englischer Arbeitername sehr viel cooler ist als ein französischer Nuttenname, der niemals cool, höchstens exzentrisch sein kann. («Zu spät» – ist das der schlimmste Satz? Schlimmer noch als «Ich kriege den Reißverschluß nicht zu»?) Dann kam ich auch noch unter die Haube, Gott steh mir bei; und aus Nicola Sharp war Nicole Miller geworden. Geopfert auf dem Altar meiner Empfindsamkeit.
Ich stieg wieder aus dem Bett und warf einen genaueren Blick auf die Bescherung. Überall auf dem Boden lag Zeug herum. Sie wissen schon, eben Zeug. Die Sorte Zeug, von der meine Mutter zu sagen pflegte: «Was ist das denn?», während sie es zwischen Daumen und Zeigefinger hoch hielt und mich verständnislos anblickte. Zusammengerollte Geldscheine. Zigarettenfilter ohne Zigaretten. Taschenbücher mit rausgerissenen Seiten. Ich mag eigentlich gar nicht daran denken, wieviel Geld wir vier uns letzte Nacht reingejagt haben. Das ist das Problem mit Drogen; während die meisten Dinge entweder Problem oder Lösung sind, sind Drogen beides. Ehrlich.
Ich nahm allen Mut zusammen und schaute in meine Tasche. Gott im Himmel. Wer hatte meiner Wohnung einen Besuch abgestattet und sich ein Souvenir mitgenommen, während ich schlief? Vielleicht die Drogenfee? Könnte sie zufällig mit der Zahnfee verwandt sein? Genau, so läuft das ab: Die Zahnfee kriegt die ausgefallenen Zähne, die Drogenfee die Drogen. Die Zahnfee bringt einem Geld dafür, die Drogenfee treibt einen in den Ruin. Na ja, ich weiß jedenfalls, für welche ich mich entscheide, wenn ich mal groß werde.
Ich wollte aufräumen – auf mein Wort, Euer Ehren, ich wollte es wirklich –, aber mein Magen sagte nein. (Sie erinnern sich, seinen Inhalt hatte ich in der Toilettenschüssel deponiert, während ich darauf wartete, daß Daniel Day-Lewis an den Ort des Geschehens zurückkehrte.) Ich legte mich wieder ins Bett, dachte nach – über Meine Sünde, so hieß ein altes Parfüm von mir, bevor sie sich Namen wie Slag und Skag ausdachten – und machte mich daran, die vergangene Nacht zu rekonstruieren. Es war wie mit diesem fürchterlichen Escher-Puzzle, das meine Mutter als Folterinstrument angeschleppt hatte, als ich wegen Heuschnupfens sechs Wochen nicht zur Schule gehen konnte. Ehrlich, meine Augen quollen förmlich aus dem Kopf, während ich mich bemühte, diese Typen zusammenzusetzen, die Treppen ins Nichts hinaufsteigen und alle gleich aussehen. Kein Wunder, daß ich ein Déjà-vu-Erlebnis hatte, als ich zum erstenmal das National Theatre betrat. Vielleicht lag das aber auch an Matthew und seinen abgestandenen Witzen.
Jedenfalls hätte ich weder auf die Bibel noch auf die letzte Details-Ausgabe geschworen, aber ich glaube, es spielte sich folgendermaßen ab: Lucy tauchte um acht auf. Sie kam geradewegs von der Arbeit, zusammen mit Zoe und drei Flaschen Moët. Wir setzten uns auf den Boden und lauschten den Klageliedern komplizierter amerikanischer Frauen. Mädchen, wollt ihr wissen, wann ihr wirklich betrunken seid? Wenn ihr Janis Ian auflegt, At seventeen, und vollkommen ernsthaft zu euren Freundinnen sagt: «Das seid ihr – das bin ich – das sind wir alle!» Zoë sagte, sie sei fertig mit den Männern. Das sagte sie übrigens zweieinhalb Stunden an einem Stück. Dann – Überraschung! – klingelt ihr Handy; dran war ihr Ex, die Stimme voller Sex, und sie total perplex. Ob Sie es glauben oder nicht, weg war sie! Sogar ihre Line ließ sie liegen! Wie ein Blitz: ein kurzes Aufglühen und dann nichts mehr.
Ich sehe zu Lucy hinüber und deute keuchend auf die Tür. Ich bin eine lebende Skulptur mit dem Titel «Frauen sind sich selbst die schlimmsten Feinde». «Hast du das gesehen? Bin ich verrückt, oder wie?»
Lucy nickt. «Du bist verrückt, aber ich habe es auch gesehen.» Ihre Stimme klingt nach Pimm’s-Bowle; die Gurkenscheiben richten irreparablen Schaden in den Arterien an. Dann lächelt sie bittersüß. Bittersüß, das ist eigentlich nur ein schnöseliger Euphemismus für lausig. «Hast du ihn kennengelernt?»
«Dieses Vergnügen hatte ich, das kannst du mir glauben. Zum Glück nicht in der Horizontalen, im Gegensatz zu ihren meisten Freundinnen.»
«Ach, komm schon. Er sieht Robert Newman unheimlich ähnlich. Man kann ihr wirklich keine Vorwürfe machen.»
«Na, toll», erwidere ich schlecht gelaunt. «Denn sie sieht David Baddiel unheimlich ähnlich.» Das war unfair, es stimmt eigentlich nicht. Nicht bei künstlicher Beleuchtung. Pfirsichfarbener künstlicher Beleuchtung. Mit fünfundzwanzig Watt.
Es klingelt. Ich gehe an die Sprechanlage. Es ist Emma. «Emma Crewe», sagt sie vorsichtig. Wie ich das hasse.
«Ich weiß», fauche ich. «Was glaubst du wohl, wie viele Emmas ich kenne?»
Diese hier ist übrigens weder so reiz- noch so geistvoll wie die andere, Emma Young. Auch ist sie, man kann es ruhig laut sagen, nicht so sensibel. Sie steht also auf der Straße und stöbert in den losen Seiten ihres winzigen Filofax-Hirns nach einer Antwort, während die Blätter unbemerkt in der Film-Noir-Finsternis davonflattern. «Na ja, da wären Emma Young, Emma Hope, Emma Forrest, Emma Ballantine, Emma mit der Tätowierung, nein, die heißt Gemma –»
«Herrgott im Himmel!» Ich betätigte den Türdrücker und schaute Lucy an. Wie gern würde ich aussehen wie sie. Sie saß neben dem Kamin, wie üblich sinnend und sehnsuchtsvoll, eine blonde, überaus englische Alice im Wunderland, die Lewis Carroll geheiratet hat und neben dem Jabberwocky aufgewacht ist. Es ist schon komisch mit diesen urenglischen Mädchen: in ihrer Gegenwart fühlt man sich so verdammt ausländisch, selbst wenn man keinen Tropfen Kanakenblut in den Adern hat.
«Was ist los, Zuckerpuppe?» fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf, wobei ihre Haarspange herausfiel. Noch Tage, nachdem Lucy da war, finde ich Zeug, das aus ihren Haaren gefallen ist. Spangen. Netze. Kämme. Schleifen. Dieses ganze komische Zeug. Es ist wirklich komisch, sich Zeug ins Haar zu tun, solange es nicht aus einer Tube kommt. Wie Stammeszeichen. Der uralte Stamm des glücklich-unglücklichen, sehr englischen und beinahe klugen Mädchens aus der Oberklasse, das um ein Haar schön zu nennen wäre. «Oh, ich … oh. Es ist nur wegen William.»
Ich nickte grimmig. Nur William. So nennen Zoë, Emma und ich ihn immer. Denn der Name paßt. Es gibt einen Typ Mann, der als gerissener, lügender, betrügender Schuljunge anfängt, Nur William eben, für den Frauen der Feind schlechthin sind, und der sich schließlich als eben jener Nur William entpuppt, der mit seinen gerissenen, ach so süßen Lügen das einzige Leben ruiniert, das eine Frau besitzt. Sie müssen wissen, Lucys Problem besteht darin, daß sie einen verheirateten Mann liebt. Moment mal, habe ich «Mann» gesagt? Nein – so kann man ihn nicht nennen. Für mich ist ein «Mann», der seine Frau betrügt, kein Mann, sondern ein Schwein, eine Ratte oder eine andere Kreatur aus dem chinesischen Tierkreis. Oooh, rufen Sie jetzt; oooh, die ist aber verbittert! Offensichtlich hat sie unter einem verheirateten Mann gelitten! Verdammt, Sie haben recht – und zwar unter meinem eigenen!
Ich wußte doch, daß Sie das zum Schweigen bringen würde! Kommen Sie dem Stier bloß nicht in die Quere – er hat Hörner! Jedenfalls kommt Emma rauf, stoned bis zum Gehtnichtmehr. Sie hat das halbe Wunderland des Westens eingeschmissen und wird erst aufhören, wenn sie umfällt. Also führt eins zum anderen – her mit der Doors-CD – wer denkt an morgen, wenn Lucy down ist, Emma high und Jim uns drängt, zur anderen Seite durchzubrechen (von was? Hab mich nie getraut, danach zu fragen), und bevor ich mich versehe, spaziert mein netter Vorrat, den ich ausschließlich zum Arbeiten benötige und von dem ich Zoe und Lucy nur eine winzige Prise abgegeben habe, hervor, stellt sich in einer Linie auf und marschiert seinem Schöpfer entgegen.
Wir haben uns prächtig amüsiert – soviel ist sicher. An so was erinnert man sich einfach, oder? Wenn der Koks bereitliegt und der Alkohol fließt, werden einfach alle zu faszinierenden Partykreaturen, selbst die alte Freundin, mit der man schon tausendmal die gleiche Unterhaltung geführt hat; alles ist neu, kaum greifbar. Und am Morgen haben einen die faszinierenden Partykreaturen natürlich bis auf die Haut abgezogen! Worauf man denkt, beim nächstenmal weiß ich Bescheid: Bloß nicht mit faszinierenden Partykreaturen reden! Einziges Problem: Faszinierende Partykreaturen erscheinen stets in der Gestalt öder alter Freunde!
Deshalb ist Kokain auch eine so märchenhafte Droge. Sie zieht einen nicht runter wie H. Nervt nicht wie Speed. Sie ist wie Zauberstaub: Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen, und alle folgen uns! Wir kommen rattengleich in Hameln auf den Trip, die ganze Meute auf den Fersen, und walzern – obwohl wir über zwanzig sind – geradewegs nach Nimmerland. Ha! Ich liebe diese Ironie! Denn Nimmerland stimmt: Kommt man erst auf den Geschmack von Kokain, muß man schon Zahnarzt sein, sonst klettert das Konto nimmermehr aus den Miesen. Vertrauen Sie mir, ich kenne mich aus.
Ich sah mich zu Tode erschrocken um, als beobachtete mich jemand mit einer versteckten Kamera; eine Line brauchte ich noch. Danach könnte ich aufräumen, ein Meisterwerk malen oder zumindest meine Fußnägel lackieren. Dann noch ein leichtes Mittagessen, das alle Nahrungsgruppen in einem ausgewogenen Verhältnis enthielt, und ich würde den Weltfrieden sichern.
Nur … hat man erst die Line gehabt, verspürt man nicht mehr das Bedürfnis, auch nur eine der obengenannten Taten zu vollbringen. Sie kommen einem beinahe … geschmacklos vor. Irgendwie übertrieben. Was man wirklich tun möchte, was man tatsächlich in sich spürt, ist der Drang, The Lexicon of Love aufzulegen, mit dem Make-up-Beutel in der Hand abzutanzen und stundenlang mit seinen Freundinnen – denn wie können wir eins mit der Welt sein, solange wir nicht eins mit unseren Freundinnen sind? – am Telefon darüber zu reden, ob FABs besser waren als LUVs, was bloß aus Ayesha Brough und Aztec-Bar-Schokoriegeln geworden ist und ob man vielleicht katholisch werden sollte («Denn das ist das einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe.» – anzügliches Kichern).
Komm mir bloß nicht mit dem Morgen danach, Mann. Von wegen den Teufel mit Beelzebub austreiben. Ich habe es erlebt. Praktisch im Abo. Wie eine Monatskarte bei der Bahn – die anderen Raver halten meinen Platz frei, wenn ich zu spät komme. Ich war so oft dabei, daß der Zug gar nicht ohne mich abfährt. Hab nichts zu verlieren. Schreib dir das hinter die Ohren, Mann.
Wissen Sie, was die Jagd auf ein Phantom ist? Wenn man entgegen aller Wahrscheinlichkeit zutiefst davon überzeugt ist, daß man noch ein einziges Grämmchen irgendwo versteckt hat. Ein blödes Verhalten, in das Leute verfallen, wenn ihr rein zur Entspannung gedachter Drogenkonsum aus dem Ruder läuft. Wenn er zur Gewohnheit wird. Ich hasse Menschen, die derart außer Kontrolle geraten – typisch achtziger Jahre. Na ja, jedenfalls hatte ich soeben Matthews Meißel, Zangen und Elektrobohrer geholt und wollte mich an dem losen Brett neben der Badezimmertür zu schaffen machen, als das Telefon klingelte.
Und es war natürlich Die Stimme. Die Stimme, nach der ich mich gesehnt, nach der ich geschmachtet, die ich gefürchtet hatte, wann immer das Telefon klingelte. Eine Stimme aus dem West Country, diese einzigartig verletzliche, niemals der modernen Zeit angepaßte Stimme, die selbst im Flüstern noch zu brüllen schien: «Hallo, das geht an alle Einbrecher und Trickbetrüger da draußen! Warum kommt ihr nicht mal vorbei und raubt mich aus? Am besten kurz vor dem Mittagessen, dann bin ich immer zum Einkaufen – ihr könnt es in zehn Minuten schaffen, was euch die Peinlichkeit erspart, mir ins Gesicht zu blicken. Ich sag euch was – ich lege einfach den Schlüssel unter die Matte! Ist doch fair, oder?» In dieser Stimme lag nichts von der Aufdringlichkeit des Südens oder der Rauheit des Nordens; diese Stimme hatte ich wie eine Haut abgestreift, damit etwas Besseres darunter zum Vorschein käme. Und nun war ich irgendein «Mädchen» in den Dreißigern, das von Nirgendwo stammte und in London lebte, nicht richtig dorthin gehörte und längst dem Glauben entwachsen war, die Stadt könne ihm gehören; mit einer Stimme und einem Wesen, denen jeder Gedanke an soziale Schicht oder regionale Unterschiede abhanden gekommen war – und für mich bedeutet es tatsächlich nicht nur einen Unterschied, sondern eine Auszeichnung, ein Mädchen aus der Arbeiterklasse des West Country zu sein –, bis ich nur noch eine schlechte, verschwommene Kopie des Menschen abgab, der ich einmal gewesen war. Ich war gesund, gut bei Kasse und mochte meine Arbeit – und, offen gesagt, gab es inzwischen drei Tage im Monat, an denen ich aufwachte und wünschte, ich wäre tot. Und es waren nicht die Tage vor meiner Periode, obwohl ich schon von allen Seiten das blöde Kichern der Typen höre. Und es hatte auch nichts damit zu tun, daß ich eine anständige Nummer oder mehr Feminismus brauchte oder arbeitete oder keine Kinder hatte, denn diese Erfahrungen haben viele Menschen und nicht nur Frauen gemacht, seit der erste Höhlenmensch eines Morgens erwachte, zum Fluß ging, um sich das Gesicht zu waschen, und aufstöhnte: «Oh, Scheiße, nicht schon wieder du.» Es handelt sich um einen potentiell lebensbedrohlichen Zustand, den man Menschsein nennt – und gegen den einfach kein Kraut gewachsen ist.
Nur weiter so, Nicola, das hebt unsere Stimmung gewaltig! Jedenfalls war meine Mutter Teresa am Telefon. Sag Terry zu ihr, und sie sagt dir, wo’s zur Unfallklinik geht. Eine gemeingefährliche Frau. Die Frau, durch deren Schuld ich beinahe der unteren Mittelklasse entsprungen wäre, gemeiner kann man ja wohl kaum sein. Aber ich habe sie in die Mangel genommen. Sie und ihre Häkelpüppchen über den Klopapierrollen. Ich weiß, das klingt ein bißchen hart, denn mit meiner Stimme bin ich ja ganz ähnlich verfahren. Aber ich hatte nicht vor, mir meinen brillanten Start ins Leben, mein blaues Arbeiterklasseblut, durch eine Häkelpuppe auf einer Rolle Klopapier versauen zu lassen. Nicht mit mir!
Diesmal klang meine Mutter nicht so forsch, gesegnet seien ihre Nylonstrumpfhosen Marke Sonnenbräune, während sie tapfer mit meinem Anrufbeantworter kämpfte. Angesichts ihres Stotterns und Stammelns, das an einen Geschwindigkeitsfreak bei Master Mind erinnerte, muß sie wohl an eine körperlose Stimme aus dem Jenseits geglaubt haben. Der Witz dabei ist, daß sie sich in Gesellschaft einer körperlosen Stimme aus dem Jenseits eigentlich ganz wohl hätte fühlen müssen, da sie einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Jugend mit Tischerücken und Handlesen verbracht hatte. Aber ein Anrufbeantworter stellte sie vor unüberwindliche Hindernisse.
«Nicola?» Ihre Stimme zitterte wie Wackelpudding. «Muß ich jetzt sprechen, Tom?» Damit meinte sie meinen Dad, der rückblickend der einzig richtige Mann für mich gewesen wäre. «Nicola, hier ist Mummer. Ich meine, deine Mutter. Mum. Teresa Sharp.» Sie hielt zufrieden inne, nachdem sie diese weltbewegende Nachricht überbracht hatte.
Ich sah mich schuldbewußt im Zimmer um. Versuchte, mir das T-Shirt über die Oberschenkel zu zerren; keine Chance, schließlich war es kein Fesselballon. Vor kurzem war mir diese Sache mit meinen Oberschenkeln aufgefallen – sie gingen immer zehn Minuten nach mir schlafen. Als wäre ich im Internat und sie in einer höheren Klasse. Dann stürzte ich blindlings auf den Rummelplatz am Strand, wobei ich in der bizarren Parodie einer Konfettiparade mit Jointkippen und zusammengerollten Geldscheinen um mich warf.
Zusammengerollte Geldscheine besitzen große Bedeutung für mich; als ich meinen Dad das letzte Mal sah – es war bei unserer Hochzeit –, ließ ich versehentlich einen zusammengerollten Fünfer als Trinkgeld für die Kellnerin auf dem Tisch des Restaurants liegen. Mein Dad nahm ihn in die Hand, sah blinzelnd durch und verkündete: «‹Hab alles im Blick›, sagte Nelson, als er mit seinem blinden Auge durchs Fernrohr schaute.»
Er, ich und Matt brüllten vor Lachen; die Kellnerin lächelte, als hätte sie Zahnschmerzen. Doch meine Mutter, die gute alte Mutter Teresa, warf mir einen Medusenblick zu. Vermutlich kannte sie diese Art, mit Geldscheinen umzugehen, aus The Bill. Als Teenager fragte sie mich mal, ob ich L.S. Speed nehme. Und das an einer Schule im West Country, in den Siebzigern, wo es keine Popgruppe außer den Wurzels gab! Was für ein Witz! Nach drei Junior-Aspirin kam ich mir vor wie ein Junkie! Aber meine Mutter führte ein strenges Regiment; daß sie sich regelmäßig mit einer Mischung aus Eierlikör und Limonade (die korrekte Bezeichnung für dieses Getränk lautet meines Wissens «Snowball») volldröhnte und meinen Vater und mich geradezu chronisch mit eigenen Versionen von The Boers Have Got My Daddy und My Canary’s Got Circles Under His Eyes erfreute, zählte anscheinend nicht.
«Es geht um Oma», sagte sie.
Ich erstarrte wie ein kokainbetäubter Zahn, was gar nicht so weit hergeholt war, da ich noch einen Hauch von dem Zeug aufgestöbert und in meinen Gaumen gerieben hatte. Das hatte ich von einem amerikanischen Popstar gelernt, als ich siebzehn war; es bringt zwar nichts, sieht aber wahnsinnig cool aus.
Meine Kehle zog sich zusammen, als wollte ein besonders schlauer Schwanz eine Irrigation oder Irritation oder wie auch immer bei mir vornehmen, und ich wußte, ich würde heulen und heulen und nie mehr damit aufhören. Das war der große Schlag. Meine Oma war gestorben.
Ich ging wie in Trance zum Anrufbeantworter und starrte auf die schwarze, elegante, gleichgültige Maschine. Meine Mutter leierte ihren Text herunter; sie wirkte recht gelassen.
«Jaaaa … es geht um Oma. Ist wirklich das Beste.» Herzlose Schlampe; eigentlich hatte ich sie nie wirklich gemocht. All die Muttertagskarten waren reine Geldverschwendung gewesen. Sie hatte sie gar nicht verdient. Auf der ersten, die ich je in der Schule für sie gebastelt hatte, stand: ALLES LIEBE ZUM MOTORTAG. Du lieber Himmel, ich war doch erst sechs! Sie warf einen Blick drauf, sagte: «Ich kann nicht Auto fahren.» und warf sie in den Mülleimer! «Aber ich dachte, du solltest es wissen. Am Sonntag ist es soweit …»
Wovon redete sie da? Euthanasie? Ich sah im Geiste den Daily-Mirror-Tierfreunde-Kalender meiner Mutter vor mir, auf dem der kommende Sonntag mit einem roten Kreis markiert war: 3UHR NACHMITTAGS (NACHEAST ENDERS):OMA UMBRINGEN. Ich riß das Telefon an mich.
«Hallo, hallo, Mum? Was soll das heißen?»
«Oh – Nicola.» Sie klang so lammfromm, man hätte einen Pulli aus ihr stricken können. «Ich dachte, du solltest es wissen …»
«Verdammt noch mal, natürlich sollte ich das! Sag mal, ist dir eigentlich klar, was du da vorhast? Du verstößt gegen jegliches moralische Gebot und Gesetz, das je existiert hat! Die zehn Gebote … das mosaische Gesetz … und überhaupt …»
«Was für ein Mosaik?» Die Mordhexe klang tatsächlich entrüstet. «Wir schicken sie doch nicht nach Afrika!»
«Mutter, es ist noch weiter weg als Afrika, nicht wahr?»
«Nein, ist es nicht. Liegt gleich hinter Chipping Sodbury.»
Allmählich dämmerte es mir. Kennen Sie den Ausdruck: «Aus ihr spricht der Alkohol?»In meinem Fall war es wohl der Koks, der zuhörte. Ich hatte einen etwas drastischen Schluß gezogen, um es vorsichtig auszudrücken. Dennoch, diese kleine Unterhaltung wirft ein bezeichnendes Licht auf meine Mutter. Sie ist eiskalt, wenn sie nicht gerade puren Alkohol getankt hat, und man weiß nie, wozu sie nach einigen Snowballs fähig ist, wenn eine Person – oder deren Inkontinenz – zwischen ihr und der neuen Dreizimmerwohnung steht.
«Was bitte liegt gleich hinter Chipping Sodbury?» fragte ich langsam.
«Das Heim», erwiderte sie frech wie Dreck.
«Das H –» es wollte mir einfach nicht über die Lippen kommen – «was soll das heißen? Sie hat doch ein Heim, verdammt noch mal!»
«Hat sie nicht.» Allmählich kam Madame richtig in Fahrt. «Sie hat eine Wohnung. Eine Wohnung, deren Eingangstür sie – und das würdest du wissen, falls du dich je hierherbemühen würdest – bis in den späten Abend unverschlossen läßt. Sie schließt erst ab, wenn sie schlafen geht – um elf Uhr! Und das in der übelsten Gegend von Bristol – wenn man von St. Paul’s absieht», fügte sie schnell hinzu. Dabei handelt es sich um das Negerviertel unserer schönen Stadt. Rassistische Kuh. «Als wäre sie noch immer in der Victory Street! Als würde sie noch immer ihre Nachbarn kennen, als gäbe es keine Banden von Straßenräubern, die einbrechen und einen wegen dem Schwarzen unter den Fingernägeln ermorden!» Oh ja, sie kam wirklich mächtig in Fahrt. «Das ist kein Heim Nicola, das ist eine Zeitbombe, die drauf wartet, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden.» Wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind Metaphern für meine Mutter nur dazu gut, wild durcheinandergemischt zu werden wie Bonbons bei Woolworth.
«Also, bitte korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber es geht im Grunde darum, daß ihr Oma wegschicken wollt.»
«Nicht weg, Nicola», wirft Mutter Teresa, von Nächstenliebe erfüllt, ein. Ich wußte, ich hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. «Nur woandershin.»
«Weg. Woandershin. Ihr stellt sie ab wie einen Müllsack. Es interessiert doch kein A -»
«Also, diese Ausdrücke!»
«Mutter, ich wollte nicht Arschloch, sondern Aas sagen! Außerdem ist es mir ohnehin scheißegal, wie du es nennst! Um Himmels willen, gute Frau –»
«Ohhh! Jetzt heißt es schon gute Frau?»
«– du redest immerhin von deinem eigenen Fleisch und Blut!»
«Dem deines Vaters, um genau zu sein!»
Nicht zu glauben – Dorothy Parker nach einem Schnellkurs Oscar Wilde. «Mir egal», fauchte ich. «Das ist unwesentlich. Du kannst sie einfach nicht in eines dieser Dinger stecken, das geht nicht. Sie würde … würde dahinvegetieren.»
Schon komisch, wie ähnlich klingende Begriffe in der modernen Welt auseinanderdriften. Sind die Ernährungswissenschaftler auf dem Kriegspfad, heißt es: «Eßt mehr Gemüse, werdet Vegetarier und dabei hundert Jahre alt!» Ist einer dann hundert geworden, und man will den schlimmsten Zustand beschreiben, in dem sich ein Vertreter dieses biblischen Alters befinden kann, sagte man: «Er vegetiert vor sich hin.» Es heißt ja auch immer: «Man ist, was man ißt.» Wäre doch ein toller Slogan für Gemüsehändler, was? WERDET VEGETARIER UND IHR WERDET VEGETIEREN!
Na ja, große Geister denken ähnlich, denn meine Mutter wird auf einmal ganz still und sagt in einem Ton, den sie wohl als trocken empfindet: «Nicola, deine Großmutter hat fünfundachtzig Jahre lang kein Gemüse angefaßt, solange es nicht zumindest fritiert war. Ganz bestimmt wird sie sich jetzt nicht mehr ändern. Sie hat einen eisernen Willen und eine stählerne Konfusion.» Sie hielt inne und fügte hinzu: «Ich meinte Konstitution. Kleiner Versprecher.»
Aber vielsagend. Wie ein Tritt gegen die Gehhilfe. Dennoch beschließe ich, ganz cool zu bleiben. «Schon okay, Mum», säusele ich mit geradezu meditativer Ruhe, ein schreiender Kontrast zu Teresas vegetativ-vegetarischer Erregung. «Ich bin nicht böse auf dich, ganz ehrlich; ich bin nur traurig. Es ist nicht deine Schuld, nur ein Symptom für das verrückte Leben, wie wir es heutzutage im Westen führen.»
Teresa dachte darüber nach. Als sie weitersprach, klang ihre Stimme weich und neugierig, beinahe liebevoll, wie die eines Kindes. «Meinst du unser Leben in Bristol?»
«Nein», zischte ich, «ich habe nicht vom Westen Englands gesprochen. Ich meinte Europa.» Ich ließ es mir durch den Kopf gehen. «Mit Ausnahme von Italien. Und Spanien, würde ich sagen. Vielleicht auch Portugal. Ich meinte wohl Nordeuropa und Nordamerika – und Australien.»
Sie wirkte nun auf ihre beschränkte Weise interessiert. «Neuseeland nicht?»
«Doch!» brüllte ich. «Dieses verdammte Neuseeland meinte ich natürlich auch! Tasmanien, was immer du willst. Gott im Himmel!» Ich riß mich rasch am Riemen. «Tut mir leid, Mum, ich bin ein wenig angespannt. Muß mich ein bißchen abreagieren.» Das schaffte ich mit einer Kurzfassung meiner Nackenmassage und meditativem Gesang. Ich würde mich nicht gerade als Buddhistin bezeichnen – war nie Anhängerin einer bestimmten Religion –, aber ich glaube definitiv an irgendeine Macht.
«Nicola?» In der Stimme meiner Mutter schwang Panik. Schön. «Was ist los? Wer macht diese Geräusche? Wer ist bei dir?»
«Der Dalai-Lama und Richard Gere – wer sonst?» Allmählich geriet alles außer Kontrolle. «Mutter, bitte verzeih mir. Ich wollte nur –»
«Du nennst mich nur Mutter, wenn du glaubst, ich hätte was falsch gemacht.»
«Du hast nichts falsch gemacht, Mum», beschwichtigte ich sie. «Nicht direkt. Es geht nur darum, wie wir uns im Westen heutzutage verhalten – nicht nur in Bristol. Wenn etwas nicht in unseren schönen, egoistischen Lebensplan paßt, schmeißen wir es einfach weg und hauen ab …»
«Ach so, du meinst wie damals, als du nach London abgehauen bist?»
Wozu braucht man eigentlich Mütter? «Nein, Mutter, das war keine selbstsüchtige Laune von mir. Es ging um Leben, Tod und geistige Gesundheit. Ich hatte einen Studienplatz an der St. Martin’s, falls du das vergessen haben solltest.»
«Wir haben hier auch eine Kunstschule», erwiderte sie todernst.
«Ja, für die armen Seelen, deren ganzer Ehrgeiz darin besteht, das Layout für die Bristol Evening Post zu entwerfen. Ist bestimmt der Hit. Ich persönlich würde lieber den Spiritus trinken, in dem ich meine Pinsel gereinigt habe, aber gut, jedem das Seine. Ist sowieso nicht wichtig.»
«Was ist denn dann wichtig? Hör mal, heute ist mein Essen-auf-Rädern-Tag. Meine alten Damen warten auf mich.»
Haben Sie das gehört? Diese egoistische, selbstsüchtige Kuh! «Meine» alten Damen, also wirklich – als wären das keine vollwertigen, unabhängigen Menschen! Ich seufzte laut, aber ohne Vorwurf, wie eine Heilige. «Mutter, wichtig ist, falls du zwischen deinen Orgien des Eigennutzes eine Minute für deine Tochter erübrigen kannst –»
«Was soll das heißen? Meine alten Damen haben doch den Nutzen. Ich esse da nichts von.»
«– es geht darum, wie ich bereits sagte, daß man in anderen Kulturen, die weniger materialistisch und neurotisch eingestellt sind als unsere, die alten, die älteren Menschen – ich meine die reiferen – zu schätzen weiß. Man lernt von ihnen.»
«Nein, ist nicht wahr», erwiderte meine Mutter glatt, «die werden zum Betteln auf die Straße geschickt.»
Ich lachte sie aus, was noch ganz harmlos klang angesichts dieser ungeheuerlichen Provokation. «Also wirklich, Mutter! Wo hast du denn dieses Juwel der Weisheit ausgegraben? In den National Front News?»
«Nein, das habe ich von Mrs. Noorani, einer meiner alten Damen. Reizende Frau – ist vor Jahren aus Pakistan hergekommen. Hat mir erzählt, daß sie jeden Tag auf die Knie fällt und irgendeinem Gott dafür dankt, daß sie herkommen durfte. Jedenfalls fiel sie früher auf die Knie – bis die Arthritis so schlimm wurde. Sie hat Hände», die Stimme meiner Mutter klang genießerischer als beim Verkosten eines Essens auf Rädern, «wie Klauen. Wie Klauen, sag ich dir.»
Sechs Minuten hatte sie immerhin gebraucht, doch nun hatte meine Mutter sich warm geredet und war bereit für die große Show. Meine Damen und Herren, hören Sie wie jeden Abend Teresa Sharp zu den Themen Krankheit, Gebrechlichkeit und – zum großen Finale – TOD! Wie die meisten Arbeiterklassefrauen zwischen neunzehn und einundneunzig geht Mrs. Sharp ganz in ihrem Thema auf, und sie hat wirklich ihre Hausarbeiten gemacht.