

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Impressum der zugrundeliegenden gedruckten Ausgabe:
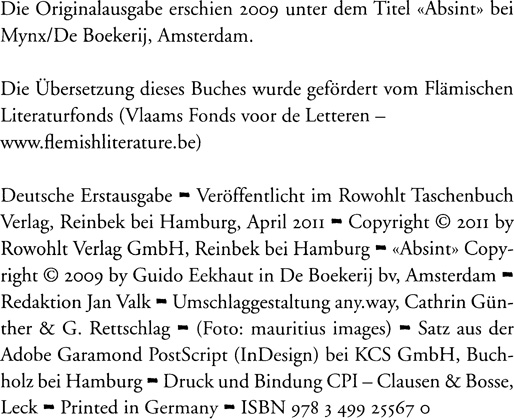
ISBN Printausgabe 978-3-499-25567-0
ISBN E-Book 978-3-688-11595-2
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-688-11595-2
Dies ist eine fiktive Geschichte. Jede Ähnlichkeit mit wahren Personen, Institutionen und Situationen beruht auf Zufall. Die Äußerungen der Romanfiguren spiegeln nicht unbedingt die Meinung des Autors wider.
Parnow sprach kein Niederländisch. Das war auch nicht nötig. Er brauchte diese bizarre Sprache voller Kehllaute nicht. Auch sein Englisch war dürftig und beschränkte sich auf wenige Standardsätze und Floskeln, aber für seine Zwecke reichte es allemal. Denn meistens redete er sowieso nicht viel. Die Pistole mit dem großen schwarzen Schalldämpfer sprach ihre eigene, klare Sprache. Warum sollte er sich die Mühe machen, irgendein abseitiges Landesidiom zu erlernen, wenn es universelle Gesten und Zeichen gab, die jeder verstand? Fremdsprachen, Dolmetscher, dieser ganze Kram – völlig überflüssig. Alles, was man brauchte, waren universelle Zeichen. Missverständnisse: ausgeschlossen.
Eine Pistole an der Schläfe zum Beispiel. Die sagte mehr als tausend Worte über die Absichten dessen, der die Pistole in der Hand hielt. Sie bedeutete, dass man sich tunlichst kooperativ verhalten sollte. Vor allem, wenn auf dem Lauf der Pistole ein Schalldämpfer steckte. Überall auf der Welt sahen die Leute fern und gingen ins Kino, daher wussten sie, wozu ein Schalldämpfer diente. Das Ding sagte ihnen: Jetzt wirst du gleich kaltgemacht, und niemand wird es hören. Kein Mensch merkt etwas.
Der junge Mann, auf den die Waffe gerichtet war, wusste offenbar über Pistolen, Schalldämpfer und universelle Zeichen bestens Bescheid. Seine Gesichtszüge waren verkrampft, seine Hände zitterten. Es waren seine letzten Minuten. Parnow befürchtete nur eines: dass der Typ sich in die Hosen pisste. Das taten die Leute oft, wenn sie dem Tod ins Auge blickten. Es ärgerte ihn furchtbar. Weil er derjenige war, der anschließend mit dem Gestank eines anderen leben musste, während der bereits tot war.
Dieser junge Mann pisste sich nicht in die Hose. Aber es hätte nicht viel gefehlt. Das universelle Zeichen war unmissverständlich, die Botschaft angekommen. Gleich würde sein Leben ein Ende nehmen. Doch vielleicht konnte er das Ende noch abwenden, wenn er Antworten gab. Wenn er die richtigen Antworten gab, nämlich die, die Parnow hören wollte. Das war es, was die Pistole ihm sagte. «Van Boer?», fragte Parnow. «Where is van Boer?»
Die Adresse stimmte. Jemand hatte ihm einen Zettel mit einem Namen, einer Adresse und einer groben Wegbeschreibung gegeben. Alles stimmte, außer dass dieser junge Mann nicht van Boer war. Erstens war dieser junge Mann ein Schwarzer. Na schön, nicht richtig schwarz, aber Surinamer oder so was in der Art, vielleicht auch Marokkaner, obwohl Parnow da kaum einen Unterschied sah.
Es spielte auch keine Rolle. Jedenfalls war er nicht weiß. Das Foto, das Parnow von van Boer gesehen hatte, war nicht sehr scharf gewesen, aber dieser Typ hier war definitiv nicht van Boer. Der Mistkerl hatte also eine falsche Adresse angegeben. Deswegen war Parnow umsonst quer durch Amsterdam gelaufen, auf dem Weg zu einer falschen Adresse. Das fand er gar nicht komisch. Im Gegenteil, es machte ihn stinkwütend. Denn Amsterdam war nicht die Art Stadt, in der er gern spazieren ging. Zu viele dreiste junge Affen und zu viele dicke Touristen. Seine Laune war also nicht die allerbeste. Deswegen presste er dem jungen Schwarzen die Mündung der Pistole fester als nötig gegen den Kopf. Der Abdruck würde wochenlang an seiner Schläfe zu sehen sein. Aber auch das spielte keine Rolle, denn der Kerl hatte sowieso nicht mehr lange zu leben.
«Der wohnt hier nicht», sagte der junge Mann auf Englisch, gepresst, denn wie soll man frei reden, wenn man eine Pistole gegen die Schläfe gedrückt bekommt? Mit einem Schalldämpfer darauf? Sein Lebensende vor Augen?
«Wo?» Parnow hasste solche Gespräche. Dem Jungen musste die Situation doch klar sein? Er, Parnow, war auf der Suche nach van Boer. Deswegen brauchte er dessen Adresse. Warum gab der Kerl sie ihm nicht gleich? Das konnte doch nicht so schwer sein: Van Boer wohnt in dieser oder jener Straße. Ganz einfach. Und doch …
«In der Leidsestraat, Nummer vierundachtzig, erster Stock», keuchte der junge Mann.
Parnow brummte. Er ließ den Kerl los. Der stürzte taumelnd zu Boden. «Papier», befahl Parnow. «Schreib auf.» Das Gestammel des Schwarzen half ihm nicht weiter. Er kannte sich in Amsterdam nicht aus und hatte keine Ahnung, welche Straße der Typ meinte.
Der junge Mann rappelte sich auf, nach vorn gebeugt, die Augen abgewendet, griff nach einem Blatt Papier und einem Bleistift und schrieb. Parnow riss ihm den Zettel aus den Händen. «Liedsestraat», sagte er.
«Leidsestraat», korrigierte der junge Mann. Als sei seine Aussprache so viel besser. Angeber. Scheißangeber. «Ist nicht weit von hier.»
«Ach», sagte Parnow. Auch noch den Fremdenführer spielen. Ihm erzählen, was er zu tun hatte. Nicht weit von hier. Er hob die Pistole und schoss dem jungen Mann zwischen die Augen. Teile seines Hinterkopfs spritzten gegen die Wand. Parnow ging rückwärts zur Tür und verließ die kleine Wohnung. Chaos, Gestank nach Heroin, Gestank nach Schweiß und jetzt auch noch der Gestank des Todes. Amsterdam. Korrupte, dekadente Weltstadt. Voll mit Schwarzen und Leuten, die nicht imstande waren, einem ordentlichen Job nachzugehen.
Er schraubte den heißen Schalldämpfer von der Pistole und verstaute seine Ausrüstung in dem kleinen schwarzen Rucksack, den er bei sich trug. Kurz darauf befand er sich auf dem Weg in die Leidsestraat. Niemand beachtete ihn. Den schwarzen Jungen hatte er aus dem Bett geholt. Besser gesagt: aus dem Bett gezerrt, nachdem er die Wohnungstür eingetreten hatte. Es war eine Kleinigkeit gewesen, aber trotzdem frustrierend. Die falsche Adresse. Sie hatten ihm die falsche Adresse gegeben. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war jetzt 8.30 Uhr. Vielleicht würde er den echten van Boer auch im Bett antreffen. Das wäre doch mal lustig.
«Und was willst du jetzt damit anfangen?»
Eileen Caster lag auf dem zerwühlten Bett, bekleidet mit nichts als einem Slip. Es war ein rosa Slip, schon ziemlich verwaschen. Unter anderen Umständen hätte Pieter eine Bemerkung darüber gemacht, dass sie noch immer nicht anständig angezogen war, obwohl es schon auf neun Uhr zuging. Ihr war das egal. Was machte es schon aus, dass sie jetzt noch im Bett lag? Sie hatte andere Sorgen. Zum Beispiel den wahnsinnigen Plan, den Pieter sich ausgedacht hatte.
Ein Plan, der ihrer Meinung nach unter keinen Umständen funktionieren konnte. Den er allerdings um jeden Preis verfolgen würde, jetzt, wo sich die berüchtigte Liste in seinem Besitz befand. Die Mitgliederliste der Partij Dierbaar Nederland. Mit den Namen aller, die der Partei van Tillos Geld gespendet hatten, einschließlich der jeweiligen Beträge. Jeder hoffnungsvolle Firmenchef im ganzen Land, der mit der Rechtspartei van Tillos sympathisierte. Die Liste, die Pieter letzte Nacht aus dem nachlässig bewachten Büro der Parteizentrale gestohlen hatte. Politisch sei das Dynamit, hatte er gesagt. Politisch würden die Niederlande kopfstehen, wenn die Liste veröffentlicht würde. Es standen viele berühmte Leute darauf, die sich niemals öffentlich zu der Partei bekennen würden.
Pieter wirkte jedoch nicht besonders erfreut. Vielmehr sah er besorgt aus, als habe er durch seinen Diebstahl eine schwere Last auf sich geladen. Zweifellos war dem auch so. Und damit hatte er nicht gerechnet.
«Wenn sie dich erwischen, gehst du in den Knast, Pieter.» Das sagte sie nicht zum ersten Mal, aber er zeigte sich nach wie vor unbeeindruckt. Er war dickköpfig. Und er war überzeugt davon, dass ihm die Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, die Freiheit eröffnete, alles zu tun, wozu er Lust hatte. Und vielleicht glaubte er sogar, dass seine Überzeugungen ihn unverwundbar machten.
«Irgendjemand musste es tun», sagte er. «Wir müssen der Öffentlichkeit zeigen, wie die PDN Politik macht. Woher ihr Vermögen stammt. Von welchen Leuten sie finanziert wird. Das ist wichtig.»
Eileen drehte sich langsam im warmen Bett um. Zu Anfang ihrer Beziehung hatte sie seine Leidenschaftlichkeit bewundert. Inzwischen wusste sie, dass es sich nur um eine Form von Dickköpfigkeit handelte, mit der er entgegen jeder Vernunft seine Ideale verfolgte.
«Und du bist derjenige, der das Risiko dafür auf sich nimmt? Wofür gibt es die Polizei und die Presse? Warum können die das nicht übernehmen?»
Er zuckte mit den Schultern. Diese Geste beobachtete sie in letzter Zeit immer häufiger. Es war kein Ausdruck der Gleichgültigkeit, sondern ein Zeichen, dass er offenbar keine Lust mehr hatte, ihr seine Beweggründe zu erläutern.
Jetzt hatte er diese Liste. Und was wollte er damit? Schon seit gestern Abend grübelte er unentwegt darüber nach.
Sie stand auf und stellte sich ans Fenster. Unter ihr rollte ein Fahrradtaxi vorbei, ein zusammengebastelter Drahtesel, den sogar die Touristen keines Blickes würdigten. Sie hatte Lust auf eine Zigarette, aber Pieter wollte nicht, dass sie in der Wohnung rauchte. Natürlich machte sie sich nichts daraus. Sie hatte gelernt, ihren Willen durchzusetzen, sogar Pieter gegenüber. Später würde sie in die Uni gehen, aber vorher wollte sie sich ein wenig frischmachen. Und eine Kleinigkeit essen.
«Darüber muss ich erst nochmal gründlich nachdenken, Eileen. Aber hausieren gehen werde ich mit der Liste nicht. Und zieh dir mal was an. Die ganze Nachbarschaft kann dich sehen.»
«So ein Quatsch», zischte sie. «Wir sind hier in Amsterdam. Nicht in dem Kaff, aus dem du kommst. Die Leute kriegen hier am Tag mehr Titten zu Gesicht, als du in deinem ganzen Leben sehen wirst. Werd endlich erwachsen. Du bist dreißig Jahre alt. Was willst du denn jetzt mit dieser Liste anfangen?»
Warum war sie nur so sauer auf ihn? Sie kam selbst aus einem kleinen Kaff. Er stammte wenigstens aus einer modernen Provinzstadt.
Er versuchte, seine wirren Haare zu bändigen. Letzte Nacht hatte er nicht gut geschlafen. Er hatte gegrübelt, hatte Pläne geschmiedet, er schmiedete schon seit vierundzwanzig Stunden Pläne, aber einen Ausweg sah er immer noch nicht. «Wir können das ruhig angehen, Eileen. Die vermissen die Liste nicht einmal. Da herrscht immer ein ziemliches Chaos. Morgen setze ich mich mit jemandem von der Presse in Verbindung. Aber das Ganze muss gut überlegt sein. Ich brauche einen integeren Journalisten. Von einer großen Zeitung. Keinen von den Schmierblättern, die selbst diesen rechten Mist verbreiten.»
Pieter machte sie rasend. «Warum unternimmst du nicht sofort was? Heute noch. Oder geh zur Polizei. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.»
«Nichts, was auf dieser Liste steht, ist illegal», gab er salbungsvoll zurück. «Die haben nichts Ungesetzliches getan. Die Polizei kann also nichts unternehmen. Aber die Presse. Die Öffentlichkeit reagiert empfindlich auf solche Enthüllungen. Geld und Politik, da sind die Leute sensibel. Wenn die Liste von der richtigen Zeitung veröffentlicht wird, kann sie sehr viel Schaden anrichten. Aber ich möchte nichts überstürzen. Schon gar nicht mit diesem Material. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Ist das so schwer zu verstehen?»
«Du beschäftigst dich jetzt schon ein Jahr lang damit. Warum hast du dir das nicht eher überlegt? Mein Gott, Pieter, du bist unmöglich, weißt du das? Du bist der am schlechtesten organisierte Verschwörer, den ich kenne.» Sie kannte überhaupt keine Verschwörer, aber das war in dem Moment egal. Er war einfach schlecht organisiert.
«Lass mich in Ruhe, ich weiß schon, was ich tue.»
Sie zuckte mit den Achseln. Pieter war ein Träumer. Solche Leute waren gefährlich. Tausend Ideale im Kopf, aber keinerlei Sinn fürs Pragmatische, überhaupt nicht zielstrebig. Und genau so war Pieter. Vor einem Jahr war es ihm gelungen, unter einem falschen Namen und mit falschen Papieren die Partei «Dierbaar Nederland» zu infiltrieren. Er hatte die ganze Zeit für sie gearbeitet, ohne dass jemand etwas bemerkte. Rechte Nationalisten der schlimmsten Sorte, so nannte er sie, vor allem, weil sie so respektabel wirkten. Eine Partei für die Mittelklasse. Eine Partei für diejenigen, die sich eine lebenswerte Heimat wünschten. Nicht offen rassistisch, nicht offen faschistisch. Dennoch appellierten sie an die borniertesten Vorurteile der Menschen, aber immer unter dem Deckmantel hehrer Ziele. Das Übliche: Die Niederlande den Niederländern. Den weißen Niederländern. Und es funktionierte. Sie hatten gleich bei den ersten Wahlen nach ihrer Gründung ein paar Sitze in der ersten und zweiten Kammer errungen und zwischenzeitlich sogar zwei Ministerposten besetzt. Aber jetzt waren sie wieder raus aus der Regierung und in der Opposition.
«Solche Organisationen finanzieren sich nicht nur durch die Spenden gewöhnlicher Mitglieder», sagte Pieter. Das war Konsens unter den Linken. Das konnte man in den Zeitungen nachlesen, für die Pieter selbst manchmal schrieb, in den kleinen linken Gazetten. «Damit würden sie nicht weit kommen. Sehr viel Geld fließt aus den Unternehmen. Aus den mittelständischen Unternehmen. Dieser aufgeblasenen, populistischen Unternehmenselite.»
Pieter hatte sich vorgenommen, genau das zu beweisen.
Und jetzt hielt er die Beweisstücke in der Hand. Doch was sollte er nun damit anfangen? Er hatte einen großen Coup gelandet, wusste aber nicht, wie er nun sinnvollerweise vorgehen sollte.
«Wie auch immer», sagte Eileen, den schlanken Rücken der Straße zugekehrt, «ich hoffe, dass du das hier nicht allzu lange rumliegen lässt. Ich fühle mich nicht gut dabei. Nicht sicher.» Sie sah sich um, auf der Suche nach einem Pullover. Draußen war es frisch.
«Die werden uns schon keinen Schlägertrupp auf den Hals hetzen», meine Pieter. «Die wissen nicht mal, wer ich bin. Dafür habe ich schon gesorgt.»
«Wenn ich diese Typen sehe, kriege ich eine Gänsehaut.»
«Die beschützen die Niederlande, Schätzchen. Gegen den ganzen Dreck der großen, bösen restlichen Welt. Und ziemlich viele Leute sind bereit, ihnen das zu glauben. Ihre eigene Freiheit geben sie dafür gerne auf.»
«Dein Schätzchen braucht diese Art von Schutz nicht. Hast du dir diese Hendrika van Tillo mal genauer angesehen?»
«Ich hatte fast jeden Tag die Gelegenheit.»
«Von diesem Weib will ich keinen Schutz.»
«Ich auch nicht. Aber genug andere. Die Leute haben Angst.»
«Ja, das haben sie. Und van Tillo weiß sie zu schüren. Der böse Islam! Überall Terroristen! Das Ende des Abendlandes! Darin ist sie verdammt gut.»
«Meine Rede, Schätzchen. Deswegen mache ich das hier.»
«Ach so», sagte sie, plötzlich scherzhaft, «und zur Belohnung verlangst du von deinem Schätzchen, dass es noch mal schnell einkaufen geht, damit du deinen Tee mit Milch trinken kannst. Möchte Monsieur vielleicht auch noch ein Baguette und etwas Boursin dazu? Buttermilch, Croissants, frischgepressten Orangensaft? Möchte Monsieur vielleicht ein großes Frühstück ans Bett?»
«Mmmja», sagte Pieter. Es klang, als erwarte er durchaus noch mehr als nur ein Frühstück. Nicht dass er sich beschweren konnte. Eileen schenkte ihm mehr als genug Aufmerksamkeit. Meist war er derjenige, der sie vernachlässigte.
Sie zog sich ein T-Shirt über den mageren Oberkörper und betrachtete sich im hohen Spiegel. Sie war wirklich zu dünn. Aber gerade darauf standen viele Männer. Männer wie Pieter. Pieter war jetzt dreißig, fast zehn Jahre älter als sie. Dabei aber noch ziemlich jungenhaft, genau das, worauf sie stand. Obwohl man ihm durchaus Spuren seines Alters ansah. Die ersten Fältchen, sogar erste graue Haare.
Und er besaß diese Art selbstverständlicher Erfahrung, die sie so unwiderstehlich fand. Seine unglaublich chaotische Art, mit dem Leben umzugehen. Sein brillanter, aber oft zu unkonzentrierter Geist, der ihn komplexe Projekte oft nur mit Mühe beenden ließ.
Doch was er wohl an ihr fand? Sie wusste es nicht. Es gab so manches, was er ihr nicht erzählte. Er liebte sie, da war sie sich sicher, aber auf welche Weise? Sie wusste so wenig über sein bisheriges Leben. Er sprach nie über seine früheren Beziehungen. Nie über seine Vergangenheit. Er blickte nur in die Zukunft. Ein Leben mit ihr, das hatte er ihr versprochen. Und das genügte ihr. Zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens genügte es ihr. Warum also sollte sie heikle Fragen stellen?
Sie sah auf ihre billige Swatch. Kurz vor neun. Gleich fing ihr Seminar an, aber das war egal. In letzter Zeit ließ sie öfter Veranstaltungen ausfallen. Anthropologie. Wer ging schon gern zu Anthropologie?
Sie jedenfalls nicht.
Um das Studium kam sie dennoch nicht herum. Ihre Eltern unterstützten sie unter der Voraussetzung, dass sie ihren Abschluss machte. Mit dem Geld, das Pieter verdiente, hätten er und Eileen die Wohnung kaum bezahlen können. Natürlich wussten ihre Eltern nicht, dass sie mit ihm zusammenlebte. Sie glaubten, dass ihre Tochter ein Zimmer im Studentenwohnheim hatte und die ganze Zeit brav über ihren Büchern brütete.
Doch jetzt hatte Pieter keine Arbeit mehr. Er hatte Mist gebaut. Eine Liste aus dem Büro der Politikerin gestohlen, für die er arbeitete. Dümmer ging es nicht. Natürlich konnte er damit auch Geld verdienen, indem er sie zum Beispiel an eine Zeitung verkaufte, aber das wollte er nicht. Er war ein Idealist. Irgendjemand musste die Wohnung finanzieren, aber wer? Pieter wohl kaum. Sollte sie sich nach einem Teilzeitjob umsehen?
Sie zuckte mit den Schultern, betrachtete ihren Hintern in dem knappen Baumwollhöschen im Spiegel und zog eine Jeans und einen Pullover über.
«Bin gleich wieder da, du verwöhntes Blag», sagte sie.
Pieter, der noch immer unter der Bettdecke lag, antwortete nicht.
Sie ging hinaus, in Leinenschuhen und ohne Socken. Es war ein bisschen kühl, aber trocken.
Den Mann, der im Hauseingang auf der anderen Straßenseite stand und ihre Wohnung beobachtete, sah sie nicht.
Er blickte ihr nach und schaute dann hinauf zu den Fenstern der Wohnung. Er hatte Eileen am Fenster stehen sehen, ohne T-Shirt. Dekadente Welt. Klapperdürre Mädchen, wie in Moskau oder Tschetschenien. Mädchen mit schlechten Angewohnheiten. Die nicht aßen, nur Drogen spritzten und schnieften. Er kannte diese Art von Mädchen. Er wusste, wo sie ihr Geld hernahmen. Pieter van Boer, dachte er. Ein Zuhälter.
Kein Mitleid also. Ein Zuhälter und ein Dieb. Er wusste, was diese Art von Typen verdiente. Und er genoss das Privileg, ihnen die verdiente Strafe zu verpassen. Dabei brauchte er sich nicht einmal auf Gott zu berufen. Er hatte einen Vertrag mit einer irdischen Macht. Das genügte.
Er blickte dem Mädchen noch einen Moment nach. Lange Beine und ein knackiger Arsch. Er konnte nicht wissen, wie lange sie wegbleiben würde, aber das war sowieso egal. Was er vorhatte, würde höchstens ein paar Minuten dauern.
Er überquerte die Straße und stieß die Tür des Gebäudes auf. Ihm war sofort aufgefallen, dass die Haustür nicht richtig ins Schloss fiel. Unvorsichtige Leute.
Er ging die Treppe hinauf. Vor der Tür von Pieter van Boers Wohnung wartete er einen Moment. Kein Name, keine Klingel. Leise klopfte er an.
«Ah!», hörte er eine gedämpfte Stimme von innen. «Mein Frühstück. Komm doch einfach rein, stell dich nicht so an.»
Parnow, der kein Niederländisch verstand, hörte am Ton der Stimme, dass der junge Mann sich der Gefahr nicht bewusst war. Er drückte gegen die Tür. Sie ließ sich mühelos öffnen. Er trat ein, die Pistole mit dem Schalldämpfer in der rechten Hand, den schwarzen Rucksack in der linken. Er ließ den Rucksack langsam aus der Hand gleiten und stellte ihn neben der Tür ab.
Niemand war zu sehen.
Pieter van Boer lag offenbar noch im Bett.
«Hast du Croissants mitgebracht?», fragte eine gedämpfte Stimme.
«Pieter van Boer?», fragte Parnow und betrat den Raum. Er gab sich keine Mühe, den Namen richtig auszusprechen. Schließlich war das kein Höflichkeitsbesuch.
Mit einem Ruck riss er die Decke weg und blickte in das verwirrte und erschrockene Gesicht Pieter van Boers. Das war er, der junge Mann auf dem Foto. Diesmal hatte Parnow das richtige Opfer erwischt.
«Wer sind Sie?», fragte Pieter.
«Where is the list?», fragte Parnow.
Die Augen des jungen Mannes wanderten ganz kurz, nur für eine Sekunde, zu einer Stelle links von ihm. Parnow folgte seinem Blick. Ein kleiner, wackliger Schreibtisch mit Briefen, Papieren, Bleistiften, einem Laptop und einer alten Schreibtischlampe.
Da also.
«Ich weiß nicht, was Sie meinen», behauptete Pieter.
Parnow hob die Pistole.
Pieter versuchte sich aufzurichten, die Arme schützend vor das Gesicht geschlagen.
Schon verrückt, dachte Parnow, dass alle denken, sie könnten ein Neun-Millimeter-Projektil mit bloßen Händen abwehren. Als wären sie Superman. Er kannte Superman aus dem Fernsehen. Der konnte Kugeln und sogar schwerere Munition abfangen. Mit den Händen, mit der Brust. So ein Blödsinn. Typisch amerikanischer Schwachsinn.
Pieter van Boer konnte das nicht. Garantiert nicht.
Parnow drückte zweimal ab.
Die Waffe gab eine Art dumpfes Keuchen von sich. Van Boer fiel zuckend hintenüber. Hinter ihm auf der Wand erschien ein Fächer von roten Spritzern.
Parnow ließ die Waffe sinken. Er ging auf den Schreibtisch zu. Schob Briefe und Bleistifte beiseite. Eine Mappe. Eine Liste mit Namen und Beträgen, wie sie ihm beschrieben worden war. Er rollte die Mappe zusammen und steckte sie in seine Jackentasche.
Dann fiel sein Blick auf den Laptop. Vielleicht sollte er den auch mitnehmen. Vielleicht wären seine Auftraggeber an den Informationen interessiert, die darin steckten.
Ein unterdrückter Schrei ertönte hinter ihm. Er drehte sich um. Das Mädchen stand halb im Zimmer. Die Tüte vom Bäcker war ihr aus der Hand gefallen. Schockstarr hielt sie sich die Hände auf den Mund gepresst.
Parnow ging auf sie zu. Zwei Schritte. Die Wohnung war nicht groß. Er hob die Waffe, richtete den Lauf auf sie.
Sie sah ihn an. Sie wich nicht zurück. Sie geriet nicht in Panik. Er musste zugeben, dass er das nicht erwartet hatte. Ein tapferes, mageres, erschrockenes Mädchen, das seine Lage sofort richtig einschätzte. Er hatte solche Mädchen in Russland gesehen, in der Ukraine. Er hatte sie in Moskau gesehen, wenn er mit Dealern abrechnete. Er hatte sie unter den verschiedensten Umständen gesehen. Meist war das die Sorte Mädchen, die ein klein wenig länger am Leben blieben als die anderen.
Doch dann tat die Kleine etwas, womit er ganz und gar nicht gerechnet hatte. Sie trat ihm zwischen die Beine. Mit voller Wucht.
Er klappte vornüber.
Sie verpasste ihm mit ihrer harten, geschlossenen Faust einen Hieb auf die Wange.
Es tat weh, und dazu kam die Scham, weil er sich so behandeln ließ. Er wurde alt und träge. Er wurde nicht mal mehr mit einem jungen Mädchen fertig.
Sie griff nach ihm, und er verpasste ihr einen Rippenstoß. Seine Jacke ging auf, und die Mappe mit der Liste fiel heraus.
Sie trat ihm noch einmal in den Schritt, griff nach der Mappe und stolperte aus der Wohnung heraus.
Bevor er sich erholt hatte und sich wieder aufrichten konnte, war sie verschwunden. Schlimmer noch: Sie war verschwunden und hatte die Liste mitgenommen.
Er humpelte zum Fenster. Lehnte sich hinaus und sah, wie sie davonrannte. Er hinkte die Treppe hinunter. Steckte die Pistole in den Rucksack. Unten hielt er nach ihr Ausschau und lief in die Richtung, in die er sie hatte verschwinden sehen, konnte sie aber nirgendwo mehr entdecken. Er blieb stehen. Sie kannte die Stadt, er nicht. Es war also sinnlos. Er würde sie nicht mehr wiederfinden. Jedenfalls nicht heute.
Parnow trat gegen eine Wand. Er hatte Lust, seine Wut noch weiter abzureagieren, aber das wäre zu sehr aufgefallen. Also zog er den Reißverschluss des Rucksacks zu, schwang ihn auf den Rücken und ging auf demselben Weg zurück, den er gekommen war.
«Er ist ein wirklich schwieriger Mensch, der immer seine Meinung durchsetzen will und selten auf das hört, was die anderen Teammitglieder zu sagen haben. Genauso wenig hört er auf Befehle und Vorschriften seiner Vorgesetzten. Er nimmt sie nicht einmal ernst, und das führt oft zu Konflikten. Seine Methoden sind unkonventionell und manchmal am Rande der Legalität. Von seinen Ansichten über Frauen will ich gar nicht erst anfangen.»
So hatte sich Polizeipräsidentin Teunis vor einigen Wochen über Hoofdinspecteur Walter Eekhaut geäußert. Jedenfalls musste das der Tenor ihrer Worte gewesen sein, aber außer ihr und dem Mann, der ihr gegenüber am Schreibtisch saß, gab es keine Zeugen, die hätten wiederholen können, was genau sie gesagt hatte.
«Ich habe den Eindruck», sagte der Mann, «dass Sie Eekhaut am liebsten loswerden würden.»
«Habe ich mich in dieser Hinsicht etwa nicht präzise genug ausgedrückt?», fragte Teunis.
Der Mann grinste. Er hatte einen Namen, aber der spielte keine Rolle, weil er für das Außenministerium arbeitete. Und zwar in einer der oberen Etagen, was bedeutete, dass er Befehlsgewalt über einen Hoofdcommissaris der Federale Politie von Brüssel hatte. «In mancher Hinsicht scheint er also genau der richtige Mann für den Auftrag zu sein, den wir uns vorstellen.»
«Bisher haben Sie sich über diesen Auftrag noch nicht sehr deutlich geäußert», erwiderte Teunis.
«Es handelt sich um eine heikle Sache. So heikel und zugleich so – wie soll ich es ausdrücken – nebensächlich, dass wir sie niemandem aus unseren Kreisen anvertrauen können.»
«Ich verstehe.»
«Es geht um den wachsenden Einfluss russischer Finanziers auf unseren Bankensektor, wobei ich mit ‹unseren› natürlich nicht die wenigen kleinen Banken meine, die hierzulande noch ansässig sind, sondern die Schwergewichte auf dem Beneluxmarkt, insbesondere die Fabna-Bank.»
«Aha», sagte Teunis, während sie ihren Kugelschreiber über die Schreibtischplatte schob.
«Ganz recht. Die Kollegen vom niederländischen Staatsschutz sind darauf aufmerksam geworden. Diese Art der Intervention ist natürlich nicht neu. Die Araber und die Japaner besitzen große Anteile an westeuropäischen und amerikanischen Unternehmen. Doch dabei geht es um legale Finanzierungen. Sauberes Geld, wenn Sie so wollen. Was die Russen angeht, haben wir so unsere Zweifel. Starke Zweifel. Bis dato war es noch kein so ernstes Problem, aber kürzlich haben wir erfahren, dass ein einziger Großfinanzier fünf Prozent der Fabna-Bank in seinen Besitz bringen will. Er kommt demnächst nach Amsterdam. Der Nachrichtendienst will ihn während der ganzen Abwicklung beobachten. Sie haben uns um Amtshilfe gebeten, weil es um ein niederländischbelgisches Unternehmen geht. Alles streng nach Vorschrift, Sie verstehen.»
«Sie brauchen also einen Spezialisten. Eekhaut hat keine Ahnung vom Bankgeschäft.»
«Das ist mir durchaus bewusst. Aber er hat einen guten Ruf als Ermittler. Und das, obwohl er einen unmöglichen Charakter hat und nicht mit seinen Vorgesetzten auskommt. Darüber hinaus – und was das angeht, muss ich mich auf Ihre absolute Diskretion verlassen – sind wir an dieser Affäre nicht wirklich interessiert. Die Hochfinanz reagiert schnell hysterisch, wenn die Russen mit Geld um sich werfen, aber der Minister hat andere Sorgen.»
«Welcher Minister? Wer ist in diesem Fall zuständig?»
«Das ist ja gerade das Problem. Alle Minister, die einen Teil des Falls bearbeiten, schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Daher hat mein Minister beschlossen, den Fall symbolisch bearbeiten zu lassen …»
«Von einem renitenten Ermittler …»
«Ganz genau. Von jemandem, der uns nicht schaden kann und den wir nicht besonders vermissen würden, wenn ihm die Sache das Genick bricht.»
«Verstehe», sagte Teunis, «Sie tun mir einen großen Gefallen.»
«Das habe ich bereits vermutet.»
An einem Septembermorgen saß Hoofdinspecteur Eekhaut im Zug von Brüssel nach Amsterdam, im Besitz einer Fahrkarte für die zweite Klasse. Er schaute zum Fenster hinaus, obwohl er ein Buch auf dem kleinen Tisch vor sich liegen hatte. Zum Lesen war er nicht gekommen. Gerade war der Zug durch Rosendaal gefahren, und die Landschaft wurde noch flacher und nasser als zuvor. Der Himmel war zwischendurch kurz aufgeklart, aber ansonsten regnete es nun schon seit drei Tagen ununterbrochen, die Grachten und Kanäle waren bis oben hin gefüllt. Die Niederlande. Mühsam dem Wasser abgerungen. Aber wie lange noch? Wenn sich das Klima tatsächlich erwärmte und der Meeresspiegel allmählich anstieg, würde das ganze Land in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.
Dann müssen die ihre Deiche eben noch höher bauen, dachte Eekhaut. Darin sind sie gut, die Niederländer: im Deichebauen. Wenn die so weitermachen, sitzen sie bald in einer Art Schüssel.
Er blickte hinauf zu den tiefhängenden Wolken. Es würde noch mehr Regen geben.
Seine schlechte Laune von heute Morgen wurde dadurch nicht gerade besser. Um sieben Uhr war er in Löwen in den Zug gestiegen. Nach alter Gewohnheit war er zu früh dran gewesen und hatte im Bahnhofsrestaurant noch eine Tasse Kaffee getrunken, zusammen mit einer Gruppe gestrandeter Reisender: ein alter Mann mit einem neuen Koffer bei seiner zweiten Tasse Filterkaffee, einige rauchende Arbeiter, zwei hässliche Frauen auf dem Weg zur Arbeit nach Brüssel, eine hübsche Brünette, die ein Buch von Olivia Goldsmith las und dabei die erste Zigarette des Tages rauchte. In Mechelen stieg er in den Intercity um. Der hässlichste Bahnhof eines Landes, das sich durch besonders hässliche Bahnhöfe auszeichnete. Von dort aus auf direktem Weg nach Amsterdam. In der Ferne der Horizont, bleigrau. Sein Gepäck war bereits vorausgeschickt worden. Die Transportkosten hatte die Regierung übernommen, ebenso wie seine Zugfahrkarte und die Miete für seine neue Wohnung. Man war offensichtlich froh, ihn loszuwerden. Dafür hatte man Geld übrig.
Teunis hatte noch mehr über ihn zu erzählen gewusst. Das erstaunte Eekhaut nicht. Das Verhältnis zwischen der Polizeipräsidentin und ihm war niemals herzlich gewesen. Was zum Teil natürlich auch an ihm lag. Er hatte sich nie die geringste Mühe gegeben, sein Image aufzupolieren, und es widerstrebte ihm, den Gerüchten, die über ihn kursierten, zu widersprechen. «Sie haben Probleme mit weiblichen Vorgesetzten», hatte ihm die Psychologin vorgeworfen. «Nein», hatte er geantwortet, «ich kann mich grundsätzlich schlecht unterordnen, daher habe ich Probleme mit allen Vorgesetzten.» Danach war das Gespräch ins Stocken geraten.
Auch das stand immer wieder in seiner jährlichen Beurteilung.
Einige Leute waren gekommen, um sich von ihm zu verabschieden. Ältere Kollegen, mit denen er zusammengearbeitet hatte und die wussten, dass seine Methoden erfolgreich waren. Aber Teunis hatte ihnen klipp und klar erklärt: «Die Polizei kann auf Leute wie Hoofdinspecteur Eekhaut verzichten. Er ist ein Auslaufmodell, heutzutage gibt es keinen Bedarf mehr für seine Art der Improvisation. Schon seit zwanzig Jahren verlassen wir uns auf wissenschaftliche Methoden bei der Aufklärung von Verbrechen, aber das hat er immer noch nicht verstanden.» Und so weiter und so fort.
Er kannte das Credo. Er kannte es Wort für Wort. Es hatte sich in den letzten Jahren weder vom Ton noch vom Inhalt her grundlegend verändert.
Er hatte mit Teunis – deren Vorname vermutlich Isolde oder so ähnlich lautete – lang und breit über Ermittlungsmethoden diskutiert. Über die Grenzen der wissenschaftlichen Fahndung, auf die sie so große Stücke hielt. Er wich nicht von seinem Standpunkt ab. Sie auch nicht. Letztendlich hatte sie seine Versetzung veranlasst. Versetzung: Das klang immer wie eine Strafe, aus welcher Perspektive man es auch betrachtete, und das war es natürlich auch. Zur Abteilung für Internationale Verbrechensbekämpfung und extremistische Vereinigungen. In Amsterdam. Angeblich bekam er die Stelle, weil er ausgezeichnet Englisch und Französisch sprach. Weil kein einziger französischsprachiger Kollege des Korps zwei vernünftige Worte Niederländisch beziehungsweise Englisch beherrschte. Und natürlich weil das der abgelegenste Posten war, an den man ihn abschieben konnte. Sein erster Auftrag, so hatte Teunis ihm erklärt, sei sehr deutlich umrissen: Er solle den Niederländern bei ihren Ermittlungen gegen Adam Keretsky, einen russischen Finanzier, helfen. Den neuen wichtigen Anteilseigner der Fabna-Bank. Wobei er möglichst keine diplomatischen Verwicklungen auslösen solle.
Sie hatte ihn nicht einmal gefragt, ob er die Stelle freiwillig akzeptierte. Die Frage hielt sie wohl für völlig überflüssig.
Ganz bestimmt hieß sie Isolde, obwohl niemand, wirklich niemand, ihren Vornamen zu kennen schien. Eine Polizeipräsidentin hatte offenbar keinen Vornamen zu haben.
Ruhig glitt der Zug durch die grüne, beschauliche Landschaft. Der architektonische Wirrwarr Flanderns war den ein klein wenig zu ordentlichen Siedlungen der Niederlande gewichen, in denen Kleinfamilien in winzigen Vorgärten ihre kleine Freiheit zwischen obsessiv hochgezogenen Mauern auslebten. Drei ausländische Studenten unterschiedlicher Herkunft diskutierten lautstark auf Englisch, der Lingua franca der Intellektuellen, über die Bedeutung von intelligent design. Einer von ihnen hatte ein nagelneues MacBook auf dem Schoß.
Eekhaut besaß keinerlei Affinität zu den Niederlanden. Die Frage war, ob er sie zu Flandern hatte.
Was hatte die Teunis sonst noch gesagt? Über ihn? Wahrscheinlich dasselbe, was in den letzten Jahren immer in seiner Beurteilung gestanden hatte. Nicht zielstrebig genug. Erledigte administrative Aufgaben äußerst halbherzig. Mangelnde Kommunikation mit den Vorgesetzten. Zu wenig Respekt vor seinen Vorgesetzten.
Letzteres war ein schlechter Witz.
Er hatte überhaupt keinen Respekt vor der Art von Hierarchie, die Teunis repräsentierte. Nicht den geringsten.
Der Zug beschrieb eine flache Kurve und fuhr an einer kleinen Stadt vorbei, deren niedrige Mietshäuser bescheidenen Wohlstand und Ordnungssinn ausstrahlten. Ein ordentliches Land mit klaren Regeln für das Zusammenleben. Eekhaut wusste, dass Amsterdam anders sein würde. Er war ein paarmal dort gewesen, als Tourist. Eine anarchische Stadt. Eine sehr un-niederländische Stadt. Eine Stadt, die alle über zwanzig ziemlich unfreundlich behandelte, zugleich auf alle über Fünfzigjährigen höchst motivierend wirkte.
Nicht dass er sich für seine neue Aufgabe hätte motivieren können.
Sein Blick fiel auf das Buch vor ihm. Nabokov, Sieh doch die Harlekins! Das letzte Werk des Schriftstellers. Eine bittere Pseudobiographie. Eekhaut hatte das Gefühl, als bezöge sich der Titel auf ihn. Ein Harlekin. Einer, der dreißig Jahre lang eine Maske getragen hatte, die eines Polizisten, die eines Beamten, und der inzwischen nicht mehr in der Lage war, mit dieser Maske etwas Sinnvolles anzufangen. Er war Polizist geworden, weil er an Gerechtigkeit geglaubt hatte. Heutzutage rekrutierte man Ermittler wahllos aus der Menge jener jungen Akademiker, die nur an einer möglichst reibungslosen Beamtenlaufbahn interessiert waren. Beförderung garantiert.
Der Zug wurde langsamer. Eekhaut sah auf seine Armbanduhr. Kurz nach zehn. Er hatte drei Stunden lang im Zug gesessen. Besser als drei Stunden im Auto. Dennoch waren es sinnlose, vergeudete Stunden. Reisende standen auf, griffen nach ihren Taschen und anderem Gepäck. Die Studenten waren bereits unterwegs zum anderen Ende des Waggons. Eekhaut zog seine Tasche aus dem Gepäckfach und steckte das Buch ein. Er hoffte, dass seine Kleider, Bücher und anderen Besitztümer in der Wohnung abgeliefert worden waren, die er beziehen sollte. Er hatte keine Lust, einen weiteren Tag mit dem Warten auf die Transportfirma zu verplempern. Ansonsten hatte er nur das Allernötigste eingepackt, für ein, zwei Nächte.
Der Zug hielt an, die Türen öffneten sich. Alle stiegen aus. Die Luft roch anders als in Brüssel. Im Bahnhof herrschte Gedränge. Anscheinend mussten alle dringend einen Zug erwischen. Er lief durch eine Unterführung in Richtung Ausgang. Draußen schien die Sonne, aber es war angenehm kühl.
Eekhaut schwang den Riemen seiner Reisetasche über die Schulter, wühlte in der Tasche seines Jacketts und fand ein gefaltetes Blatt Papier. Mehrere Adressen: seine Wohnung, der Sitz der niederländischen Staatsschutzbehörde AIVD und ein Name. Dewaal. Sein Kontaktmann beim Staatsschutz. Am Abend zuvor hatte er sich einen Stadtplan angesehen, Straßenbahnlinien, einen kleinen Führer mit touristischen Informationen. Er hatte eine Wohnung in der Utrechtsestraat, in der Nähe des Frederikspleins, an der Strecke der Straßenbahn Nummer vier.
Er blickte sich um. Das Bahnhofsgebäude war von Gerüsten umgeben, und es wurde lautstark gearbeitet. Dann sah er die Straßenbahnhaltestelle.
«Sie ist weg», sagte Hendrika van Tillo, die Hände in die imposanten Hüften gestemmt und mit einem empörten Blick auf den etwas weniger imposanten Kees Verheul, ihren Sekretär. Der nebenbei bemerkt viel mehr war als nur ein Sekretär, vor allem auf organisatorischem und ideologischem Gebiet, wenn man der Presse Glauben schenken wollte. Die Presse – jedenfalls die Blätter, die van Tillo, ihrer Partei und ihrer politischen Position nicht besonders wohlgesinnt waren. Die kommunistische Presse, wie sie sie beschimpfte, ohne besonderes Gespür für historische Korrektheit. Aber auch der Klatschpresse, bei der sie sich wiederum lieb Kind zu machen versuchte, weil diese Art von Zeitschriften und Wochenblättchen ein breites Publikum von Lesern ansprach, von denen van Tillo einen nicht geringen Prozentsatz zu ihren schweigenden Sympathisanten zählte.
«Kees!», wiederholte sie. «Sie ist nicht mehr da. Die Liste ist weg. Was machen wir jetzt?»
«Ich drucke einfach eine neue aus», sagte Kees. «Geht ganz schnell. Ich habe alle Daten in meinem Computer.»
«Aber darum geht es doch gar nicht!» Van Tillo schob ihren großen, mit dunkelbraunem Leder bezogenen Bürostuhl beiseite. Sie hätte sich ein geräumigeres Büro gewünscht, aber in dem ganzen Gebäude war kein größeres Zimmer zu finden gewesen, abgesehen von den beiden Konferenzsälen im Erdgeschoss. «Es geht darum, dass die Liste gestern in dieser Schublade lag und dass sie jetzt weg ist. Das heißt, dass jemand die Liste mitgenommen hat. Und das kann nicht sein.»
«Nein», erwiderte Vanheul, «das kann eigentlich nicht sein.»
«Denn wenn diese Liste weg ist, Kees», fuhr van Tillo fort, «dann befindet sie sich jetzt in den Händen von jemandem, der sie missbrauchen könnte. Missbrauchen, du weißt schon, falschen Gebrauch davon machen.»
«Sie gegen uns gebrauchen.» Kees wusste, dass van Tillo ihn oft nur als Resonanzkörper benutzte. Also fungierte er als ihr Echo. Es fiel ihm leicht.
«Und damit den Leuten schaden, die mit Nachnamen, Vornamen und allen anderen relevanten Daten auf dieser Liste stehen. Verdammt, Kees, sogar die Beträge sind aufgeführt! Es ist eine Katastrophe, in jeder Hinsicht. Wie sollen wir uns da jemals rausreden?»
«Komm schon, Hendrika», beruhigte er sie, «so schlimm wird es schon nicht werden. Vielleicht ist alles nur ein Missverständnis. Ein dummes Missverständnis. Über das man sich gar nicht erst aufzuregen braucht. Die Liste liegt bestimmt einfach irgendwo anders. Du hast sie verlegt. Wer sollte sie mitgenommen haben? Hier kommt niemand rein. Schließt du deine Schubladen eigentlich nicht ab?»
«Warum sollte ich meine Schubladen abschließen? Das ist unser Gebäude. Kann ich den Leuten, die hier arbeiten, denn nicht mehr vertrauen? Gehört das Vertrauen in unsere niederländischen Landsleute nicht zu den Grundsätzen unserer Partei?» Immer wenn sie «Partei» sagte, klang es, als spreche sie in Großbuchstaben. «PARTEI». Das war durchaus beabsichtigt. Weil es die einzige richtige Partei war. Alle anderen waren nur Ansammlungen politischer Opportunisten.
«Ich glaube, dass wir allen, die hier arbeiten, vertrauen können, Hendrika. Aber in letzter Zeit sind so viele neue Leute hinzugekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir haben noch nie irgendjemanden überprüft.»
«Es sind alles Niederländer, Kees. Alles Niederländer.» Ja, dachte Kees, das stimmte. Weiße, einheimische Bürger dieses Landes. Dieselbe Heimat, dasselbe Blut. Reines Blut, holländisches Blut. Andere wurden in der Partei nicht aufgenommen.
«Die Liste ist garantiert nicht weg», versuchte er erneut, sie zu beruhigen.
Aber sie ließ sich nicht besänftigen. «Doch, das ist sie. Und wenn sie weg ist, stecken wir in Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, was los ist, wenn sie der Presse in die Hände fällt!»
«Auch das ist nicht schlimm. Wir hängen einfach jedem, der die Liste publiziert, einen Riesenprozess an den Hals. Diese Taktik haben wir doch schon öfter angewandt. Klappt jedes Mal.»
Van Tillo schüttelte hartnäckig den Kopf. «Dann ist es schon zu spät. Keiner unserer Spender wird darüber erfreut sein, dass sein Name bekannt wird. Du weißt, wie diskret wir die Unternehmen und Firmenchefs um Geldmittel angehen. Es ist ein heikles Thema. Wir könnten eine Menge Sponsoren verlieren, und das ist noch meine geringste Sorge.»
Das brauchte sie Kees kaum zu erzählen. Er war derjenige, der zu einem großen Teil das Fundraising übernommen hatte. Er war derjenige, der die Kontakte zu den Unternehmen unterhielt, vor allem mit jenen, die besonders bereitwillig für die Partei spendeten, im Gegenzug aber Diskretion verlangten.
Kees’ Arbeit war notwendig. Er bezeichnete sie gern als notwendiges Übel. Ohne Geld konnte man keine Politik machen. Bestimmte Parteimitglieder durchzusetzen, insbesondere Hendrika van Tillo, war eine teure Angelegenheit. Viele Leute konnte man überreden, etwas zu geben, wenn man ihnen dafür Vorteile in Aussicht stellte, für sie selbst oder für ihre Firmen. Für die Unternehmen war es in jedem Fall interessant, einen guten Draht zu einem aktiven Politiker zu haben, zum Beispiel, wenn es um Exportlizenzen ging. Oder wenn man wegen Steuerhinterziehung oder etwas zu giftigem Abfall unter Beschuss stand.
Kees wusste, dass politische Überzeugungen manchmal angesichts solcher handfesten Interessen in den Hintergrund treten mussten. Die Politik lebte nicht allein von Meinungen und Idealen. Auch die Rechnungen mussten bezahlt werden.
Politik war kostspielig, und dennoch mischten viele Amateure mit. Er selbst betrachtete sich nicht als Amateur. Schließlich war es ihm gelungen, Hendrika bis zur Justizministerin hochzuboxen. Das war zwar inzwischen schon einige Jahre her, unter einer anderen Regierung und bei einer anderen Partei. Anschließend hatte sie ihre alte Partei verlassen, ihre eigene Partei gegründet und Kees mitgenommen.
Dafür war er ihr dankbar. Er wusste jedoch, dass sie ohne seine Intuition und diplomatischen Fähigkeiten nicht weit kommen würde. Sie wusste das übrigens auch, ließ es sich aber selten anmerken.
Und jetzt die Sache mit dieser Liste.
«Bist du dir ganz sicher …», versuchte er es noch einmal.
Aber Hendrika war sich sicher. Zweifel waren ihr fremd. Die Liste war weg.
«Lass uns überprüfen, ob heute Nacht jemand hier gewesen ist, Kees. Wäre das möglich?»
«Nein, Hendrika, ich befürchte nicht. Das Einzige, was wir haben, sind die beiden Kameras. Ich werde persönlich nachsehen, ob sie etwas aufgezeichnet haben.»
«Wir haben hier Kameras?»
«Ja, aber niemand weiß davon. Tagsüber sind sie nicht eingeschaltet, nur nachts. Ich werde mir die Bänder ansehen.»
«Wer hat dafür die Erlaubnis erteilt, Kees? Für diese Kameras?»
«Ich habe selbst dafür gesorgt, dass sie installiert wurden, Hendrika.»
Sie grunzte und hakte nicht weiter nach. «Finde raus, was da los ist, Kees. Ich will, dass diese Liste wiederauftaucht.»
Vanheul ging den Flur entlang zu einem kleinen Büro auf der Rückseite des Gebäudes, in dem unter anderem die beiden Server standen, auf denen die Daten der Partei gespeichert waren. Ab und zu kam ein Mitarbeiter vorbei, der die Website auf den neuesten Stand brachte und neue Anwendungen installierte. Hendrika verstand nach eigener Aussage nichts von Computern und betrachtete jeden, der sich damit beschäftigte, als Freak – obwohl sie das niemals öffentlich ausgesprochen hätte. Sie hatte ihre Leute, die ihre Mails für sie ausdruckten und beantworteten. Die Mitarbeiter ihres Sekretariats recherchierten im Internet nach Kommentaren über sie und die Aktivitäten der Partei. Persönlich kümmerte sie sich um die «wirklich wichtigen Dinge», was eher ihrer «weiblichen Intuition» entsprach, wie sie sich ausdrückte.
Kees hatte schon vor einer Weile aufgehört, sich darüber zu ärgern. Es wäre nur Zeitverschwendung gewesen. Hendrika und Computer, das würde niemals zusammenpassen. Was im Übrigen auch für alle anderen elektronischen Geräte zutraf.
Hinter jedem guten Politiker, so wusste er, stand ein noch besseres Team. In diesem Fall: er. Der perfekte Parteisekretär, der alles kontrollierte und alles regelte. Der alles wusste. Und der nun natürlich auch das Verschwinden der Liste aufklären musste. Blödes Weib, dachte er, schließ doch einfach deine Schubladen ab!
In dem kleinen Raum stand der Computer, der die beiden Kameras steuerte und auf dem die Bilder gespeichert wurden. Die Kameras waren im Flur der ersten Etage und an der Fassade des Gebäudes angebracht. Niemand, jedenfalls fast niemand, wusste davon. Die Kameras machten alle drei Sekunden eine Aufnahme und speicherten sie.
Kees setzte sich und öffnete einige Dateien. Kurz darauf betrachtete er die Aufnahmen der vergangenen Nacht. Seine Theorie lautete, dass Hendrika sich irrte. Dass sie die Liste einfach verlegt hatte. Aber nur wenige Leute wussten von ihr und noch weniger, wo sie zu finden wäre. Das Dokument selbst war passwortgeschützt, dafür hatte er selbst gesorgt. Doch Hendrika mit ihrer Technikphobie wollte stets die neueste Version der Liste ausgedruckt haben.
Und dann ließ sie sie rumliegen.
Auf dem Bildschirm bewegte sich eine Gestalt an der Fassade entlang zum Eingangstor.
Die Person öffnete das Tor und betrat den kleinen Durchgang zum Haus.
Einige Augenblicke später ging dieselbe Gestalt in der ersten Etage über den Flur, betrat Hendrikas Büro und kam gleich darauf wieder heraus. Ein Mann. Er war höchstens eine halbe Minute im Büro gewesen. Weniger sogar. Er wusste genau, was er suchte und wo er es finden konnte.
Er?
Kees startete die Bildfolge erneut. Ja, es handelte sich zweifelsohne um einen Mann.
Er vergrößerte einige Bilder. Er kannte diesen Mann. Die große, magere Gestalt, die langen Haare … Er hatte ihn schon öfter gesehen. Er arbeitete hier, bei der Partei. Kees versuchte sich an seinen Namen zu erinnern.
Er druckte die beiden Bilder aus und schloss die Dateien wieder. Dann eilte er zu Hendrika. «Es sieht tatsächlich ganz danach aus, als ob letzte Nacht jemand hier gewesen wäre», sagte er. «In deinem Büro.» Er zeigte ihr die Ausdrucke.
«Und wer ist das?»
«Er arbeitet hier», sagte Kees. «Schon seit geraumer Zeit. Schreibt Artikel für die Parteizeitung und die Website.»
«Geh ihn sofort holen.»
«Soll ich auch die Polizei rufen?»
«Bist du verrückt? Willst du etwa, dass noch mehr sensible Informationen an die Öffentlichkeit dringen? Ich will meine Liste zurück. Bring diesen Kerl zu mir!»
Kees griff nach dem Telefon und gab zwei Nummern ein. Er erreichte Hendrik, der zwei Stockwerke höher die Kommunikationsabteilung der Partei leitete.