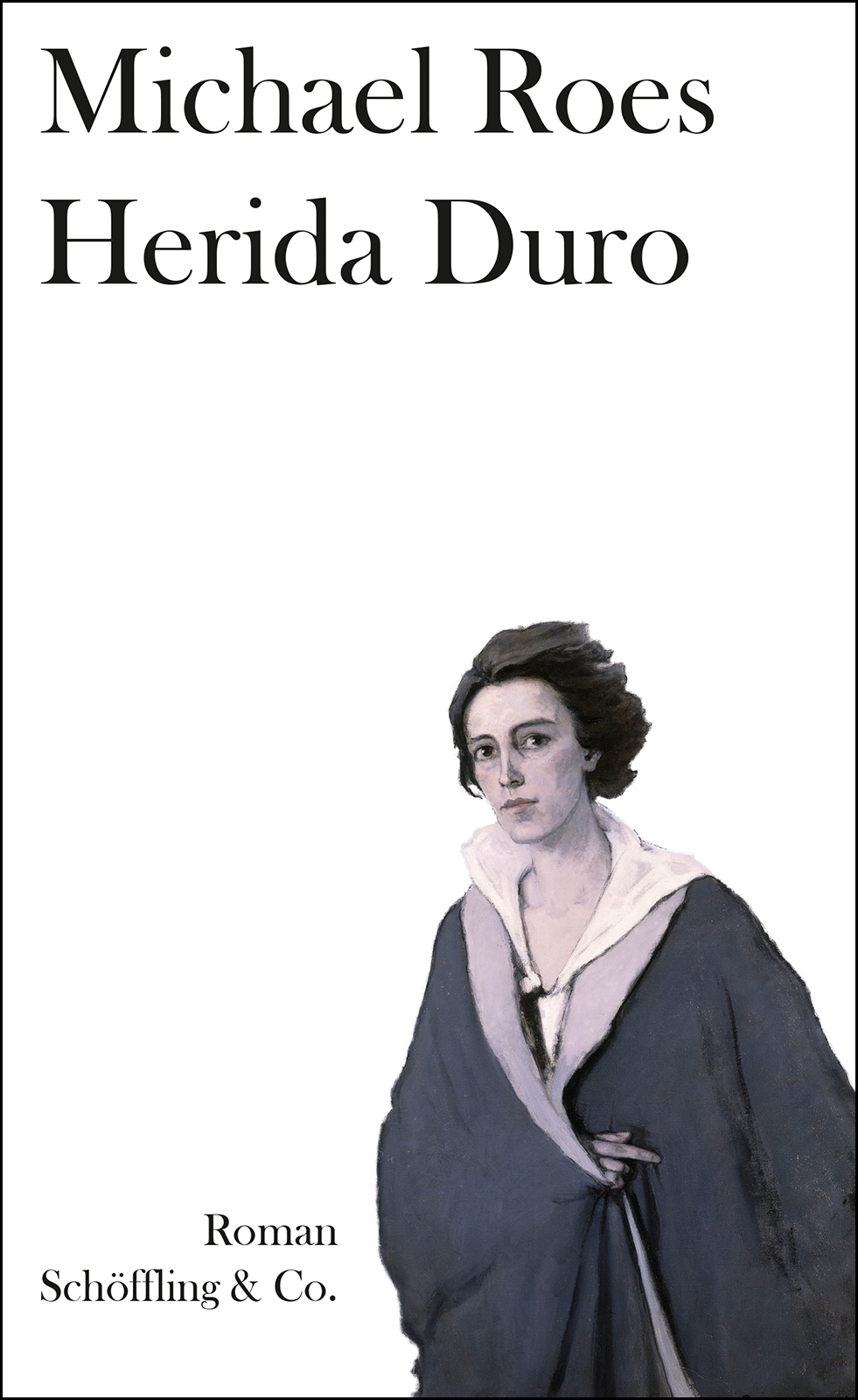
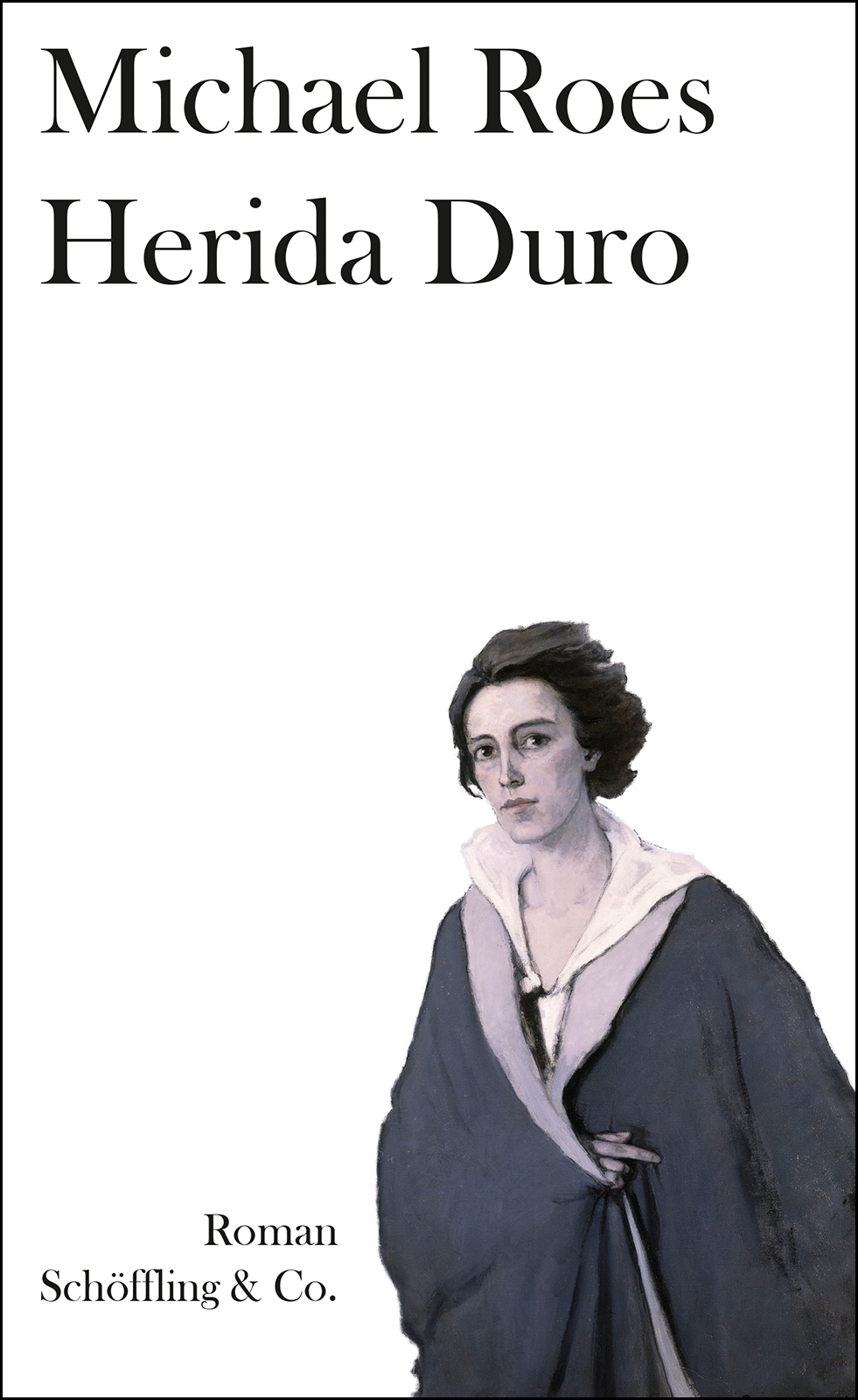
Inhalt
[Cover]
Titel
LAZARÚ
TIRANA
ROM
GIOVENTÙ DI GESÙ
GLOSSAR
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
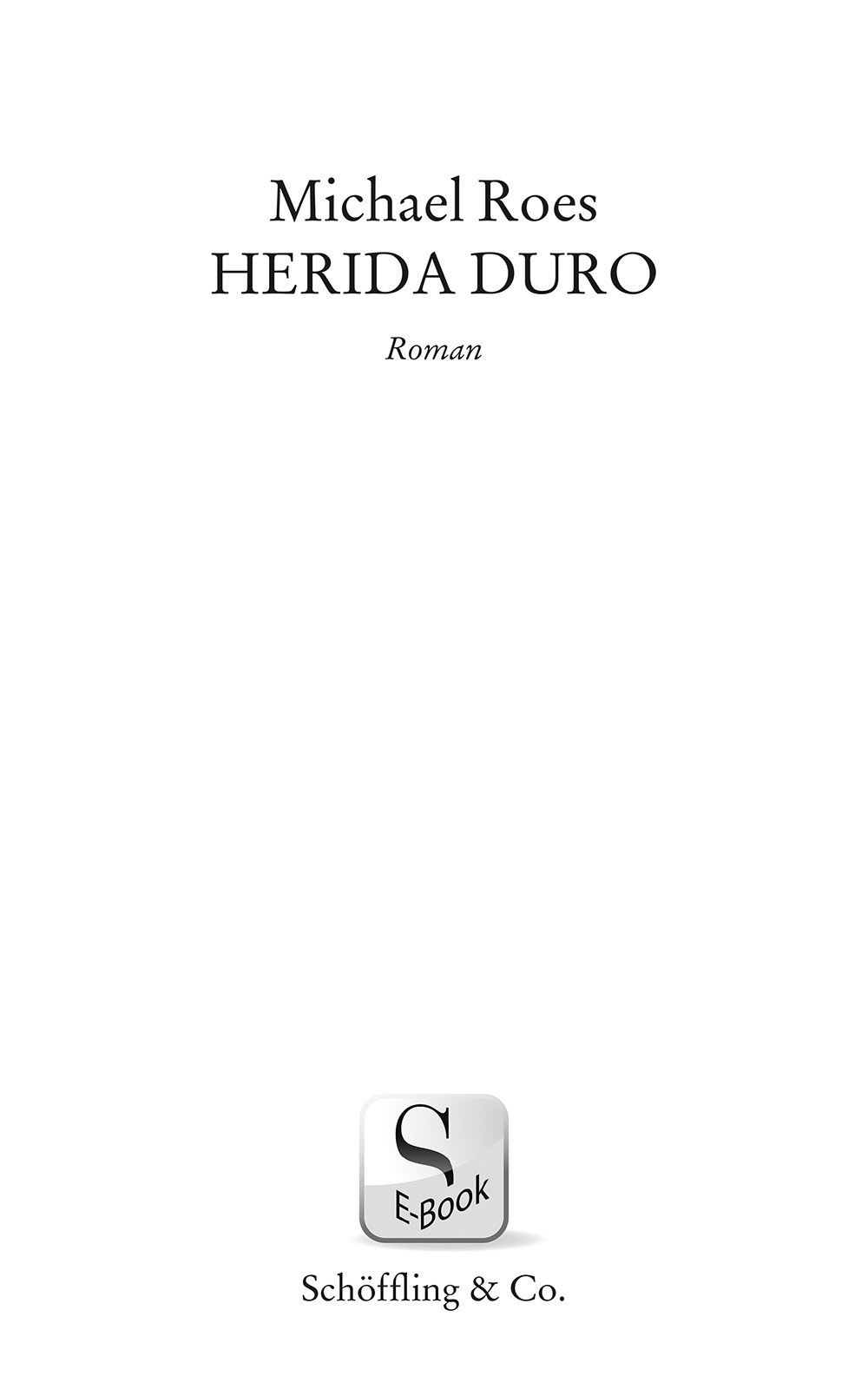
HERIDA DURO
LAZARÚ
Die Gesichtszüge sind mir nach wie vor vertraut, keine Nacht, in der ich nicht von ihnen geträumt hätte, aber der Ausdruck ist ein anderer, mir völlig fremder. Nun, da er die Herrschaft über seine Mimik verloren hat, ist es vielleicht sein wahres Gesicht. Dann müsste ich aber gestehen, diesen Mann nie gekannt zu haben.
Ich schaue mich unter den Trauergästen um, und auf einmal erscheinen mir auch die anderen, die noch lebenden Gesichter fremd, wächsern, vom Tod gezeichnet. Würde ich ihre Hände berühren, würden sie sich eiskalt und steif anfühlen. Zöge ich ihnen die Hemden aus, würde ich auf ihren Rücken grüne und violette Flecken entdecken.
Gjon steht in meiner Nähe, der einzige Lebendige in diesem Raum. Der Einzige, der den Tod fürchtet. Er schaut kurz zu mir, mit einem leisen, fröstelnden Lächeln auf den Lippen. Doch einen Atemzug später nimmt sein Gesicht wieder den vertrauten gleichmütigen Zug an.
Und wieder fällt mein Blick auf meinen Vater. Nun erkenne ich, was seine Gesichtszüge so fremd erscheinen lässt, der Ausdruck von Schwäche, von Verletzlichkeit, den er im Leben nie gezeigt hat.
Sind es nicht dieselben Eigenschaften, für die man einen Menschen manchmal liebt und dann wieder hasst? Er hat mich immer wie einen Erwachsenen behandelt, hat mir immer meinen freien Willen gelassen, in der Gewissheit, ich würde am Ende doch das tun, was richtig und anständig sei. Und nun trauere ich um ihn, wie ein Mann um ihn trauert, das heißt ohne mir die Trauer anmerken zu lassen.
Ich bitte Rovena, die Lampen anzuzünden. Zwar ist es draußen noch heller Tag, doch die vielen Männer in ihren dunklen Anzügen nehmen den Zimmern das Licht. Ich mag das Zwielicht nicht. Das ganze Haus ist dämmrig wie die fensterlose Diele, die man indessen nur nutzt, um hindurchzugehen. Das ganze Haus riecht im Augenblick auch wie sie, nach muffigen Mänteln und feuchtem Schuhwerk.
Der Tote liegt in einem Sarg aus hellem Fichtenholz. Nur wenn ich ganz nah an ihn herantrete und mich über ihn beuge, rieche ich den Geruch nach frischgehackten Zwiebeln, obgleich ich Säckchen mit Lavendelblüten zu ihm in den Sarg gelegt habe. Und ich rieche die Süße seiner Eingeweide. Als er noch lebte, schwitzte er einen eher bitteren Geruch aus. Nun lockt mich dieser Duft, ihn noch einmal auszukleiden und aufzuschneiden. Wer weiß, welche Güte und Milde ich unerwartet in ihm fände.
Aber was der Vater gibt, das fordert er hundertfach zurück.
Rovena hat getan, um was ich sie gebeten habe. Nun fällt das Licht der Deckenlampe auf sein Gesicht. Die Haare liegen so sorgfältig gekämmt und gefettet an seinem fleckigen Schädel wie nie zu seinen Lebzeiten. Natürlich ruhen die Augen geschlossen in ihren violetten Höhlen, aber die Lider wirken durchsichtig, so dass er mich einfach sehen muss, zumindest schemenhaft.
Er wirkt jünger als in den letzten Tagen vor seinem Tod, und er war selbst dann zweifellos zu jung, um schon zu sterben. Ich verscheuche die Fliegen von seinem Gesicht. Dann kümmere ich mich wieder um die Gäste. Er hätte so viele ernstblickende Männer in unserer Stube nicht gemocht, Geselligkeit fand er immer ermüdend. Ich befürchte, in dieser Hinsicht bin ich meines Vaters Kind.
Die ersten Bilder: Jene im Fensterrahmen, der Garten im eisigen Morgenlicht, die schwarzen Bäume, das erfrorene Gesicht des Vaters. Er gibt mir einen Körper. Einen, der von Dauer ist.
Frosttage. Geister in farblosen Tüchern, knirschend im Schnee. Die Hunde stumm. Ein leichter weißer Rauch vor den Mündern wie aus den kochenden Teekesseln.
Lazarú. Das Dorf. Ein Dutzend Häuser. Eine Kirche. Kein Gasthaus, keine Schule, kein Lebensmittelladen. Langeweile. Schweigen. Den Häusern aus rohbehauenem, unverputztem Felsgestein und dem daraufliegenden Blockwerk aus hartem, teerfarbenem Lärchenholz, gegenüber die aufgebockten Speicher, zwischen den Stelzen und dem Vorratsraum mühlradgroße Schiefer- oder Granitplatten, damit die Ratten und Mäuse nicht hinauf und hinein ins Lager klettern können. Wie es den lästigen Nagern trotzdem immer wieder gelingt, in unsere Speicher einzudringen, weiß allein der Teufel. Es müssen ihnen des Nachts wohl Flügel wachsen.
Auf den Steinbänken vor dem Haus die Alten, auf den Stirnen dünnes Eis, an den Rändern Schläfenschnee, die buschigen Brauen weiße Raben. Die Frauen unsichtbar. Ein Dorf im Gebirge. Wovon leben die Menschen hier? Woher kommen sie? Die Häuser sehen aus, als stünden sie schon vor jeder Geschichte an diesen steilen Hängen. Lange Zeit führte nicht einmal ein Karrenweg in unser Tal.
Hier geht man zu Fuß und schleppt seine Lasten selbst. Wo es keine Straßen gibt, finden sich auch keine Fuhrwerke oder Reittiere. Eine Kuh ist schon ein Zeichen besonderen Reichtums. Die meisten Familien begnügen sich mit der Haltung von Ziegen und Geflügel, da die Erde zu wenig hergibt, um auch noch gefräßiges Großvieh mit durchzufüttern. Wer hier überleben will, muss genügsam sein.
Karg ist diese Erde, wo in jedem Spalt in der Hauswand noch die Vorfahren atmen und schweigen. Ein wenig ausgetretener sind dieselben Stiegen, ein wenig durchgelegener die Strohmatratzen, doch es ist noch immer der gleiche Mörtel, mit dem wir die Risse und Fugen in den schiefgemauerten Wänden stopfen. Die Alten schweigen, doch ein jeder Balken, jeder Feldstein spricht.
In den Häusern riecht es nach Heu, nach Schafen und Ziegen. Und in der Stille hört man ihre Unruhe, ihre Angst vor unseren ungewissen Absichten. Es ist den Alten immer schwerer gefallen, ihr Vieh zu schlachten als ihre Söhne.
Im Sommer ist es das kalte schwarze Schneewasser, das in den Bächen schäumt und uns nächtelang beunruhigt. Es ist zu kalt, um darin zu baden. Niemanden von uns haben die Väter schwimmen gelehrt. Das Vieh zu hüten, zu melken, zu scheren, Bewässerungsgräben anzulegen, zu jäten, zu säen, zu pflücken und zu ernten brachten sie uns bei, ja, aber nicht zu schwimmen.
Als Kind gehe ich barfuß, später trage ich Holzschuhe, die Zeit des unbeschwerten Rennens ist vorbei. Mir kommt es vor, als trüge ich kleine helle Kindersärge an den Füßen.
Lege ich den gelben Ahornlöffel an mein Ohr, höre ich das Schweigen der Frauen. Es klingt anders als jenes der Männer, das aus einem anderen Holz ist, dunkler, härter, wie jenes, das wir zum Aufreißen der Erde verwenden.
Die gelben Ahornschuhe schützen uns davor, dass sich die scharfkantigen Steine, Dornen oder Disteln in unsere Fußsohlen bohren. Sie machen unsere Füße starr und unempfindlich wie Hufe. Die Ochsen beneiden uns darum.
Der Berg in unserem Rücken ist ein Berg der Unfruchtbarkeit und der Mühsal. Nur Gott weiß, warum sich unsere Vorfahren je hier angesiedelt haben. Die karge Erde war von jeher ihr Feind. Vielleicht haben sich am Anfang nur einige Verbannte, Vogelfreie in dieses Tal geflüchtet, weil sie hier, fern aller Menschen, unbehelligt blieben und kein anderer Anspruch auf den unfruchtbaren Boden erhob.
Es gibt eine Kargheit, die zugleich Würde, ja Stolz darstellt. Unser Berg besitzt nichts davon. Bis zum Mittag lässt er das Dorf in seinem kalten Schatten liegen. Nichts schenkt er den Bewohnern. Niemand fühlt sich hier dem Himmel näher.
Regen ertränkt den Sommer, die Wiesen, die Gerstenfelder, die Dunggruben. Unsere Ziegen stehen bis zum Euter im Morast, die Schweife sind es müde, die dunklen Wolken von Bremsen und Fliegen zu verscheuchen. In diesem Jahr warteten wir vergeblich auf die feuerroten Blüten der Bohnen. Die Mittagsstunde haucht uns mit kaltem, feuchtem Atem an.
Ich bin froh, dass der Regen das Gebrumm der Bremsen und Fliegen übertönt. Die Insektenschwärme lassen mich an Krankheit und Tod denken. Gleich sind sie da, wenn irgendwo ein Geschwür aufplatzt, ein Augenwinkel oder eine Lende eitert.
Auch Mutters Tod hatten sie angekündigt. Die Fensterscheiben ihrer Krankenstube haben sie verdunkelt, ein schwarzer Fliegenvorhang klebte vor dem Glas, sodass man die Fenster nicht öffnen konnte. Zum Ersticken heiß und eitrig war die Luft in ihrem Zimmer.
Das Gesicht der Frau unter dem Kopftuch war schon nicht mehr das der Mutter. Ich wusste nicht, wie ich die fremde Frau anreden sollte. Also schwieg ich.
So still war es, dass das Knarren der Tür und das leise Tappen auf den Dielen so laut wie die schweren Walzen beim Flachsbrechen klangen.
Es gab noch die hagere Magd Rovena, andere Frauen kannte ich in meiner Kindheit nicht. Rovena lebt immer noch hier. Sie muss damals jünger gewesen sein, als ich sie in Erinnerung habe. Und vielleicht auch fülliger, begehrenswerter. Irgendwer muss ihr Fisnik ja in den Leib gepflanzt haben.
Selbst Fisniks schwarzer Sonntagsanzug stinkt nach Schweiß, obwohl er ihn nur selten und nie zur Arbeit trägt. Nach Schweiß und etwas Viehischem, wie es am Ende der Dorffeste in der Luft liegt, wenn die Männer betrunken und voller unterdrückter Wut sind und warten, dass ihre Väter endlich nach Hause gehen und die Jungen für diese eine Nacht im Jahr jung sein lassen.
Wie viele sind inzwischen schon fortgegangen! Was sucht Fisnik noch hier auf unserem armseligen Hof? Kaum gibt es für mich und für Rovena Arbeit genug. Rovena bleibt, weil sie zu alt ist, um fortzugehen und noch einmal von vorne zu beginnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Fisnik seiner Mutter zuliebe hier ausharrt.
Alle sind sie hier, die Nachbarn, in ihren schwarzen Beerdigungsanzügen. Viele sind es nicht, und bis auf Gjon, Fisnik und Kujtim Çashku, den Lehrer, sind es nur alte Männer. Kujtim Çashku versteckt seine jugendlichen Züge hinter einem gewaltigen schwarzen Räuberschnurbart, und als Einziger trägt er, dem traurigen Anlass zum Trotz, seine alte, mehrfach geflickte Partisanenuniform, es fehlt nur die Pistole im Gürtel. Wer in Lazarú jemand sein will, muss anderen Furcht einjagen. Wenn keiner vor dir zittert und seinen Blick vor dir niederschlägt, bist du ein Niemand.
Dasselbe gilt auch umgekehrt: Willst du geachtet werden, darfst du vor niemandem Angst haben oder deinen Blick senken. Du musst ihm ohne jede Regung in die Augen starren, bis er deinem Blick ausweicht. Deine Augen müssen wie Gewehrmündungen sein. Früher reichte es, aus Lazarú zu stammen, um bereits mit Achtung behandelt zu werden. Schon der Name unseres Dorfes ließ die Menschen im Tal und darüber hinaus erzittern. Niemand legte sich willentlich mit einer Familie aus Lazarú an. Inzwischen aber haben sich die Zeiten geändert, und vor allem die jungen Leute, die fortgehen, werden eher den Ort ihrer Herkunft verschweigen, als damit prahlen.
Gäbe es noch eine Herrin im Haus, würden ihr in der Küche die Nachbarinnen ihre Aufwartung machen. Doch die Frauen sind zu Hause geblieben und überlassen die Totenfeier den Vätern und Gatten.
Von den Speisen rühren sie nur wenig an, umso großzügiger leeren sie ein Glas nach dem anderen auf das Wohl meines Vaters. Indessen ist niemand von ihnen betrunken. Sie sind den Selbstgebrannten gewöhnt wie die Priester den Messwein.
Niemand hat für meinen Vater sein Gesicht zerkratzt, wie es sonst bei uns Brauch ist. So schnell wachsen die Fingernägel nicht. Oder sind es nur die Narben, die ich fürchte und die das Gesicht selbst dann noch entstellen, wenn die Trauer längst gegangen ist?
Und niemand unter den Trauergästen ist mit wild zerrauftem Haar oder geröteten Augen eingetreten, obgleich nicht wenige meinen Vater wenn nicht geliebt, so doch geachtet haben. Auch meine Augen sind nicht geschwollen. Und meine Haare liegen ordentlich gekämmt wie zum Kirchgang unter dem Käppchen.
Des Vaters Tod war ein natürlicher Tod, wenn denn je ein Tod natürlich sein kann. Nur selten ist ein männlicher Verwandter so jung eines natürlichen Todes gestorben wie mein Vater. Vielleicht sind die Trauergäste deshalb ein wenig enttäuscht. Ist ein junger Mann dem Blut zum Opfer gefallen, sieht man stets die blutigen Kratzer auf Stirn und Wangen, Masken des Kummers der engsten Verwandten, die nach Rache dürsten.
Das Mahl verläuft schweigend und nach althergebrachter Sitte. Ich muss an meinen eigenen Tod denken. Es werden Gäste da sein, die ich womöglich noch gar nicht kenne. Und von den Gästen heute wird, so das Schicksal es gut mit mir meint, wahrscheinlich niemand mehr an meinem Leichenschmaus teilnehmen, bin ich doch der Jüngste unter ihnen, gerade einmal volljährig nach altem Recht, fünfzehn Jahre alt.
Jedes Jahr kommt der Schnee früher. Und in manchem der letzten Sommer schmolz er gar auf den Berggipfeln nicht mehr. Warum denke ich jetzt, am Ende des Sommers, bereits an den Schnee?
Es ist Gjon, der immer, wenn er mich anblickt, etwas Frostiges ausstrahlt, als würde man im Winter die Tür öffnen und die beißende Kälte in die verrauchte Stube lassen.
Die schweren Deckel auf den Brunnen nützen nichts, es kommt der Tag, da hören wir das Eis in der Tiefe krachen, und einer von uns muss hinabsteigen und den Eisspiegel aufhacken. Wir waschen uns wenig, aber trinken müssen wir.
Gjon ist der Einzige, der nicht nach altem Männerschweiß stinkt.
Und auch ich rieche nach Heu und nach Staub. Im Gegensatz zu den Männern schwitze ich wenig. Ich kann Hemd und Hose einen Monat lang tragen, und sie duften immer noch nach Gras und Löwenzahn.
Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe. Nicht, als Mutter starb. Und gewiss nicht jetzt, an der Bahre meines Vaters. Er musste mir die Tränen nicht erst verbieten. Für ihn war ich der Erbe, der Sohn. Hier kann nur ein Sohn der Erbe sein.
Er hätte nach dem frühen Tod der Mutter noch einmal heiraten sollen. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Aber er hat nicht einmal gesucht, nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet. Wie anders wäre meine Kindheit verlaufen!
Aber ich hasse ihn nicht dafür. Nicht dafür. Er hat mir für das, was er mir genommen hat, Stärke gegeben.
Gjon sieht mich an, als sähe er mich zum ersten Mal. Geht es dir gut, fragt er plötzlich. Seine Stimme klingt nicht so eisig, wie sein Blick vermuten ließe.
Ich war vorbereitet, antworte ich.
Kann man jemals auf den Tod vorbereitet sein? Ja, man kann.
Seine Haut ist blass, selbst die Adern, die sich darunter wölben wie Bandwürmer, sind es, als strömte in ihnen eisiges Blut.
Die ganze Nacht über hat Rovena Qiqra, Brot aus Kichererbsenmehl, gebacken. Überall im Haus, außer im verrauchten Oda, riecht es noch danach. Sie hat unsere Vorratskammer geplündert und zum Brot Einmachgläser mit marinierten Tomaten, Paprika und Peperoncini auf den Tisch gestellt. Für sie bedeutet diese Feier vor allem Arbeit, für Trauer um den verschiedenen Herrn bleibt keine Zeit. Betrete ich die Küche, schaut sie zu Boden. Von heute an bin ich ihr neuer Herr.
Man glaubt in unserem Dorf, manche Menschen seien fähig, die unvollendeten Träume früh Verstorbener zu Ende zu träumen. Manchmal denke, nein, befürchte ich, zu diesen Menschen zu gehören, denn einige meiner Träume sind so seltsam und fremd, dass sie nicht meinem eigenen Kopf entsprungen sein können. Andererseits ist auch vieles in meinem wachen Leben seltsam, so dass es nicht weniges bereits in mir selbst geben mag, das mir noch unbekannt ist.
Rovena erzählte mir, als ich noch jünger war und dergleichen Dinge leichtfertig für wahr hielt, man lasse Kühe, Ziegen und Schafe deshalb nicht auf Friedhöfen weiden, weil Kinder, die ihre Milch tränken, mit der Milch jene Traum- und Gedankenreste der Toten in sich aufnähmen, welche die Tiere mit dem Gras auf den Gräbern abgeweidet hätten. – Ich weiß nicht, ob Rovena es selbst geglaubt hat oder mir nur Angst machen wollte. Aber viele Kindheitsjahre hindurch hat mir diese Geschichte geholfen, mir meine eigenen wirren Träume zu erklären. Es waren die nicht zu Ende geträumten Träume der Verstorbenen.
Fisnik bringt die Speisen und Getränke von der Küche in den Oda und räumt die leeren Schüsseln und Platten ab. Ich sehe es Fisnik an, dass er diesen Dienst nur widerwillig verrichtet und sich lieber unter den Ehrenmännern im Gastraum sähe. Seit Vater tot ist, macht er aus seiner Unzufriedenheit keinen Hehl mehr. Meinetwegen kann er von heute auf morgen gehen, ich werde ihn nicht halten. Aus dem Haus werfen aber kann ich ihn nicht, so gerne ich es auch täte. Noch auf dem Sterbebett musste ich Vater versprechen, Fisnik und seiner Mutter ein lebenslanges Wohnrecht in unserem Haus zu gewähren.
Ich verstehe diese Fürsorge und Verantwortung für einen Knecht und eine Magd nicht recht. Ja, es stimmt schon, ich kenne Fisnik und Rovena mein Leben lang, sie gehören zum Haus wie der Herd und der Brunnen. In meiner Kindheit war Fisnik wie ein älterer Bruder für mich, was mir indes manche Niederlage und nicht wenige Schmerzen eingebracht hat. Und nach dem viel zu frühen Tod der Mutter hat Rovena einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Aufgaben übernommen. Aber das erklärt noch nicht, warum mein Vater eine Magd und ihren Sohn wie Familienangehörige bedenkt.
Über Fisniks Vater hat es immer eine Menge Gerüchte gegeben. Das glaubwürdigste erscheint mir, dass er Rovena einfach hat sitzen lassen. Vielleicht wusste er nicht einmal, dass sie seinen Bastard in sich trug.
Wer Fisnik nicht so lange kennt wie ich, glaubt manchmal, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und meinem Vater zu entdecken. Aber alles, was an Vater fein und wohlgestaltet war, erscheint bei Fisnik allenfalls in vergröberter, ja roher Form.
Liegt darin der Grund für Fisniks oftmals anmaßendes und zugleich gekränktes Gebaren? Der Grund für meines Vaters unerklärliche Duldsamkeit Rovena und ihrem Sohn gegenüber? Wäre sie nur eine Magd mit ihrem unehelichen Kind, hätte es keinen Grund gegeben, sie so viele Jahre auf unserem Hof zu beherbergen, da unsere kleine Wirtschaft kaum weiterer Hände als die meines Vaters und der meinigen bedurft hätte.
Doch nun sollte wenigstens er sich aufmachen und gehen. Es gibt hier für ihn nichts mehr zu tun. Nur der Eid, den ich meinem Vater am Sterbebett geleistet habe, hält mich davon ab, ihn noch heute fortzuschicken. Ein Eid ist bindender als jede Blutsbande, ein Eid ist etwas Heiliges, das Leib und Seele an etwas fesselt, das über uns selbst hinausgeht. Ihn zu brechen, bedeutet unseren Tod.
Natürlich habe ich selbst keine Erinnerung daran, aber andere erinnern sich noch sehr gut, denn es war ein mehr als ungewöhnliches Ereignis. Vater hat nie ein Wort darüber verloren, umso öfter erzählte mir Rovena davon, vor allem, wenn ich wieder einmal im Streit mit Vater lag oder mich von ihm ungerecht behandelt fühlte. Das ganze Dorf zittert einer Geburt entgegen, zumindest wenn es sich um den Erstgeborenen handelt. Erblickt ein Sohn das Licht der Welt, geht ein großes Schießen und Jubilieren los, die Nachbarn bringen Geschenke und klopfen dem frischgebackenen Vater anerkennend auf die Schulter. Ist es ein Mädchen, bleibt es still im Dorf, kein Schuss, kein Triller, kein Geschenk, kein Schulterklopfen, allerorten nur ein Bedauern in den Gesichtern, und der enttäuschte Vater bleibt eine Weile daheim, bis die allgemeine Anteilnahme sich neuen Ereignissen zugewandt hat.
Bei meiner Geburt war es anders. Mein Vater ließ es sich nicht nehmen, seine Büchse abzufeuern und die Nachbarn einzuladen. Ja, es wurde ein kleines Fest daraus, wie es sonst nur zu Ehren eines neugeborenen Sohns gefeiert wird. Wenn er nicht ansonsten als ein durchaus vernünftiger Mensch angesehen worden wäre, hätte ihm dieses Verhalten wider Brauch und Sitte zweifellos den Ruf eines Sonderlings eingebracht. Und man muss schon selbst in einem abgeschiedenen Dorf aufgewachsen sein, um ermessen zu können, was ein solcher Ruf im Dorfgefüge bedeutet.
Manche Neugeborenen sterben nicht an zu großer Zartheit und Schwäche, sondern an alten Gewohnheiten, die jeder unbefragt beibehält. Sobald die Geburt erwartet wird, schickt die Mutter der Schwangeren die Wiege und die Decke. Die Wiege ist alt und hat von jeher den Erstgeborenen jeder neuen Generation aufgenommen. Die Decke ist in den Monaten der Schwangerschaft von der werdenden Großmutter neu geknüpft worden und dick und schwer wie ein Bärenfell. Sie bedeckt die Wiege und das Kind in ihr, das stramm gewickelt ist und sich nicht rühren kann. Kein Licht und kaum Luft gelangt an sein stickiges Lager in der vom offenen Herdfeuer rauchgeschwängerten Küche. Bleibt es dann für immer stumm, so war es Gottes unergründlicher Wille.
Alles ist ein Geschäft zwischen Müttern und ihren Müttern, der Vater hat an der Wiege nichts zu suchen, seine Verantwortung beginnt erst, sobald das Kind laufen kann, von nun an bestimmt er Weg und Ziel. Aber Zef Duro denkt nicht an die alten Bräuche, als er die erstickende Decke fortreißt und die Wiege in den Garten trägt, er denkt gar nicht, sonst hätte er bedacht, dass die Sonne und die frische Luft den Tod des Kindes bedeuten könnten. Ja, in seinem Leichtsinn geht er noch weiter, lässt alsbald die Binden lösen und mich nackt, wie Gott mich schuf, über die taunasse Obstwiese krabbeln.
Überraschenderweise bleibt das Protestgeschrei der Frauen im Hause aus, nur einige Nachbarn ereifern sich über das unverantwortliche Gebaren meines Vaters. All das erfahre ich vor allem von Rovena, aber diese Geschichten werden auch im Dorfe oft wiederholt und müssen stets als Ursache herhalten, wenn den Bewohnern das eine oder andere an meinem Auftreten seltsam erscheint. Ich habe es dir nie gesagt, mein Vater, denn über diese Dinge verliert man bei uns in den Bergen keine Worte, doch für diese Unbedachtheiten, für diesen reinen Überschwang habe ich dich mein Leben lang geliebt.
Nun lässt du mich allein in Lazarú zurück. Als ich noch unsere Ziegen auf die Weiden trieb und die Haselnüsse am Rand des Saumpfads sammelte, war ich davon überzeugt, die Welt sei jenseits der Brücke über den Thet zu Ende. Selbst auf den Almen oberhalb des Bergwaldes sah ich nicht weiter als bis zu den gegenüberliegenden Höhenzügen, die unser Tal schützen und einschnüren.
Selbst noch fast körperlos waren die Gedanken wie ein Schneebienenvolk in weißer Höhe. Verweht. Freigeschabt. Geblendet vom väterlichen Licht. Noch wusste ich nicht, warum Burschen und Mädchen sich im Verborgenen treffen und ihre Leiber aneinander reiben. Alle Männer waren verheiratet, vernünftig und verschwiegen. Alle gingen ihrer Arbeit nach, alle tranken, für niemanden war das Leben ein Rätsel.
In dieser Welt gibt es nichts zu staunen. Alles ist, wie es immer war, und bleibt, wie es ist. Staunen wäre ein Verrat an der göttlichen Ordnung. Selbst die Verwunderung lässt man sich nicht anmerken. Stellt sich etwas als anders oder gar als Gegenteil von dem heraus, was man angenommen, hat man es insgeheim schon immer gewusst. Nichts kann die Menschen unseres Tals enttäuschen oder erschüttern. Sollten sie eine Seele haben, so eine borstige, grauhaarige Tierseele. Im Übrigen ist Seele kein Wort, das wir im Alltag verwenden. Es ist ein Pfaffenwort, es gehört einer anderen Welt an, in der wir nur an Sonn- und Feiertagen zu Besuch sind, oder bei Beerdigungen, die Hüte oder Mützen in den Händen, den Unglauben im Herzen.
Folgt man dem Gebirgsbach hinab ins Tal, wird er zum reißenden Fluss, wild von Fels zu Fels springend, an den ausgefransten Ufern mit Kiefern und Weiden bewachsen. Erst hier, unterhalb des Dorfes, nennen wir ihn Thet.
Alle Häuser in Lazarú sind aus rohem Stein gebaut und mit Schiefer überdacht. Sie unterscheiden sich nur durch ihre Größe und ihre Lage am Hang. Der ebenerdige Raum dient als Stall. Die Wohnräume darüber erreicht man über eine Stein- oder Holztreppe, die zunächst in eine Diele führt, von der aus man die verschiedenen Zimmer und die Küche erreicht. Fenster gibt es nur wenige. Unsere Häuser gleichen Kullas, den fensterlosen Wehrtürmen mit Schießscharten für die Gewehre, wie sie überall im Land verstreut stehen, von schattenhaften Gestalten bewohnt, die nicht mehr ins Sonnenlicht zu treten wagen.
In den ältesten Häusern gibt es noch keinen Herd und keinen Kamin, sondern nur eine offene Feuerstelle, der Rauch muss zwischen den undichten Schindeln entweichen.
Jedes Haus hat seinen eigenen Garten. Der Garten gehört zum Haus. Hier befindet sich nicht nur der Brunnen, sondern auch eine Speisekammer aus Flechtwerk für die Milch und andere verderbliche Nahrung, die der steten Bewegung der Luft bedürfen. Für nicht wenige Familien ist das, was der eigene Garten hergibt, oftmals das Einzige, was sie nährt und am Leben hält.
Im Tal gibt es ausgedehnte Lavendelfelder, doch hier oben bauen wir vor allem Gemüse und Heilkräuter an. Kamille und Salbei können wir verkaufen und mit dem bescheidenen Erlös jene lebensnotwendigen Dinge erstehen, die wir nicht selbst erzeugen oder herstellen können.
Bewacht wird unser Tal von gezackten Spitzen aus weißem und rosafarbenem Dolomitkalk. Wir nennen den Gebirgskranz Bjeshkët e Nemuna, die verfluchten Berge, verflucht für alle, die über diese Höhen ins Tal eindringen und uns in den Rücken fallen wollen. So erklären uns zumindest die Alten diesen Namen.
Auf der Höhe unseres Dorfes herrscht noch ein Mischwald aus Fichten, Rotbuchen und Bergahorn vor. Höher am Hang stehen Weißtannen, Lärchen und Schwarzkiefern, die Lazarú vor Schnee- und Gerölllawinen schützen. Dann folgen Dickichte aus Wacholder und Krüppelkiefern, ehe die Zone der Viehweiden und Kräuterwiesen beginnt. Was wir nicht in unseren Gärten anbauen, sammeln wir im Sommer und Herbst hier oben, vor allem Bergbohnenkraut, Bergtee, Edelweiß und Thymian.
Da viele unserer Gärten durchaus ansehnlich sind, stehen unsere trutzigen Häuser nicht gerade dicht beieinander. Wenn es die Kirche nicht gäbe, auch sie gleicht einem fensterlosen Wehrturm, würde man Lazarú kaum für ein Dorf halten.
Onkel Agon ruft mich zu sich. Er ist der älteste Bruder meines Vaters und seit dem Tod des Großvaters das Oberhaupt der Familie. Wenn er ruft, hat man zu gehorchen. Er bestimmt letztlich alle Geschicke der Sippe, wer wen heiratet, wer welche Arbeit aufnimmt, ja, wer welche Kleidung trägt. Für die Alten ist Kleidung immer noch der unmittelbare Ausdruck ihres Standes.
Am wichtigsten aber ist seine Rolle als Hüter der Familienehre. In seiner Obhut befinden sich die Flinten und Pistolen, auf sein Geheiß hin werden sie geladen und eingesetzt. Seine Weisheit oder Dummheit entscheidet über Fehden und Vendetten, die in diesem Landstrich schon manche Sippe ausgelöscht haben.
Mein Vater hat sich mit seinem ältesten Bruder nie gut vertragen. Und so hat er seine Abneigung gegen ihn an mich weitergegeben. Onkel Agon hat nicht die Würde, die Bescheidenheit und Lebensklugheit meines Großvaters. An jedem seiner dicken, haarigen Finger trägt er einen Goldring, und die ihm inzwischen ausgefallenen Zähne hat er durch Goldzähne ersetzen lassen. So glaubt er, seine Autorität mit seinem ausgestellten Reichtum unterstreichen zu müssen.
Um die stattliche Hüfte hat er seine rote Schärpe und den Patronengurt geschlungen. Auch Gurt und Schärpe glänzen von goldenen Schnallen und Broschen.
Die Schärpe ist mehr als ein Gürtel. Sie ist es, die den Mann zusammenhält, sie ist es, mit dem ein Mann seinen Rang und seinen Namen behauptet. Als große Schande gilt, die Schärpe vor Fremden ablegen zu müssen. Ohne Schärpe ist der Mann nackt.
Auch ich trage anlässlich der Trauerfeier für meinen Vater mein Festgewand, einen schwarzen Mintan, darunter die Kraholi, eine taubengraue Weste. Und auch ich trage meine Schärpe.
Ist sie nicht sorgfältig gebunden und tritt jemand aus Versehen auf ihr loses Ende, kommt das einer Entehrung gleich. Manch blutige Fehde ist allein aus dieser Unachtsamkeit ausgelöst worden.
Setz dich, Marijan, fordert mein Onkel mich auf. Es ist nun mein Haus. Auch wenn mein Onkel das Oberhaupt unserer Sippe ist, hat er nicht das Recht, mir unter meinem eigenen Dach einen Stuhl anzubieten. Ich bleibe an der Tür stehen.
Er fährt unterdessen mit seiner Rede fort, als sei ich seiner Aufforderung nachgekommen.
Nun, da mein Bruder viel zu jung von uns gegangen ist, betrachte mich als deinen Vater, mein Sohn. Wann immer du Rat und Unterstützung brauchst, komm einfach zu mir. Du wirst immer ein offenes Haus finden.
Natürlich werde ich das. Da ich geschworen habe, niemals eigene Kinder zu haben, werden seine Söhne oder Enkel irgendwann meine Erben sein.
Die Männer glauben, einem Verstorbenen werde der Zutritt in den Himmel verwehrt, wenn er nicht wenigstens einen Sohn gezeugt habe. Ohne Sohn sterbe mit dem Leib des Vaters auch seine Seele, und das ewige Leben sei für ihn verwirkt. Dasselbe glauben auch die Frauen in unserem Dorf, ohne sich indessen Gedanken über ihr eigenes Seelenheil zu machen. Selbst im Himmel, vermute ich, können sie sich kein Fortleben ohne Aufsicht ihrer Väter, Brüder oder Ehemänner vorstellen, ist doch selbst Gott ohne jeden Zweifel ein Mann.
Ich nicke stumm. Ächzend erhebt sich Onkel Agon aus seinem Sessel.
Ach, eins noch, mein Kind. Ich befürchte, das Grundstück deines Vaters ist zu klein, um es mit Gewinn zu bewirtschaften.
Ich werde wieder Kräuter im Garten anbauen.
Der Onkel seufzt. Nun, mein Bruder liegt noch nicht unter der Erde. Dennoch fühle ich mich verpflichtet, dir die Wahrheit zu sagen. Der Grund und Boden deines Vaters war immer schon zu klein. Aber dein Vater war zu stolz, ihn zu verkaufen und eine andere Arbeit anzunehmen. Die Folge ist, dass er sich in den letzten Jahren hat Geld bei mir leihen müssen.
Das habe ich nicht gewusst. Aber ich werde mich bemühen, dir alles nach und nach zurückzuzahlen.
Im Grunde hast du von deinem Vater nur die Schulden geerbt. Doch lass mich dir einen Vorschlag machen. Überschreib Haus und Boden mir, und ich werde alle Schulden deines Vaters als beglichen ansehen.
Und wovon soll ich dann leben?
Du kannst natürlich hier wohnen bleiben und ein wenig Land von mir pachten.
Ich danke Ihnen für Ihren Großmut, Onkel. Ich werde darüber nachdenken.
Ja, tu das, mein Junge. Doch nun lass uns zu den Gästen zurückkehren, ehe sie dich für unhöflich halten.
Den ganzen Tag schon verfolgen mich ein Schwindelgefühl und ein rumorender Schmerz im Bauch. Ist es, weil ich die kommenden Sorgen bereits geahnt habe oder weil ich keine tiefe Trauer empfinde, weil ich nicht weinen kann, nicht weinen darf? Männer weinen allenfalls vor Wut, doch niemals aus Trauer oder Verzweiflung.
Ich esse während dieses Totenmahls wenig und trinke nur Tee. Aber die Bauchschmerzen lassen nicht nach. Mit kommt es vor, als wären meine Gedärme voller eisiger Luft und würden gleich platzen. Dabei habe ich gar nichts Blähendes gegessen.
Da schreit Rovena leise auf und weist auf meine Hose. Und schon haben es auch alle anderen im Oda bemerkt, das Blut, das mir aus dem Schritt sickert und auf den Wollteppich tropft. Gjon schaut erschrocken, Fisnik lächelt spöttisch, Onkel Agon und die anderen Alten verhalten sich so, als hätten sie nichts gesehen. Und jetzt erst, als ich den verborgenen Ekel in ihren Mienen wahrnehme, begreife ich die Schmach. Rovena schiebt mich hinaus aus dem Gastraum und bringt mich in die Küche. Rasch, zieh dich aus und wasch dich. Ich hole Binden und saubere Kleidung, sagt sie.
Was ist passiert, frage ich müde.
Du bist zur Frau geworden, antwortet sie barsch. Das musste irgendwann ja mal passieren.
Doch warum ausgerechnet heute?
Die Natur lässt sich nicht betrügen. Auch vom Kanun nicht. Dein Vater hätte es wissen müssen.
Eine merkwürdig flackernde Krankheit fesselt mich ans Bett. Selbst Rovena weiß nicht genau, um was es sich handeln könnte. Wenn ein Mensch stirbt, glaube ich, ist er nicht sofort tot. Es ist wie eine Kerze, die man ausbläst, für einen Augenblick glimmt noch der Docht, eine ganze Weile raucht er noch, und für Stunden steht der Geruch des langsam verhärtenden Wachses noch im Zimmer.
Wenn ein Mensch stirbt, lebt er nicht mehr, ohne schon tot zu sein. Er ist erst tot, wenn alle, die mit ihm gelebt haben, gestorben sind. Es flackert, glimmt und raucht noch in mir. Ich könnte Daumen und Zeigefinger mit meiner Spucke befeuchten und den noch glühenden Docht einfach ausdrücken. Aber da ist bereits so viel Dunkelheit und so wenig Licht.
Als ich auch den zweiten Tag nicht aufzustehen vermag, fragt Rovena, ob sie vielleicht Onkel Agon rufen solle. Ich entgegne, nein, das sei nicht nötig, ich sei einfach nur ein wenig erschöpft. Und ich stehe trotz des Fiebers und des Schwindelgefühls von meinem Lager auf.
Was mache ich mit den Kleidern meines Vaters? Mir sind sie zu groß. Und selbst, wenn sie mir passten, würde ich sie nicht tragen wollen.
Auch der Onkel will sie nicht, nicht einmal die guten Stücke. Es war doch immer der jüngere Bruder, mein Vater, der des Älteren Sachen auftrug. Das soll sich auch nach dem Tod des Jüngeren nicht ändern.
Ich denke an das Hemd und die Hose und das Paar Schuhe, das Vater dem Fremden mitgegeben hat. Das Paar Schuhe hatte Vater sich zur Hochzeit von einem Schuhmacher in Konçe maßanfertigen lassen.
Plötzlich sitzen sie um den Tisch in unserer Küche, fünf Partisanen, alle haben sie Gewehre bei sich, einige auch Pistolen in ihren Gürteln. Sie tragen keine einheitlichen Uniformen, mancher trägt nur eine Militärjacke, andere bloß entsprechende Hosen oder Stiefel. Es scheint, als hätten sie sich ihre Monturen zusammengeraubt und die Abzeichen der fremden Armeen und Ränge einfach entfernt.
Der Verwundete liegt in meiner Kammer. Vater schneidet dem Fremden eine Kugel aus der Schulter, Rovena versorgt die Wunde. Ich mag den Fremden auf meinem Bett nicht, er ist mir unheimlich, seine Stimme klingt heiser und erschöpft, was nach den erlittenen Qualen verständlich ist, trotzdem erweckt sie in mir das Gefühl von etwas Bedrohlichem. Dazu kommt seine fremde Mundart, sodass ich nur wenige seiner Worte verstehe. Spricht er überhaupt dieselbe Sprache?
Dann ist da sein Gesicht, selbst das Kerzenlicht scheint ihm zu grell, sofort schützt er mit der schmutzigen und blutverkrusteten Hand seine Augen, als würde der milde Schein ihn bereits blenden. Unter seinem mehrere Tage alten Bart ist er von zementgrauer Blässe, die Wangen sind eingefallen, nicht nur von den Entbehrungen der letzten Tage, sondern einem länger andauernden Hunger. Daher vermag ich sein Alter kaum zu schätzen. Er könnte erst zwanzig, aber auch schon vierzig Jahre alt sein. Bis zum Hals ist seine Brust mit dichtem schwarzem Haar bewachsen. Der Schweiß rinnt ihm trotz der Kälte in stetigen Rinnsalen über das Gesicht. Der Vater heißt mich, warmes Wasser und Tücher zu bringen. Während er dann den Fremden entkleidet und wäscht, schickt er mich hinaus, mich um die übrigen unerwarteten Gäste zu kümmern.
Im Licht der Petroleumlampe merke ich, zumal bis auf ihren Wortführer noch niemand gesprochen hat, erst nach einer ganzen Weile, dass unter den müden und schmutzigen Gesichtern eines ist, das nicht recht in die Gruppe passen will. Zunächst denke ich, es müsse das Alter sein, ein noch bartloser, kaum seiner Kindheit entwachsener Jüngling unter all den unrasierten, schon graubärtigen Kämpfern. Doch dann trifft es mich wie ein Blitzschlag: Das ist kein Jüngling, das ist eine junge Frau, ganz und gar wie die Männer gekleidet und bewaffnet. Wie ist das möglich? Gibt es auch unter den Partisanen diesen Eid immerwährender Jungfräulichkeit, um in die Reihe der Männer aufgenommen zu werden? Aber sie kommen doch größtenteils gar nicht aus den Dörfern, sondern sind Städter mit revolutionären Ansichten. Sind denn alle Gerüchte, die man über sie verbreitet, falsch?
Bisher habe ich mich, wenn nicht für einzigartig, so doch für eine rare Ausnahme gehalten, besonderen und seltsamen Umständen geschuldet, denn kaum je fehlt in den kinderreichen Familien der Bergbewohner ein männlicher Erbe. Und versagt ein Eheweib in dieser Hinsicht, wird sie zu ihrer Familie zurückgeschickt, und der um seinen Sohn betrogene Mann nimmt sich eine neue und, so Gott will, fruchtbarere Frau. Man heiratet nicht aus Liebe, und man achtet seine Frau erst, wenn sie dem Mann Söhne geboren hat. Und selbst dann bleibt sie eine Fremde. Sie wird niemals Teil der angeheirateten Sippe, ihre Kinder gehören allein der Familie des Mannes an. Sie selbst bleibt, wenn sie verheiratet ist, auch weiterhin der Sippe ihres Vaters zugehörig.
Und da sitzt nun diese Frau in Männerkleidern an unserem Küchentisch, eine Frau Tag und Nacht in Gesellschaft anderer Männer, unter denen wohl kaum ihr Ehemann, ihr Vater oder einer ihrer Brüder sein wird, der ihre Ehre schützt. Ist sie eine Frau? Ist sie ein Mann? Ist sie, wie manch einer im Dorf sagen würde, eine Teufelin oder eine Buhlerin Satans?
Sie schaut mich ohne Scheu und mit kaum verhohlener Neugier an. Ich bin so verwirrt, dass ich mich an den Herd flüchte, um nach der Fasule zu sehen. Kann man der Männerwelt angehören, ohne dem Verkehr mit ihr entsagen zu müssen? Reicht es, sich einfach ihre Kleidung anzueignen und sich unter sie zu mischen und jeden Einwand zu ignorieren?
Sie ist so unvergleichlich schön, dass kein Mädchen aus Lazarú, kein Mädchen aus dem ganzen Tal sich mit ihr vergleichen ließe, so schön, dass ihr, selbst wenn sie doch ein Knabe wäre, die Jünglinge und Männer ausnahmslos verfallen müssten. Wäscht sie deswegen ihr Haar und ihr Gesicht nicht, und hält sie deshalb ihren Hirschfänger ständig griffbereit? Ich bin mir sicher, dass sie sich selbst in der Nacht nicht davon trennt.
Und plötzlich verstehe ich, warum diese Partisanen, dieser Krieg, diese Revolution die Menschen hier so aufwühlt. Keine Gewissheit ist mehr sicher. Männer sind keine Männer mehr, Frauen keine Frauen, die Ehre wird zu einem hohlen, sinnlosen Wort, und am Ende wird ihnen selbst Gott nicht mehr heilig sein. – Man könnte vor Angst und Freude fast den Verstand verlieren!
Sie löffeln ihren Bohneneintopf wortlos. Nur der Älteste der Gruppe bedankt sich für Suppe, Brot und Branntwein. Er ist ein eher kleingewachsener Mann, nur wenig jünger als mein Vater. Sein blasses Kontoristengesicht zeigt einen arglosen, ja kindlichen Ausdruck. Als Einziger trägt er eine fast vollständige italienische Uniform, an der er die faschistischen Rang- und Hoheitszeichen durch den roten Stern ersetzt hat. In seinem Gürtel steckt eine Mauser, am rechten Handgelenk trägt er eine deutsche Armbanduhr. Diese italienischen Musketen, sagt er mit Verachtung in der Stimme, sind allenfalls gut, sich selbst damit ins Gesicht zu schießen. Man kann ja gegen die Deutschen sagen, was man will, aber von Waffen verstehen sie was!
Noch vor Sonnenaufgang sind sie verschwunden, ihren Verwundeten lassen sie zurück. Er bleibt zwei Wochen, seinen Namen erfahre ich nicht. Die meiste Zeit schläft er. Mit mir wechselt er kein Wort. Wenn ihm etwas nicht passt, flucht er in sich hinein, an niemand Besonderen gerichtet. Offenbar kann er lesen. Ich sehe das einzige Buch in unserem Haus, eine lateinische Bibel, neben seinem Lager. Lesend sehe ich ihn nie, aber einen Halm aus meinem Strohsack, den er als Lesezeichen verwendet, durch den Papierblock wandern.
Als er geht, trägt er eine Hose und ein sauberes Hemd von Vater und seine handgefertigten Hochzeitsschuhe, die, so Vaters Worte, ohnehin zu nichts mehr nütze gewesen seien und allenfalls noch zu seiner Beerdigung getaugt hätten.
Fisnik nimmt den zweiten Anzug, im ersten, besseren haben wir ihn ja begraben, wobei für die feuchte Erde auch der zweitbeste gut genug gewesen wäre. Rovena wird die Säume auftrennen und die Hose und Jacke Fisniks Maßen anpassen. Er ist ein wenig größer und kräftiger als Vater, ansonsten seiner Erscheinung und Haltung nicht unähnlich. Die restlichen Kleidungsstücke packe ich in die Eichentruhe, in der schon zwischen staubtrockenen Lavendelblüten Mutters Kleider ruhen, die Vater nicht weggeben oder niemand annehmen wollte. In dieser Truhe brachte Mutter ihre Aussteuer ins Haus, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher, Servietten, ein Silberbesteck, ein Service mit handgemaltem Rankenmotiv. Nicht ein Stück davon ist zerbrochen. Vater und Mutter sind immer sorgfältig mit den Dingen umgegangen. Auch sie konnten nichts fortwerfen, das noch heil war oder irgendwann noch einmal von Nutzen hätte sein können. Dann schleppe ich mich in meine Schlafkammer zurück.
Je länger ich im Bett liegen bleibe, umso mehr nimmt die Erschöpfung zu. Am Ende muss ich mir eingestehen, dass ich womöglich doch ernsthaft erkrankt sein könnte. Ich schlafe nicht mehr in der Nacht und wache am Morgen nicht mehr auf. Ich verbringe meine Zeit in einem Halbschlaf und weiß nicht mehr, ob ich gerade denke oder träume. Rovena beginnt, mich wie ein kleines Kind zu füttern, selbst Fisnik besucht mich hin und wieder und schaut mich mit ausdrucksloser Miene an, sodass ich nicht sagen kann, wartet er auf meine Genesung oder meinen Tod. Ja, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es wirklich Fisnik ist, der plötzlich im Zimmer steht, ohne dass ich ihn habe hereinkommen hören, und mich wortlos anstarrt und wartet, bis ich die Augen schließe, weniger aus Müdigkeit denn aus Scham.
Eines Morgens ist es dann er, Fisnik, der mich füttert. Er sagt, nun sei auch Rovena erkrankt. Die Arbeit sei zu viel für sie allein. Ich fühle mich zu schwach, um mich gegen seine Fürsorge zu wehren. Vielleicht wäre es nun doch an der Zeit, Onkel Agon eine Nachricht zukommen zu lassen. Aber selbst zu diesem Entschluss fühle ich mich nicht mehr in der Lage.
Ich spüre, das Haus vermisst meinen Vater. Die beiden gehörten zusammen wie der gemütliche alte Sessel und jener, der jeden Abend in ihm gesessen hat. Er hat die Form meines Vaters angenommen. Setze ich mich hinein, so ist er geradezu unbequem wie ein fremdes Paar ausgetretener Schuhe. Trotzdem setze ich mich hinein, versuche auszuruhen, nachzudenken, mich als Besitzer des Sessels, des Hauses zu betrachten, ich würde mich gerne darin ausstrecken, mit ihm eins sein, glauben, ja, ich schaffe das mit meinen fast sechzehn Jahren, aber alles hier ist so alt, vom langen Gebrauch in seine besondere Form gebracht, die sich von mir nicht mehr ändern lassen wird, zumindest nicht, ohne Widerstand zu leisten oder gar zu zerbrechen. Ich muss mich zwingen, aus Vaters Sessel aufzustehen, um nicht gleich jeden Mut zu verlieren. Bequem ist er nur für meinen Vater gewesen. Ich kann darin nicht sitzen, ohne dass mir nach einer Weile alle Glieder schmerzen.
In der Nacht besucht mich mein Vater. Er trägt den schwarzen Anzug, in dem wir ihn begraben haben. Er will, dass ich ihn ausbürste, da er voller Erde sei. Als wäre das so schlimm, mit verdrecktem Anzug unter den anderen erdverschmierten Toten zu ruhen. Sicher gibt es unter ihnen nicht wenige, die viel grässlicher zugerichtet sind. Wen kümmert das jetzt noch?
Trotzdem bürste und bürste ich, aber natürlich bekomme ich die feuchte Erde so nicht aus dem groben Wollstoff fort, ja reibe sie nur noch tiefer ins Gewebe. Er müsste den Anzug erst mal am Herdfeuer trocknen lassen. Doch ausziehen will er ihn nicht. So lange könne er nicht bleiben, sagt er, und ohne Anzug zu seinen neuen Gefährten zurückzukehren, da müsste er sich ja schämen!
Kalt und klamm liege ich in meinen Laken, lausche in die beunruhigende Stille, wo sonst das ganze Haus Geräusche macht, die alten Balken knacken, Fugen atmen, Ziegen schmatzen, Hühner scharren und die Obstbäume im Garten ächzen. Stattdessen höre ich meinen Atem und den Mond, halb Mann, halb Frau.
Rovena und Fisnik schleichen auf Zehenspitzen durchs Haus. Ich habe geträumt, Rovena schnitte mir die Finger- und die Zehennägel. Vielleicht habe ich es auch nicht geträumt. Wie lange liege ich schon hier im Bett? Dabei war es am Anfang doch kaum mehr als ein Unterleibsschmerz.
Bei den alten Frauen gibt es nur noch wenige schmerzempfindliche Stellen. Ihre Haut ist gefühllos und verhornt, als sei sie schon zur Einbalsamierung vorbereitet. Alles Wünschen und Begehren ist mit dem Talg und Fett aus dem mageren Fleisch herausgeschmolzen. Und nur Geiz und Klatsch haben sich wie die toten braunen Flecken darauf vermehrt.
Von meiner Großmutter habe ich gelernt, die Spelzen meiner geschnittenen Finger- und Fußnägel nicht herumliegen zu lassen, sondern sorgfältig aufzulesen und im Herdfeuer zu verbrennen. Denn sollten sie in die Hände einer übelwollenden Frau oder Rivalin geraten, könne sie mir damit schreckliches Leid zufügen. Auch wenn ich inzwischen nicht mehr an derlei Hexenkünste glaube, sammle ich noch immer sorgfältig alle Nagelsplitter auf. Was hat Rovena mit ihnen angestellt?
Ihr Schweigen riecht nach Rettich und Zwiebeln, und das gelegentliche Wort, das sie noch sprechen, knirscht wie ein rostiges Messer, das man in nassen Sand stößt.
Fisnik hält seine Hände zwischen die Knie gepresst. Mit glühendem Gesicht schaut er mich an, als sei er es, der Fieber habe oder Unterleibsschmerzen.
Ich versuche, wach zu bleiben, doch dann schließt er die Läden, obgleich es draußen doch dunkel und der Mond längst untergegangen ist.
Als ich wieder erwache, sitzt Fisnik immer noch da, auf dem Fichtenholzstuhl. Fisnik kann im Sitzen schlafen, er braucht nur einen Arm oder eine Lehne für die Stirn. Er ist ein Stirnschläfer, die Stirn stützt den ein wenig zusammengesackten Leib. Wie kann so ein Schlaf erholsam sein?
Ich träume, ich säße in seinem Geäst zwischen den Nadeln und Zapfen, ganz ohne Kleider. Ich warte, bis die Baummotten mich eingesponnen haben in ihr klebriges Kleid, ehe ich mich herabfallen lasse.
Unser Dorf gleicht einem Fossil, einer riesigen versteinerten Echse aus der Vorzeit, die schwer verwundet diesen Hang hinaufgeklettert und auf halbem Weg verendet ist. Die mit Schieferplatten gedeckten Häuser sind ihre Schuppen, der stumpf aufragende Kirchturm ist ihr kleiner hirnloser Kopf.