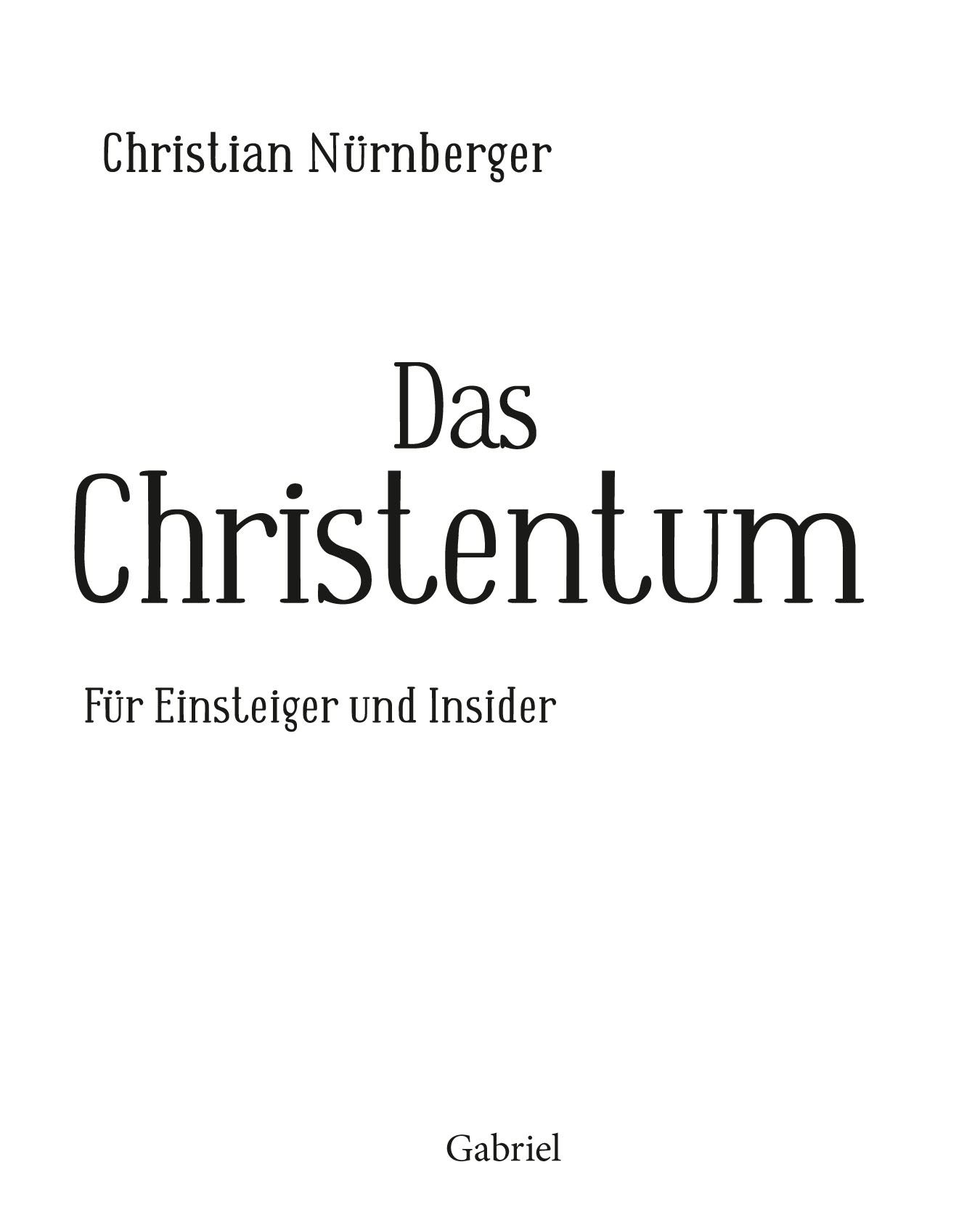Das Buch
Kann die christliche Botschaft heute noch Berge versetzen? Und was heißt eigentlich christlich?
Diesen spannenden Fragen spürt Bestsellerautor Christian Nürnberger nach und sucht nach dem eigentlichen Kern des Christentums. Er geht dafür zunächst zurück zu den Anfängen und deckt Stück für Stück auf, worin das Wesentliche und Einzigartige dieser Religion besteht.
Ein herausforderndes Buch sowohl für Glaubenseinsteiger als auch für Insider.
Der Autor

© privat
Christian Nürnberger (Jahrgang 1951) ist ein hochkarätiger Autor. Der Journalist studierte Theologie, arbeitete als Reporter bei der Frankfurter Rundschau, als Redakteur bei Capital, und als Textchef bei Hightech. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Für »Mutige Menschen – Widerstand im Dritten Reich« wurde er mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 ausgezeichnet. Seine Luther-Biografie »Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten« stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.gabriel-verlag.de
Viel Spaß beim Lesen!
Dieses Buch ist all den Randständigen und kirchlich Fernstehenden gewidmet, die mit Kirche und Christentum nichts mehr anfangen können, aber gerne wieder etwas anfangen würden.
Überm Dorf stand ein Regenbogen, und mein Vater sagte, ich solle mit einem Eimer zum Regenbogen rennen und die Farben einsammeln, die links und rechts heruntertropfen. Ich weiß nicht mehr, ob ich fünf, sechs oder sieben Jahre alt war damals, ich weiß nur: Ich holte einen Eimer und rannte zu dem Regenbogen, querfeldein, durch den Wald, über Äcker, Wiesen und Bahngleise, stundenlang, immer weiter, bis ich den Regenbogen plötzlich nicht mehr sah, und ich rund zehn Kilometer von zu Hause entfernt irgendwo an der Bahnstrecke zwischen Henfenfeld und Hersbruck dachte: Werden wohl die blöden Henfenfelder oder Hersbrucker schon alles eingesammelt haben.
Es dämmerte bereits. Die Mondsichel erschien am Himmel. Ich kehrte um, lief mit meinem leeren Eimer an der Bahnstrecke entlang bis Ottensoos, von dort wieder querfeldein nach Hause, es war schon lange dunkel, als ich die warme Stube betrat und den Eltern erzählte, woher ich komme. Da machte meine Mutter meinen Vater zur Sau.
Heute würde sich eine Mutter wahrscheinlich von dem Vater scheiden lassen, der so etwas tut.
Ich aber war ganz vergnügt, denn ich hatte ein schönes Abenteuer hinter mir und beschloss, beim nächsten Regenbogen mit allen Freunden viel schneller hinzurennen, um wirklich alle Farben einzusammeln, denn das größte Problem, das mich während meines Regenbogenmarsches beschäftigte, war die Frage, für welche Farbe ich mich entscheiden sollte mit meinem einzigen Eimer, denn ich wollte sie nicht vermischen.
Hatte ich denn gar keine Angst damals, so allein im dunklen Wald? Nein, hatte ich nicht. Ich war zwar als Kind eher unbehütet, vor allem unbeaufsichtigt, aber fühlte mich geborgen in meinem kleinen fränkischen Dorf. Heutige Kinder sind eher überbehütet und dauerbeaufsichtigt, aber oft ungeborgen. Das scheint mir der größte und für die Zukunft unseres Landes bedeutsamste Unterschied zu sein zwischen meiner Kindheit und heutigen Kindheiten.
Dass ich mich nicht fürchtete im dunklen Wald, hat damit zu tun, dass mir meine Mutter, eine einfache Bäuerin, drei Sorten von Geschichten erzählte: wahre, halbwahre und unwahre. Die unwahren Geschichten, das waren die Märchen. Sagen und Legenden über Heilige, die Nibelungen, Ritter und Helden zählten zu den halbwahren, aber die biblischen Geschichten, die waren wirklich wahr, denen konnte man glauben, denn das in ihnen Berichtete sei wirklich passiert, behauptete meine Mutter. Darum habe ich wirklich geglaubt, dass Jesus über Wasser laufen konnte, den Sturm gestillt, Kranke geheilt, Wasser in Wein verwandelt und Tote auferweckt hat.
Ich hörte diese wahren Geschichten auch im Kindergottesdienst und im Religionsunterricht. Eine öffentliche Bibliothek gab es nicht in dem Dorf, in dem ich aufwuchs. Auch noch kein Fernsehen. Mein Fernsehen waren diese Geschichten.
Auch mir wurde erzählt: Der liebe Gott sieht alles. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Müttern, die ihren Kindern damit ein Straf- und Aufpasser-Gottesbild einpflanzten, hat meine Mutter gesagt: Er muss alles sehen, damit er dich beschützen kann. Er sieht dann zwar auch, was du alles anstellst, aber erstens vergibt er dir, wenn du es hinterher bereust, und zweitens kann er bei kleinen Jungs auch mal fünfe gerade sein lassen. Kinder müssen lernen, und zum Lernen gehört, dass man Fehler macht, aus ihnen lernt man am meisten, und darum sollen Kinder sogar Fehler machen. Darum sind sie aber auch immer gefährdet, und deshalb muss der liebe Gott auf Kinder besonders gut aufpassen.
Der liebe Gott war mir daher tatsächlich ein lieber Gott, kein Kontrolleur, kein Angstmacher, sondern ein Beschützer, ein gütiger Großvater, mit dem ich ständig in Kontakt stand, und wortlos betend alles besprach, was es zu besprechen gab. Als der Vater eines Freundes von mir wegen eines Herzinfarktes ins Krankenhaus kam, betete ich für ihn. Erfolgreich. Der Mann blieb noch viele Jahre fröhlich am Leben, und immer, wenn ich ihm begegnete, dachte ich bei mir: Wenn du wüsstest, wem du das zu verdanken hast.
Dass Gott meine Existenz wollte, er mich mit meinem Namen kennt, auf mich schaut, und mit mir etwas vorhat, war für mich ein selbstverständliches Faktum, schließlich kennt er jeden Erdenwurm persönlich. Meine Mutter hat mir die Stelle in der Bibel gezeigt: Kein Spatz wird von Gott vergessen, und die Haare auf deinem Kopf sind gezählt, dein Schicksal lässt Gott nicht gleichgültig, deshalb kümmert er sich um dich, denn er hat einen Plan mit dir, und deine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, was der Plan ist, und dann danach zu leben.
Darum war ich ein vor Selbstbewusstsein strotzendes Kind, das keine Angst kannte – Furcht in konkreten Situationen schon, aber auch in solchen Situationen sagte ich mir: Du musst dich jetzt gar nicht besonders fürchten, denn entweder haut dich der liebe Gott hier raus, oder er braucht dich im Himmel, dann musst du halt jetzt sterben, das wird schon so schlimm nicht werden.
Einen Keiler, dem ich einmal allein im Wald begegnet bin, und der bedrohlich auf mich zukam, habe ich furchtlos mit einem Prügel vertrieben. Kläffende Hunde, die wütend auf mich zuschossen, brachte ich mit lautem Gebrüll, aber vor allem furchtlosem Auftreten zum Rückzug. Daher hatte ich auch keine Angst damals, als ich allein mit meinem Eimer durch den Wald zum Regenbogen lief.
Auch mein Vater war sorglos und dachte sich nichts dabei, als er mich zum Regenbogen schickte. Meine Eltern verschlossen nie die Haustür, wenn sie aufs Feld fuhren. In der Dorfschule, die ich besuchte, gab es keine abschließbaren Spinde, denn einem anderen den Anorak zu klauen, hätte sich nicht gelohnt. Wir waren alle gleichermaßen ärmlich angezogen. Die Gleichheit erzeugte Sicherheit.
Um sich sicher und geborgen zu fühlen, müssen einem die Menschen, mit denen man es zu tun hat, persönlich bekannt sein. Vertraute Klassenräume, vertraute Wege und Trampelpfade, auf denen man immer wieder denselben Menschen begegnet auf der Straße, den Feldern, in der Kirche, dem Fußballplatz, im Wirtshaus, in der Dorfschule. Ich war Teil einer überschaubaren, funktionierenden Gemeinde, einem kleinen Kosmos, der mir sinnvoll und geordnet erschien.
Ich vertraute darauf, dass Gott diese Welt gewollt und mit dieser Welt einen Plan hat. Ich vertraute darauf, dass unrechtes Tun spätestens vor dem göttlichen Weltgericht zur Sprache kommen wird, dass Menschen, die kein schönes Leben auf Erden haben, ein umso schöneres im Himmel haben werden, und sich nach dem Tod alle Verwandten, Freunde und Bekannten und auch die Tiere wiedersehen würden.
Die Kindheit verging, die Pubertät kam – und mit ihr die Fragen, die Zweifel, die Unsicherheiten, und auf einmal war von der alten Geborgenheit und dem alten Kinderglauben nichts mehr da. Lange habe ich dem verlorenen Glauben nachgetrauert, sogar Theologie studiert, um herauszufinden, ob ein erwachsener Glaube möglich sei, mit dessen Hilfe die Geborgenheit hinübergerettet werden kann ins Erwachsenenleben.
Schon im ersten Semester lernte ich: Das mit den Wundern – Verwandlung von Wasser in Wein, fünf Brote und zwei Fische machen Tausende satt, eine drei Tage alte Leiche wird wieder lebendig: alles nicht wahr. Abraham? Hat wahrscheinlich nie gelebt. Jungfrauengeburt? Eine in der Antike weit verbreitete Mythe, eine Art Mindeststandard für besondere Menschen, Gottessöhne, Halbgötter oder Götter. Da mussten die Christen mithalten, um bei den Heiden zu punkten. Und die Auferstehung? Nun ja, es ist kompliziert.
Es war ein Schock, und er hatte einen Namen: Rudolf Bultmann, der die »wahren Geschichten« meiner Mutter »erledigt« hatte. Die Höllen- und Himmelfahrt Christi: erledigt. Die Wunder: erledigt. Erledigt auch die Vorstellung von einer unter kosmischen Katastrophen hereinbrechenden Endzeit, erledigt die Erwartung des auf den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes, erledigt der Geister- und Dämonenglaube.
Als Bultmann diese Hammer-Thesen im Jahr 1941 erstmals vorgetragen hatte, blieb noch alles ruhig. Man war im Krieg. Als er sie 1957 wiederholte, wäre beinahe er erledigt worden. Einer Verurteilung durch die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) entging Bultmann nur knapp. Danach setzte er sich durch. Seine These, dass die biblischen Geschichten in das Kleid des Mythos gehüllte Glaubensaussagen seien, ist heute eine theologische Selbstverständlichkeit, an der kein wissenschaftlicher Theologe vorbeikommt.
Während jenes Erstsemesters Theologie hatte mich meine Mutter plötzlich gefragt: Und? Was ist jetzt mit den biblischen Geschichten? Stimmen sie?
Nein, sagte ich.
Ach, hab ich es mir doch gleich gedacht, sagte sie mit einer wegwerfend-resignierenden Handbewegung. Dann fragte sie: Warum studierst du dann weiter? Und warum trittst du nicht aus der Kirche aus?
Weil es so einfach auch wieder nicht ist, antwortete ich, und erzählte ihr vom Theologen Gerd Lüdemann, der behauptet hatte, Jesus sei in seinem Grab verwest wie jede andere Leiche. Und dass dieser Theologe die gleiche Frage stellte: Wenn er recht hätte – könnten wir noch Christen sein?
Und geantwortet hatte: Ja, Christen könnten Christen bleiben, auch wenn sie »nicht an die Wiederbelebung eines Leichnams glauben«. Dem Christen helfe, »wenn er fortan vom wenigen lebt, was er wirklich glaubt, nicht vom vielen, was zu glauben er sich abmühen musste«.
Na, das ist aber ein kümmerlicher Rest, sagte meine Mutter. Darauf kann ich dann auch verzichten.
Meine Professoren jedoch behaupteten fröhlich und unerschütterlich, auch nach Bultmann, ja sogar wegen Bultmann besser an Jesus glauben zu können als zuvor, denn nun erst komme »die eigentliche Wahrheit hinter den Mythen« zum Vorschein.
Ja, und was, zum Beispiel, ist dann die eigentliche Wahrheit des Brotwunders?
Nach Lektüre Dutzender Predigten, Deutungen und Interpretationen drängte sich mir der Eindruck auf: Es läuft aufs Lied vom Teilen hinaus – Brot für die Welt. Bedarf es dafür wirklich noch der Mär vom Brotwunder?
Die Schöpfer dieser Nun-teilt-mal-schön-Theologie nahmen auch immer sehr schnell die Kurve von der leiblichen zur geistlichen Speise und zu der Einsicht, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebe. Nur: Viele Geschichten handeln von der geistlichen Speise, die Geschichte vom Brotwunder aber gerade nicht. Ganz massiv und materialistisch handelt sie davon, dass der Mensch vom Wort allein auch nicht leben kann. Darum braucht er Brot. Es gibt immer genug davon, aber nicht immer für alle, weil die einen zu viel, die anderen zu wenig und viele gar nichts haben. Das, so legt das Brotwunder nahe, solle der Mensch ändern. Er soll für Verteilungsgerechtigkeit sorgen.
Die »Wahrheit dahinter« läuft also auf die allgemeine Vernunft hinaus. Dafür aber braucht es keine Mythen mehr. Wir, die Menschen, haben die Wunder zu vollbringen, von denen die Bibel erzählt. Und so beschloss ich, mein Theologiestudium abzubrechen und hinfort als fröhlicher Agnostiker weiterzuleben.
Bis ich im Lauf der Jahre merkte, dass ich von dem »kümmerlichen Rest« gut lebte, angstfrei und selbstbewusst, geborgen, frei und sicher, und in dem Bewusstsein, über einen inneren Kompass zu verfügen, der es mir ermöglicht, mich zu orientieren, die Geister zu scheiden, mir ein sicheres Urteil zu bilden.
Inzwischen bin ich überzeugt: Der scheinbar kümmerliche Rest ist ein Goldklumpen. Die Zukunft der Welt hängt davon ab, ob es weiterhin genügend Menschen geben wird, die von dem wenigen leben, was sie wirklich glauben, und nicht von dem vielen, was zu glauben sie sich abmühen müssen, denn dieses wenige ist das Eigentliche des christlichen Glaubens. Dieses wenige bewahrt vor Fundamentalismen aller Art. Dieses wenige ermöglicht den Christen das Gespräch mit Atheisten, Agnostikern und mit Anhängern der anderen Religionen. Dieses wenige ist lebensrettend und birgt einen Überlebenscode. Von diesem wenigen handelt dieses Buch.
Das Fundament
des
Christentums
Das Alte Testament
Das Christentum beginnt mit Jesus. Aber Jesus war Jude. Was der Jude Jesus predigte, wurzelte in einer Religion, die zu Lebzeiten Jesu schon 1200 Jahre alt war. In allem, was Jesus lehrte, tat und sagte, berief er sich auf die Schrift, das Gesetz, Mose und die Propheten. Alles zusammen ergab den Tanach, die jüdische Bibel, unser sogenanntes Altes Testament, dessen Textmenge rund drei Viertel der gesamten christlichen Bibel einnimmt – eine Bezeichnung, die suggeriert, dass das Alte Testament nicht mehr richtig gilt, von Jesus und dem Neuen Testament abgelöst und überwunden wurde und ein prinzipieller, unüberwindbarer Gegensatz zwischen beiden Testamenten besteht.
Diesen Gegensatz gibt es nicht, wie noch gezeigt wird. Jesus wollte das Alte Testament nicht überwinden, sondern erfüllen. Einige Theologen, wie etwa der Münsteraner Alttestamentler Erich Zenger, halten daher die Adjektive »alt« und »neu« für unglücklich gewählt, weil das Neue eine ungerechtfertigte Abwertung des Alten impliziere. Daher spricht Zenger lieber vom »Ersten« und »Zweiten Testament« und verlangt, zumindest das Alte Testament doch besser als jüdische oder hebräische Bibel zu bezeichnen.
Jesus wollte keine Kirche gründen, sondern seine jüdischen Landsleute an ihren von Gott gegebenen Auftrag erinnern. Er kritisierte die in Israel herrschenden Zustände, das Establishment und eine religiöse Praxis, die den eigentlichen Sinn dessen, was geschrieben steht, verfehlte.
Jesus war es immer nur darum gegangen, der Stimme des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs Gehör zu verschaffen in Israel. Die Griechen und Römer interessierten ihn nicht. Dass ein Paulus kommen und seine Botschaft den Heiden bringen und im ganzen Römischen Reich verbreiten würde, damit konnte Jesus nicht rechnen. Er hat eher so etwas wie das Ende der Welt erwartet. Die Absicht, Urheber eines Neuen Testaments zu werden, lag ihm fern. Er kannte nur ein Testament, den Tanach, die Bibel der Juden.
Auch wenn Paulus und die Evangelisten die stereotype Formel wie es geschrieben steht verwendeten, meinten sie den Tanach. Bis ins zweite nachchristliche Jahrhundert hinein war er die Bibel der Urchristen. Und als diese ihr eigenes genuin christliches Gedankengut zu Papier brachten, merkten sie: Ohne die Bibel der Juden geht das ja gar nicht. Darum nahmen sie den Tanach als Altes Testament in die christliche Bibel mit hinein. Dabei trafen sie eine wichtige Entscheidung: Sie ließen die jüdischen Texte unangetastet. Sie nahmen nichts heraus, fügten nichts hinzu und schrieben nichts um, denn sie wussten sehr genau, auf welchem Fundament sie standen.
Aus diesem Grund beginnt dieses Buch über das Christentum nicht mit Jesus, sondern mit Abraham. In ihm liegt der Anfang des roten Fadens jener großen Erzählung, die man den christlichen Glauben nennt.
Aber genauer müsste es heißen: In Abraham liegt der Anfang von drei roten Fäden – ein jüdischer, ein christlicher und ein muslimischer. An diesen drei Fäden wird seit Jahrhunderten gesponnen, und oft haben sie sich bis auf den heutigen Tag zu einem unentwirrbaren Knäuel aus Schuld und Gewalt verstrickt, von Anfang an, wie wir noch sehen werden. Dabei wäre es so einfach, das Knäuel zu entwirren, wenn alle genau hinhören würden auf das, was dieser Gott Abrahams uns bis auf den heutigen Tag zu sagen versucht.
Daher beginnt unsere Suche nach »der Wahrheit dahinter« mit Abraham, konzentriert sich aber im weiteren Verlauf auf den christlichen roten Faden der Geschichte.
Abraham – Stammvater des Glaubens
Und der Herr sprach zu Abram: Gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. (1 Mose 12, 1-3)
Es sind seltsam lapidare Worte, die überhaupt nicht wie ein Paukenschlag der Weltgeschichte klingen, und doch sind sie es, ein Paukenschlag. Weil sie aber nicht so klingen, liest man leicht über die Tatsache hinweg, dass diese Worte den Anfang dreier Weltreligionen markieren. Abraham, der Stammvater des christlichen Glaubens ist zugleich der Stammvater des jüdischen und islamischen Glaubens.
Man ist auch nicht darauf gefasst. Wer sich vornähme, die Bibel vom Anfang bis zum Ende zu lesen, hätte in den ersten elf Kapiteln, die Abraham vorausgehen, die Urgeschichte erfahren: die Schöpfung, Adam und Eva, der Sündenfall, Kain und Abel, Noah und die Sintflut und zuletzt der Turmbau von Babel. Von Abraham, der zu Beginn noch Abram heißt, ist hier mit keinem Wort die Rede.
Erst nach der Turmbaugeschichte wird er plötzlich eingeführt, fast eingeschmuggelt, und zwar mithilfe einer der in der Bibel sehr beliebten, aber den Leser mit gähnender Langeweile erfüllenden Stammbäume von der Art: Dies sind die Geschlechter Tharahs: Tharah zeugte Abram, Nahor und Haran. Aber Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Tharah in seinem Vaterlande zu Ur in Chaldäa. Da nahmen Abram und Nahor Weiber. Abrams Weib hieß Sarai, und Nahors Weib Milka, Harans Tochter, der ein Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. (1 Mose 11, 27-30)
Warum jetzt schon wieder aufgezählt werden muss, wer seit Adam und Eva wen gezeugt hat – das erste Mal wurde es im fünften Kapitel aufgelistet –, erschließt sich einem modernen, ungeduldigen und der Bibel unkundigen Leser nicht unmittelbar. Doch diese Stammbäume haben eine eminent wichtige Funktion, denn sie halten die ganze Bibel zusammen. Sie sollen die Kontinuität in der Geschichte zwischen Gott und seinem Volk vom Anfang der Schöpfung bis zum Weltende erweisen.
Die erste Generationenliste zeichnet eine direkte Linie von Adam zu Noah.1 Die zweite, jetzt in Kapitel elf eingestreute Aufzählung, knüpft an Noahs Sohn Sem an und setzt die Reihe fort bis zu Abraham, woraus sich eine lückenlose Folge von Adam zu Abraham ergibt. Das ist wichtig für den späteren Verlauf, denn von Abraham führt dann die Linie weiter zu David, und für die Christen mündet sie in Jesus, den Messias. Darum finden wir bei den Evangelisten die Stammbäume Jesu. Die Juden warten noch auf ihren Messias, aber auch er soll aus Davids Geschlecht stammen und also über Abraham bis auf Adam zurückgehen.
Langweilig und wenig informativ, wie es anfängt, geht es weiter. Über Abraham erfahren wir nur, dass er in der Stadt Ur im Land Chaldäa geboren wurde und noch zwei Brüder hatte, Nahor und Haran. Letzterer zeugte Lot. Der Vater der drei Brüder hieß Tharah. Er entschließt sich eines Tages, aus Ur wegzuziehen nach Kanaan, bleibt dann aber in Haran hängen. Gründe für diesen Entschluss werden nicht genannt, es geschieht einfach. Warum der Clan in Haran bleibt und nicht nach Kanaan weiterzieht, wird ebenfalls nicht mitgeteilt.
Ur lag ganz im Süden Mesopotamiens am Persischen Golf und war damals ein überregional bedeutendes Kultzentrum des Mondgottes. Haran lag 800 Kilometer weiter nördlich, ungefähr an der heutigen türkischen Südgrenze, und war ebenfalls ein Kultzentrum des Mondgottes.2 Was an Haran besser war als an Ur, erfahren wir nicht, aber Tharah, Abrahams Vater, scheint zufrieden gewesen zu sein, denn er bleibt dort, bis er stirbt.
Auch Tharahs Söhne mit ihren Frauen, Kindern, Knechten, Mägden und Herden bleiben dort. Dann aber kommt es zu jenem Und Gott sprach zu Abraham …
Lapidar wird weiter erzählt:
Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber ward fünfundsiebzig Jahre alt, da er aus Haran zog. Also nahm Abram sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran; und zogen aus, zu reisen in das Land Kanaan. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land, zog Abram durch bis an die Stätte Sichem und an den Hain More; es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. (1 Mose 12, 4-6)
Gott hatte sich also Abraham offenbart. Später werden wir hören, dass auch Jakob, Abrahams Enkel, eine Gotteserscheinung hatte. Und schließlich offenbart sich Gott auch dem Mose im brennenden Dornbusch. Deshalb nennt man Judentum, Christentum und Islam Offenbarungsreligionen.
Aber begründet, erläutert, erklärt wird nichts. Wozu braucht Gott überhaupt ein Volk? Warum gerade Abraham? Wäre es nicht erfolgversprechender gewesen, sich dafür einen ägyptischen Pharao zu nehmen, einen babylonischen König, einen römischen Feldherren, einen keltischen oder germanischen Fürsten, einen griechischen Philosophen, einen indischen Weisen, einen chinesischen Mandarin, einen südamerikanischen Indianerhäuptling oder einen afrikanischen Krieger? Warum ausgerechnet einen alten mesopotamisch-babylonischen Halbnomaden, der irgendwo zwischen Euphrat und Tigris seine Schafe hütet, und der sich, wie man im Fortgang der Geschichte erfährt, weder als besonders gut erweist noch als besonders heldenhaft oder stark? Einen einfachen, nicht sehr gebildeten Durchschnittsmenschen aus dem sumerisch-babylonischen Kulturraum und seine Frau Sarai, die später Sara heißen wird und von der wir erfahren, dass sie unfruchtbar sei, erwählt sich Gott als Stammeltern seines künftigen Gottesvolks. Warum nur? Was soll das für einen Sinn ergeben?
Und wieso kann Abraham nicht bleiben, wo er ist? Warum soll er seine Heimatstadt Haran verlassen und nach Kanaan ziehen, das längst besiedelt ist? Seine Nachkommen hätte er auch in Haran zeugen können. Und für deren Zukunft hätte er in seiner angestammten Heimat besser sorgen können als irgendwo in der Fremde.
Abraham wird von den Theologen zeitlich ungefähr um das Jahr 1800 vor Christus angesiedelt, obwohl das umstritten ist, darauf kommen wir noch, aber nehmen wir einmal an, die Zeitangabe stimmt: Warum hat sich Gott so viel Zeit gelassen mit seiner Offenbarung? Warum ist er nicht schon einem Sumerer oder Ägypter im vierten oder dritten Jahrtausend erschienen? Vielleicht wäre ja die Menschheit heute ein gutes Stück weiter, wenn sich Gott zweitausend Jahre früher offenbart hätte.
Auf keine dieser naheliegenden Fragen erhalten wir im weiteren Verlauf der Geschichte eine Antwort. Stattdessen wiederholt der Erzähler, was wir schon kennen:
Da erschien der HERR dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem HERRN, der ihm erschienen war. Darnach brach er auf von dort an einen Berg, der lag gegen Morgen von der Stadt Beth-El, und richtete seine Hütte auf, dass er Beth-El gegen Abend und Ai gegen Morgen hatte, und baute daselbst dem HERRN einen Altar und predigte von dem Namen des HERRN. Darnach zog Abram weiter und zog aus ins Mittagsland. (1 Mose 12, 7-9)
Und so geht das nun ein Vierteljahrhundert weiter. Abraham zieht kreuz und quer durch das Land zwischen Euphrat und Tigris, auch mal – wegen einer Hungersnot – an den Nil nach Ägypten hinunter, dann wieder zurück nach Kanaan, baut hier einen Altar und dort einen Altar, trennt sich von Lot, hat seltsame Begegnungen mit dem ägyptischen Pharao und dem König Melchisedek, hört von einer kleinen Schwulen- und Inzestgeschichte im Zusammenhang mit Lot, sieht Sodom und Gomorra untergehen und Lots Frau zur Salzsäule erstarren, redet wenig, fragt nicht, und ab und zu taucht plötzlich Gott auf und verheißt ihm Land und viele Nachkommen, nur: Es passiert nicht. Abraham wird alt und immer älter und kommt weder zu Land noch zu einem einzigen Sohn.
Ein Vierteljahrhundert lang wird nicht ersichtlich, wozu dieses nicht ungefährliche Umherziehen in der Fremde gut sein soll und warum es nicht besser gewesen wäre, in der vertrauten sicheren Heimat zu bleiben. Als Abraham 99 Jahre alt ist, verspricht ihm Gott zum fünften Mal Land und Nachkommen, und da fiel Abram auf sein Angesicht und lachte, und sprach in seinem Herzen: Soll mir, hundert Jahre alt, ein Kind geboren werden, und Sarai, neunzig Jahre alt, gebären? (1 Mose 17, 17)
Kurze Zeit später, bei der sechsten Verheißung, ist es Sara, die lacht. Gott erscheint Abraham in Gestalt dreier fremder Besucher, die ihm erzählen, spätestens in einem Jahr werde Sara einen Sohn gebären. Sara, die das heimlich hinter der Tür lauschend hört, lachte bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen, und mein Herr ist auch alt? (1 Mose 18, 12)
Anfangs schien Abraham Gott blind vertraut zu haben, sonst hätte er nicht seine sichere Heimat verlassen, um ins Ungewisse zu ziehen. Als aber rasche Erfolge – Nachkommen und Land – ausblieben, kamen ihm Zweifel, und er äußerte diese Zweifel auch Gott gegenüber, sprach von seiner Sorge, einen Fremden als Erben einsetzen zu müssen. Gott antwortet darauf mit dem berühmten Wort: Siehst du die Sterne am Himmel? So viele Nachkommen sollst du haben. (1 Mose 15, 5)
Daraufhin, so heißt es in der Bibel, glaubte Abraham dem Herrn, und es folgt der seltsame Satz: Das rechnete er (Gott) ihm als Gerechtigkeit an. (1 Mose 15, 6)
Sara hingegen schien den göttlichen Verheißungen von Anfang an nie richtig getraut zu haben und mit den Jahren immer skeptischer geworden zu sein. Zehn Jahre nach der ersten Verheißung, Abraham ist fünfundachtzig, schlägt Sara Abraham vor, es doch mit ihrer Magd Hagar zu probieren, damit wenigstens sie vielleicht einen Erben und Nachkomme gebäre – nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit, die Monogamie war noch nicht erfunden und die Zeugung eines Sohnes mit einer Magd oder Nebenfrau eine willkommene, durchaus übliche Lösung des Problems. Abraham lässt sich darauf ein, und tatsächlich gebärt Hagar einen Sohn, der den Namen Ismael erhält. Abraham ist jetzt sechsundachtzig Jahre alt.
Man sollte meinen, Gott wäre böse darüber, dass Abraham und Sara ihn offenbar nicht ernst nehmen, seinen Verheißungen misstrauen und ihr Schicksal kurz entschlossen selber in die Hand nehmen. Man erwartet, dass Gott jetzt irgendwie strafend eingreift. Aber kein Wort davon.
Stattdessen wird so getan, als stimme das, was Abraham und Sara da aushecken, mit dem Willen Gottes überein. Hagar erschien sogar ein Engel des Herrn, der seltsame Worte zu ihr sprach: Ich will deinen Samen also mehren, dass er vor großer Menge nicht soll gezählt werden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, des Namen sollst du Ismael heißen, darum dass der Herr dein Elend erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein: seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und wird gegen alle seine Brüder wohnen. (1 Mose 16, 10-12)
Sara jedoch bleibt weitere dreizehn Jahre kinderlos. Darum lachen Abraham und Sara, als Gott zum fünften und sechsten Mal sagt, dass Sara jetzt in hohem Alter, lange nach der längst erfolgten Menopause, noch schwanger werden solle.
Aber diesmal ist einiges anders. Gott spricht sehr feierlich von einem »ewigen Bund« zwischen ihm und Abraham und dessen Nachkommen. Darum soll Abram, wie er immer noch heißt, ab jetzt Abraham heißen und aus Sarai soll Sara werden. Dann kommt von Gott noch die merkwürdige Anweisung, zum Zeichen des Bundes zwischen ihm und Abraham samt Nachkommen solle dieser alles, was männlich ist, beschneiden.
Ihr sollt die Vorhaut an eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ein jegliches Knäblein, wenn’s acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Beschnitten werden soll alles Gesinde, das dir daheim geboren oder erkauft ist. Und also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bund. Und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum dass es meinen Bund unterlassen hat. (1 Mose 17, 11-14)
Abraham befolgt diese Anweisung, beschneidet alle männlichen Mitglieder seines Clans, auch Ismael, und ein knappes Jahr später, quasi zu seinem hundertsten Geburtstag, schenkt ihm Sara den lang ersehnten Sohn, Isaak. Nun könnte endlich alles gut werden, denkt man, Sara könnte glücklich sein, Hagar könnte sich für Sara freuen, dass sie nun auch einen Sohn hat, und Abraham könnte sich freuen, dass er zwei Söhne hat.
Aber so geht es gewöhnlich nicht zu unter Menschen, auch nicht bei jenen von Gott höchstselbst Auserwählten, aus denen er sein Volk gewinnen will. Sara und Hagar rivalisieren, seit Hagar von Abraham geschwängert wurde. Zwar war es Saras eigene Idee, ihrem Mann die Magd zuzuführen, damit wenigstens sie gebäre, aber als sie dann tatsächlich schwanger war, fühlte sich Hagar Sara überlegen, begegnete ihr mit einem gewissen Stolz und Hochmut, und Sara beschwerte sich über sie bei Abraham. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tue mit ihr, wie dir’s gefällt. Da sie nun Sarai wollte demütigen, floh sie von ihr. (1 Mose 16, 6)
Erst auf Geheiß eines Engels kehrt Hagar aus der Wüste zu Sara in Abrahams Haus zurück, aber die Spannungen zwischen den beiden Frauen bleiben bestehen und verstärken sich vermutlich noch, als Isaak zur Welt kommt. Jetzt, da Sara geboren hat, will sie Hagar und deren Sohn loswerden und verlangt von Abraham, Hagar und Ismael, seinen erstgeborenen Sohn, vom Hof zu jagen.
Und was tut Abraham, Gottes Auserwählter? Bringt er Sara zur Vernunft? Sagt er ihr, sie solle sich zusammenreißen und anständig verhalten gegenüber der Mutter seines ersten Sohnes? Saras Ansinnen gefällt ihm nicht, aber er gibt nach, schickt Hagar und Ismael in die Wüste, völlig im Klaren darüber, dass Mutter und Sohn dort umkommen werden. Und hat ein gutes Gewissen, da sich auch sein Gott einverstanden erklärte.3
Da zog sie hin und ging in der Wüste irre bei Beer-Seba. Da nun das Wasser in dem Schlauch aus war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von fern, einen Bogenschuss weit; denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen des Knaben Sterben. Und sie setzte sich gegenüber und hob ihre Stimme auf und weinte. (1 Mose 21, 14-16)
Gott selbst muss nun rettend eingreifen und die beiden vor dem Verdursten in der Wüste bewahren. Er schickt einen Engel, der Hagar an einen Brunnen führt und ihr abermals verheißt, Ismael zu beschützen und ein großes Volk aus ihm zu machen. Und das geschieht auch: Gott war mit dem Knaben; der wuchs und wohnte in der Wüste und ward ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Pharan, und seine Mutter nahm ihm ein Weib aus Ägyptenland. (1 Mose 21, 20-21)
Das ist auch wieder seltsam. Hagar als eine Art Leihmutter für Abraham einzusetzen, war Saras Idee, aber nun übernimmt Gott die Sorge und die Verantwortung für Hagar und Ismael. Wir erfahren nicht, warum, aber Ismael wird zum Stammvater der Muslime. Die Araber leiten ihre Herkunft von Ismael ab, der wie der biblische Jakob zum Vater von zwölf Stämmen wird.4
Laut Koran gründete Ismael mit Abraham zusammen das Heiligtum der Kaaba in Mekka5, empfing Offenbarungen6 und gebot seinem Volk als ein Gesandter und Prophet Gottes das Gebet (Salat) und die Almosengabe (Zakat)7. Der Wüstensohn Ismael kehrt noch einmal in seine alte Familie zurück, als Abraham stirbt. Gemeinsam mit Isaak begräbt er ihn. Danach spielt er in der Bibel keine Rolle mehr und bleibt ein rätselhafter Sohn Abrahams.
Aber dieses Rätsel verblasst gegenüber jener berühmt-berüchtigten Geschichte, die dann folgt. Gott verlangt von Abraham: Opfere deinen Sohn, den einzigen, den, den du liebst, den Isaak. Abraham gehorcht. Erst im letzten Moment, als Abraham schon das Messer erhoben hat, gebietet ihm ein Engel, Isaak am Leben zu lassen und an seiner Stelle einen Widder zu opfern, der sich im Gestrüpp verfangen hat.
Vor allem diese gemeinhin als Glaubensprobe geschilderte Geschichte ist es, die uns Menschen des 21. Jahrhunderts die sowieso schon fremde Figur des Abraham noch fremder werden lässt. Abrahams Gehorsam mutet uns als Kadavergehorsam an. Gottes ungeheuerliches Ansinnen erscheint uns als das Ansinnen eines grausamen Gottes, mit dem wir nichts zu tun haben wollen, auch wenn er am Ende auf die tatsächliche Einforderung des Opfers verzichtet. Für uns bleibt der Eindruck haften: Abraham hätte, wenn Gott nicht in letzter Sekunde dazwischengegangen wäre, seinen eigenen Sohn geschlachtet.
Damit erscheint uns Abraham nicht als Vater, sondern als Monster oder, wie der Philosoph und Publizist Rüdiger Safranski es einmal ausgedrückt hat, als »erster Faschist«, als Stammvater des Totalitarismus – und seit der Zerstörung des World Trade Center in New York am 11. September 2001 auch als Stammvater der fanatischen islamistischen Terroristen. Sie scheinen aus demselben Holz geschnitzt zu sein wie Abraham. Und ausgerechnet so einen macht Gott zum Stammvater der Juden, Christen und Muslime. Warum nur? Wir müssen noch einen langen Weg gehen, um die Antwort auf diese Frage zu verstehen (siehe Kapitel »Alles oder nichts …«).
Vor dieser Frage verblasst auch das dritte Rätsel der Abrahamsgeschichten: Sie beginnen mit einem grandiosen Versprechen – Nachkommen wie Sterne am Himmel, und das ganze Land Kanaan dazu. Als aber Sara stirbt, hat Abraham nur Isaak und nennt keinen einzigen Quadratmeter Land sein Eigen. Um Sara zu begraben, muss er von einer kanaanitischen Familie für vierhundert Lot Silber einen Acker kaufen mit einer Höhle darin für Saras Grab (1 Mose 23, 17).
Danach heiratet Abraham noch einmal. Ketura heißt seine zweite Frau, und mit ihr bekommt er weitere sechs Söhne.8 Aber nur Isaak, der Sohn, den er von Sara hat, ist Träger des göttlichen Segens. Die anderen werden für die Juden und Christen so unwichtig wie Ismael.
Als Abraham stirbt, wird er in Saras Grab beigesetzt. Mehr als dieses Grab, den einen Acker und seine Viehherden hat Abraham seinem Sohn Isaak, dem Träger des göttlichen Segens, nicht zu vererben. Auch sonst hinterlässt Abraham nichts, woran sich seine Nachkommen halten könnten, keine Anweisungen fürs tägliche Leben, keine zitierbaren Sprüche, kein Gesetz, keine Regel, kein Heiligtum, keinen Tempel, das alles kommt erst sehr viel später. Abraham bleibt uns erhalten als der erste Mensch, dem sich Gott offenbarte. Das muss offenbar genügen.
Abraham ist der Stammvater des Glaubens dreier Weltreligionen, aber worin sein Glaube eigentlich besteht und was seine Wahrheit ist, erfahren wir nicht.
Der erste Systemkritiker
Und Gott sprach zu Abraham – das steht einfach so in der Bibel. Aber wie ist es dabei eigentlich zugegangen? Abraham, oder wer auch immer später den anderen erstmals von diesem Gott erzählte, wird ja wohl kaum eine geheimnisvoll raunende Stimme aus dem Off gehört haben. Er wird es vermutlich auch nicht bloß geträumt haben, und wenn er eine Vision gehabt haben sollte, so kann das, werden Skeptiker einwenden, auch die pure Einbildung oder das Hirngespinst eines von einem religiösen Wahn Befallenen gewesen sein.
Naiv Gläubige antworten darauf mit schwer zu widerlegender Stringenz: Wo ist das Problem? Wenn in der Bibel steht, Gott habe zu Abraham gesprochen, dann hat er eben zu Abraham gesprochen, und dass Gott heute offenbar nicht mehr akustisch hörbar zu Menschen spricht, ist kein Beweis dafür, dass er es damals nicht getan hat. Er sprach eben nur ein Mal, vor rund vier Jahrtausenden. Es muss uns nun genügen, dass diese Geschichte seitdem bis auf den heutigen Tag immer weiter erzählt wird.
Die Theologen und Schriftgelehrten, obwohl offen oder insgeheim davon überzeugt, dass es auch zu Abrahams Zeiten schon ganz natürlich zuging auf der Erde und Abraham keine Stimme aus dem Off gehört hat, vermeiden konkrete Aussagen. Lieber lenken sie den Blick auf Jakob und Mose, denen sich Gott ebenfalls – wie auch immer – offenbart hatte, und zu guter Letzt auf Jesus, durch den Gott uns seinen eigenen Sohn geschickt hat und den er für uns hat sterben lassen, was ja wohl unter allen denkbaren Formen der göttlichen Ansprache an die Menschen die stärkste sei.
Dass auch diese Argumentation bereits Glauben voraussetzt, zumindest die Bereitschaft, das Verhältnis Jesu zu seinem Gott als Sohnschaft und sein Sterben als Sterben für uns zu deuten, wird dabei gerne unterschlagen. Aus der Bedingung des Glaubens, ein bestimmtes Geschehen als Handeln Gottes zu interpretieren, führt das nicht heraus, und letztlich mündet alle Theologie dann doch wieder in einen Satz, den die naiv Gläubigen auch unterschreiben können: Abraham, Isaak, Jakob, Mose, die Propheten und Jesus glaubten Gott, und darum können wir ihnen auch glauben. Oder müssen. Oder sollen.
Wenn wir dann aber fragen, warum wir glauben sollen, und wie es denn bei den jeweiligen Gottes-Offenbarungen oder -Erscheinungen wirklich zugegangen sei, weichen die Theologen einer Antwort weiträumig aus und flüchten in die unverbindliche Metapher, Abraham und die anderen hätten Gottes Ruf vernommen. Und überlassen es der Fantasie ihrer Zuhörer, sich dabei irgendetwas vorzustellen. Danach flüchten die Theologen rasch aus dem verminten Gelände ins sichere Gebiet ihrer Gelehrsamkeit, von wo aus sie den biblischen Text in seine verschiedenen Schichten zerlegen, ausführlich über die Entwicklung des Begriffs der Offenbarung dozieren und die Sache so gründlich in religionsgeschichtliche, alttestamentliche, jüdische, neutestamentliche, christliche und christologisch-dogmatische Aspekte zerpflücken, bis ihre Zuhörer alles wissen, was sie nie wissen wollten, und ihre ursprüngliche Frage vergessen haben.
Was also machen wir mit dem Und Gott sprach zu Abraham? Nehmen wir einmal an, es sei alles ganz natürlich zugegangen, Abraham habe keine Stimme aus dem Off und auch sonst nichts vernommen. Warum ist er dann aus seiner Heimat fortgegangen und hat seinen Nachkommen seltsam unbestimmte Geschichten von einem neuen seltsam unbekannten Gott hinterlassen? Kann Abrahams Handeln ohne die Hypothese Gott erklärt werden? Kann Abraham heute noch religiösen Skeptikern nahegebracht werden, für die Gott nur ein Wort für etwas ist, über das man nichts wissen kann?
Ja, das geht. Man kann Abraham auch ohne den Rückgriff auf eine akustisch vernehmbare göttliche Stimme erklären und begründen, warum dieser orientalische Ziegenhirt auch dann eine zentral wichtige Figur des Abendlands bliebe, wenn es Gott nicht gäbe.
Abraham – egal ob als literarische Figur oder historische Person – lebte zwischen 2000 und 1800 vor Christus in der sehr alten Kulturlandschaft Mesopotamiens. Das Rad war schon seit dreitausend Jahren erfunden, ebenso der Pflug, von Ochsen gezogen. Seit dreieinhalb Jahrtausenden beherrschten und verfeinerten die sesshaften Bauern Mesopotamiens die Bewässerungstechnik. Seit zweitausend Jahren wurde Wein angebaut. Seit eintausendachthundert Jahren kannte man die Schrift, konnte man rechnen, messen, wiegen, sich an den Sternen orientieren. Zuweilen trieb Abraham seine Kühe, Schafe, Ziegen und Esel an Tempelruinen vorbei, die damals schon so alt waren, wie die griechisch-römischen Ruinen heute.
Sumerer, Ägypter, Babylonier, Assyrer und Hethiter hatten in dieser Landschaft ihre Spuren hinterlassen. Große Reiche, Feldherren und Könige hatte das Land schon aufsteigen und wieder untergehen sehen, die verschiedensten Götterkulte erlebt und im Lauf der Zeit einen großen Schatz von Mythen, mündlichen und schriftlichen Erzählungen, Dichtungen, Gesetzestexten und religiösen Riten angesammelt. Abraham war weder Priester noch Schriftgelehrter und kannte daher vermutlich nur einen Bruchteil davon, hatte aber aus seinem kulturellen Umfeld genug aufgesogen, um sich eigene Gedanken zu machen, Antworten zu suchen auf Fragen, die ihn ein Leben lang beschäftigten.
Als Halbnomade, der am Rande der großen Stadt lebte, nicht mehr ganz zu den Nomaden gehörte, aber auch noch nicht richtig zu den Sesshaften, der immer pendelte zwischen der Stadt und der Weide, der Kulturlandschaft und der Wüste, hatte er Distanz zu beiden Lebensweisen. Dieser Abstand ermöglichte ihm vielleicht eine bessere Wahrnehmung des Ganzen, einen schärferen Blick auf die Realität, als man ihn hat, wenn man irgendwo mit Haut und Haar dazugehört und mitten im Getümmel steckt.
Abrahams distanzierter Blick auf seine Welt mündete in ein großes Unbehagen, das Gefühl, dass irgendetwas seit urdenklichen Zeiten gründlich schiefläuft. Herrschen oder Beherrschtwerden, Hammer oder Amboss sein, der Mensch als des Menschen Wolf, dies scheint seit Urzeiten das Gesetz des Lebens auf diesem Planeten zu sein. Gibt es keine Alternative dazu? Nichts Drittes? Warum können Menschen nicht dauerhaft in Frieden miteinander leben? Warum beginnen so viele Geschichten verheißungsvoll und enden in Rivalität, Lüge, Betrug, Hass, Neid, Missgunst, Raub, Vergewaltigung, Mord und Totschlag? Warum lebt der eine gesund in Reichtum und Überfluss, während der andere arm und krank in Not und Elend vor sich hin vegetiert?
Könige garantieren Ordnung, schützen den Schwachen vor dem Starken, aber lassen sich das teuer bezahlen, manchmal so teuer, dass es für den Unterdrückten und Ausgebeuteten keinen Unterschied mehr macht, ob er von einem König, einem Despoten oder einfach nur einem Unbekannten ausgebeutet oder ausgeraubt wird. Könige führen Kriege, um Land zu erobern, bauen Reiche auf und Weltreiche, und dann kommt ein anderer und zerstört das Imperium, weil er sein eigenes aufbauen will, das ebenfalls wieder vernichtet wird. Die Böden aller Länder sind getränkt mit dem Blut der zu allen Zeiten in allen Kriegen geschlachteten Soldaten. Was hat das für einen Sinn? Warum hört dieses Morden und Rauben und Brandschatzen niemals auf?
Liegt es in der Natur des Menschen? Ist diese Natur unveränderlich? Oder ist das alles vielleicht systembedingt? Ist die menschliche Zivilisation falsch konstruiert, falsch programmiert? Wie müsste man das System umbauen und umprogrammieren, damit es besser funktioniert? Ist es überhaupt veränderbar, oder muss man es erst zerstören, um es danach völlig neu zu errichten?
Das sind teilweise sehr modern anmutende Fragen, die Abraham gewiss nicht so gestellt haben kann, da ihm zum Teil das zugehörige Vokabular gar nicht zur Verfügung gestanden hat. Die Bibel erwähnt auch nichts davon. Aber Abraham wird in der Bibel eingeführt, nachdem eine lange Verfallsgeschichte erzählt worden ist, in dessen Mittelpunkt die Gewalt unter den Menschen steht und die Frage, warum das Leben der Menschen immer wieder misslingt. Diese Geschichte beginnt nach der Vertreibung aus dem Paradies mit dem ersten Brudermord und endet mit der Hybris des Menschen beim Turmbau zu Babel.
Daher müssen wir uns Abraham als einen Menschen vorstellen, der sich unsere modern anmutenden Fragen sinngemäß mit seinen eigenen Worten vor seinem speziellen historischen Hintergrund gestellt und dabei etwas Allgemeines entdeckt hat, das auch heute noch gilt. Abraham war »der erste Systemkritiker« der Weltgeschichte, wie der Theologe Arnold Stötzel sagt. Aus Abraham soll ein Volk werden, das, gespeist aus der Energie des Glaubens, kraftvoll gegen den der menschlichen Natur innewohnenden Trend zur Barbarei lebt und die anderen Völker lehrt, wie man leben muss, damit das Leben aller dauerhaft gelingt. Das ist der Traum des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, eine göttliche Utopie, die in jenem Abraham fruchtbar wird, der nicht einverstanden ist mit dem System, in dem er zu leben gezwungen ist. Er kritisiert die bestehenden Verhältnisse, sucht nach Antworten auf seine Fragen, und es ist ihm ernst mit dieser Suche.
Wie ernst, das drückt sich in dem radikalen Entschluss aus, seine Heimat zu verlassen, um jahrzehntelang scheinbar orientierungslos in der Fremde umherzuirren. Er suchte nach dem Systemfehler, und als er ihn gefunden hatte, wurde ihm klar, dass er ihn nicht korrigieren konnte.
Wieder modern gesprochen: Abraham versucht erst gar nicht, die Verhältnisse zumindest in seiner unmittelbaren Umgebung wenigstens ein bisschen zu verbessern. Er glaubt wahrscheinlich, dass diese Verbesserungen nicht von Dauer sein werden, solange es im großen Drumherum nicht zum Besten steht. Und solange es im Großen und Ganzen nicht stimmt, wird es auch im Kleinen und Bruchstückhaften nicht stimmen können. Im Falschen kann es nichts Richtiges geben.
Man müsste also die Welt von oben und unten gleichzeitig verändern. Das kann ein Einzelner nicht schaffen. Abraham bemüht sich daher nicht um politische Einflussnahme in seiner Heimatstadt Haran, sucht nicht nach oppositionellen Gleichgesinnten, um sich mit diesen zu solidarisieren, zu organisieren, sich als Gegenmacht aufzubauen und von Haran aus das ganze Land aufzurollen. Abraham glaubt nicht an eine Reformierbarkeit des Systems. Ebenso schließt er die Möglichkeit eines gewaltsamen Umsturzes für sich aus. Resignation allerdings auch. Sich mit dem Unvollkommenen abfinden, kommt nicht infrage.
Was aber bleibt als Lösung übrig, wenn sowohl Reform wie Gewalt, wie auch Resignation ausscheiden? Für Abraham nur noch eines: Exodus. Heraus aus allen Bezügen. Abbruch aller Brücken zum alten System. Vorwärts in eine neue unbekannte Welt. Abraham war ein Rebell, und die Form seiner Rebellion war der Exodus. Daraus wird sich später der christliche Begriff der Umkehr entwickeln.
Rebellion gegen die Welt war mit den zu Abrahams Zeiten zur Verfügung stehenden Denkmitteln Rebellion gegen die Götter. Wenn die Geschichte des Menschen eine endlose Folge von Verhängnissen und Katastrophen ist, dann müssen es die falschen Götter sein, zu denen die Menschen beten, dachte Abraham, dann helfen diese Götter nicht, dann lieben diese Götter die Menschen nicht. Also muss es einen anderen, richtigen, einen wahren Gott geben, und um den zu finden, machte sich Abraham auf die Suche.
Die Suche nach dem wahren Gott und einer realistischen Erkenntnis der Zusammenhänge auf der Welt, also die Suche nach Wahrheit, das war es, was ihn umgetrieben hat. Seine damit demonstrierte Götterkritik und seine Ablehnung des damals offiziell gelehrten Weltbilds waren letztlich eine schärfere Form von Rebellion und ein tieferer Protest als jeder gewaltsame Aufstand.
Wenn es Gott wirklich geben sollte, dann muss damals der Himmel jubiliert, dann muss Gott seinen Engeln zugerufen haben: Wir haben ihn! Der Mensch, auf den ich seit Jahrtausenden warte, ist da, Abraham! Mit ihm wird es mir vielleicht gelingen, die Welt aus den Angeln zu heben. Er wird mein archimedischer Punkt sein.