

Zum Buch
Wir sind, was wir essen, und das lässt sich nicht nur für jeden Einzelnen von uns sagen, sondern auch für die Deutschen insgesamt. In Artikeln wie »Bohnenkaffee«, »Einbauküche«, »Gutbürgerlich«, »Kraut und Rüben« oder »Weihnachtsessen« erkundet Wolfgang Herles die Seele der Deutschen, wie sie sich in Küchen und Esszimmern, in Restaurants und an Imbissbuden präsentiert. Er erforscht die Vielfalt der Küchen und Gerichte, ob regional geprägt oder international bereichert, und geht den typischen Eigenheiten der deutschen Nahrungsaufnahme samt ihrer Geschichte auf den Grund, vom Butterbrot bis zum Sonntagsbraten. Immer auf der Suche danach, was die Esskultur über uns verrät. Mit zahlreichen Fotos des Autors.
Wolfgang Herles
VORWIEGEND
FEST-
KOCHEND
Kultur & Seele
der deutschen
Küche
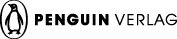
Sämtliche Abbildungen © Wolfgang Herles
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
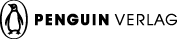
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 by Penguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Ulla Mothes, Berlin
Bildbearbeitung: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildungen: © Foodcollection / Getty Images; © Nanni Schiffl-Deiler, München
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-21608-5
www.penguin-verlag.de
Zum Autor
Wolfgang Herles, Jahrgang 1950, ist Schriftsteller und einer der profiliertesten deutschen Fernsehjournalisten und Autor erfolgreicher Sachbücher und Romane. Einem großen Publikum ist Herles als Moderator des ZDF-Kulturmagazins »Aspekte« und der Literatursendung »Das blaue Sofa« bekannt. Er lebt in München und Berlin.
Inhalt
Gruß aus der Küche
Apfelbaum
Bananenrepublik
Bauernopfer
Bio
Bismarckhering
Bohnenkaffee
Brotzeit
Brühwürfel
Butterbrot
Currywurst
Diätwahn
Eat-Art
Einbauküche
Extrawurst
Feinkost für Feinschmecker
Fernsehköche
Fleischeslust
Foodporn
Frühstücksei
Gaststättenverordnung
Gehacktes
Geschmackssache
Goldbroiler
Grillgut
Gulaschkanone
Gutbürgerlich
Hausmannskost
Hopfen und Malz
Hungersnot
Imbissbude
Käseigel
Kochkunst
Kraut und Rüben
Lecker
Leitungswasser
Mahlzeit
Manieren und Sitten
Maultasche
Milchmädchenrechnung
Nationalgericht
Oans, zwoa, gsuffa!
Pfeffersack
Rülpset und furzet!
Sättigungsbeilage
Saumagen
Schlachtschüssel
Schlaraffenland
Schnapsnase
Sonntagsbraten
Soße und Sauce
Spätlese
Speisekarte
Staatsbankett
Suppenkaspar
Thermomix
Vegetarier und Veganer
Verbraucher
Völlerei
Vorwiegend festkochend
Waldpilze
Weihnachtsessen
Weißwurstäquator
Zuckerbrot
Zukunft auf dem Teller
Literatur
Für Diethard
»Jedes Leben endet mit dem Tod,
jeder Tag mit einer Mahlzeit.«
Hermann Fürst von Pückler-Muskau
Gruß aus der Küche
Eine Liebeserklärung an die deutsche Küche ist das hier natürlich auch – aber zugleich viel mehr. Was den Deutschen schmeckt, wie sie kochen, übers Essen reden und schreiben, ist Ausdruck ihrer Kultur, ja, ihrer Seele.
Die Gründe für unterschiedliche Esskulturen sind im Klima und anderen Produktionsbedingungen zu finden. Aber auch in fest verwurzelten Traditionen. Gerade auf dem Teller zeigt sich, wie unverwüstlich Mentalitäten sind. Sie machen den Geist der deutschen Küche aus und widerlegen die Behauptung, jenseits der Sprache sei deutsche Kultur »schlicht nicht mehr identifizierbar«, wie die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özuğuz behauptete. Gerade auf dem Teller ist deutsche Kultur nach wie vor identifizierbar.
So ist dieses Buch auch eine Fortsetzung von Thea Dorns und Richard Wagners Bestseller »Die deutsche Seele«. Wer bloß ein wenig herumstochert auf den Tellern, in Töpfe, Pfannen und Gläser guckt, bekommt schnell ein ziemlich präzises Bild der Deutschen, einst und heute.
»Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.« Der deutsche Volksmund fackelte früher nicht lange, wenn die Mäuler gestopft wurden. Haut rein! Essen war Sättigung. Die Verköstigung bestand selten aus Köstlichkeiten. Der deutsche Magen galt als strapazierfähig. »Vergeblich habe ich viele hundert deutsche Köchinnen zum Besseren zu leiten versucht«, schrieb desillusioniert schon der bedeutendste der nicht allzu vielen deutschen Küchenphilosophen, Carl Friedrich von Rumohr, im neunzehnten Jahrhundert. Er wollte die Deutschen keineswegs nach dem Vorbild der genusssüchtigen französischen Schleckermäuler erziehen, war er doch Patriot. Für ihn hieß die Parole auch in der Küche: Deutschland gegen Frankreich. Deutsche Werte – das Einfache, Klare, Pure, Natürliche – führte er gegen französische Prinzipien – Raffinesse, Aufwand, Überfeinerung – ins Feld. Deutsche Esskultur ist von jeher an den Unterschieden zur französischen zu erkennen, auch wenn Deutschlands Küche längst erwacht ist und international mithält.
Mit den deutschen Vorlieben verhält es sich noch immer wie bei den deutschen Kartoffeln: Bevorzugt werden sie »vorwiegend festkochend«. Deutsche wollen etwas Ordentliches, Strammes auf dem Teller. Ohne viel Schnickschnack. Aber auch hierzulande wird zunehmend gefragt, warum etwas schmeckt und ob es überhaupt noch schmecken darf. Denn heutzutage ist das Gute zugleich das Gesunde.
Ja, die Deutschen zeigen auch beim Essen zunehmend kritisches Bewusstsein. Das war nicht immer so. Jahrhundertelang fürchteten sie den Hunger, heute haben sie eher Angst vor dem Essen. Romantisch und fortschrittsskeptisch lieben sie möglichst viel »Natur« auf dem Teller. Nicht der Mangel, sondern der Überfluss schafft heute Unbehagen. Dieses Buch ist ein Bekenntnis zur Lust am guten Essen und Trinken. Moralaposteln und Körnerfressern mag es weniger munden. Ins Regal der Ernährungsratgeber und professionellen Kostverächter passt es nicht.
Es erzählt auch von enormem Wandel. Die deutsche Küche hat sich geöffnet. Sie hat zwar immer Fremdes aufgenommen, vieles, was als »typisch« deutsch gilt, kommt von weit her, nicht zuletzt die Kartoffel. Aber heute herrscht grandiose Weltoffenheit auf den Tellern, und auch die ist, wenn man so will, typisch für dieses Land.
Dabei geht es nicht bloß um Gerichte, sondern um die Einstellung zum Essen, um die Veränderung der Ernährung überhaupt. Wenn Deutsche übers Essen reden, klingt es auch deshalb immer öfter englisch. Indoor farming, Superfood und Slowfood, Streetfood und Junkfood, Clean Food und Genfood, Covenience Food, Foodporn und der grüne Veggieday. Die Vorlieben der Deutschen ändern sich nicht überall so rasant wie in hippen Großstadtrevieren, aber überall ist Essen eine Leidenschaft.
Wie passt diese Lust jedoch zur Knausrigkeit im Supermarkt und diese wiederum zum neu erwachten Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Rettung des Klimas durch Verzicht? Wie die Gier nach fremder Kost zur Liebe zu Omas Küche? Die Antworten stecken voller Geschichte, Märchen, Mythen und Fakten. Von A bis Z.

Markthalle 9, Berlin
Apfelbaum
Der Biss in den ersten Apfel der Saison: jedes Mal wieder ein Erlebnis. Bereits im Juli ist er reif. Er gewinnt keinen Schönheitspreis, ist meist unsymmetrisch, eher klein, von unauffälligem Hellgrün. Der heimische Klarapfel – typisch deutsch? Die Sorte stammt aus dem Baltikum und breitete sich erst Mitte des neunzehnten Jahrhunderts über Frankreich in ganz Europa aus. Am besten, man pflückt diesen Apfel vom Baum und genießt sofort. Denn kaum geerntet, wird er bereits mehlig. Druckempfindlich ist er leider auch, also nicht lagerfähig, weshalb er im Handel keine Rolle spielt.
Damit ist er allerdings nicht allein. Von A (wie dem um 1800 aufgetauchten Aachener Hausapfel) bis Z (wie die 1885 in Hausen an der Zaber kultivierte Zabergäurenette) zählt Deutschland fast fünftausend Apfelsorten mit noch viel mehr regional unterschiedlichen Namen. Im Handel sind nur etwa fünfzig Sorten. Drei davon machen siebzig Prozent des Umsatzes: Jonagold, Golden Delicious, Red Delicious. Mit Abstand folgen Granny Smith, Elstar, Cox Orange, Schöner aus Boskoop.
Knapp eine Million Tonnen werden in Deutschland pro Jahr geerntet. Zwei Drittel der Deutschen nennen den Apfel ihr liebstes Obst. Doch ist von dieser innigen Liebe zum Apfel im Handel wenig zu spüren. Weshalb nehmen die Deutschen diese Verarmung in Kauf? Weshalb verlangen sie nicht den verlorenen Reichtum an Geschmack zurück? Weil sie den Unterschied nicht mehr schmecken. Weil es ihnen egal ist, solange der Preis stimmt.
Der Grund der Verarmung ist simpel. Im Fokus der Produktion stehen Vermarktung, Lager- und Transportfähigkeit, Normierung und Bürokratisierung, aber nicht die wahre Qualität der Früchte, nicht der Genuss und schon gar nicht das geradezu magische Wesen des Apfels. Um das Elend zu begreifen, genügt ein Blick in die Marktordnung.
Auszug aus der Durchführungsverordnung Nr. 543 / 2011 der EU-Kommission zur Verordnung Nr. 1234 / 2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse. Anhang I, Teil B, Teil 1, Vermarktungsnorm für Äpfel, Klasse Extra. »Die Äpfel müssen folgende sortentypische Mindestfärbung aufweisen: bis 3 / 4 der Gesamtfläche mit roter Färbung in der Färbungsgruppe A, bis 1 / 2 der Gesamtfläche mit gemischt-roter Färbung in der Färbungsgruppe B, bis 1 / 3 der Gesamtfläche mit leicht rot verwaschener oder rot gestreifter Färbung in der Färbungsgruppe C.« Neben Farbe und Form ist auch die Größe genormt: »Um die Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Größe zu gewährleisten, darf der Größenunterschied zwischen den Erzeugnissen eines Packstücks folgende Grenzen nicht überschreiten: a) für nach Durchmesser sortierte Früchte: bis 5 mm bei Früchten der Klasse Extra und Früchten der Klasse I und II, die in Lagen gepackt sind …« Und so weiter.
Setzt sich niemand zur Wehr? Das Apfelnetzwerk, gegründet 2009 unter Federführung des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen des Julius-Kühn-Instituts in Potsdam, hat sich zum Ziel gesetzt, die genetische Basis von wenigstens etwa tausend Apfelsorten zu erhalten. Sie sollen jeweils an mindestens zwei Orten angepflanzt bleiben. Der Grund dafür ist wiederum kein kulinarischer, sondern ein ökologisch-ökonomischer. Erhalten werden soll die genetische Basis nämlich zur Züchtung neuer Sorten, die mit geringerem Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln höhere Erträge bringen.
Neue Sorten, die auf den Markt kommen, sind jedoch meist nicht alte, vergessene, sondern neue Züchtungen. Sie heißen dann Red Prince (»ein Typ zum Anbeißen«) oder Green Star (»ein perfekter Durstlöscher«), so die Markennamen für »Clubsorten«, wie sie von einer limitierten Zahl von Erzeugern vertrieben werden. Geworben wird beim Green Star damit, dass er in der Brotdose nicht braun wird, was dem Geschmack eines Apfels keinen Abbruch tut, nur eben dem Aussehen.

Apfelmarketing auf der Fruit Logistica in Berlin
Bekanntlich hat ja alles Elend unter einem Apfelbaum begonnen. Damit, dass Adam etwas Verbotenes gegessen hat. Dem Mann blieb gleich der erste Bissen im Hals stecken. Dort ist Adams Apfel immer noch zu sehen. Vor der Vertreibung aus dem Paradies ins irdische Jammertal stand ein Apfelbaum. Der Biss in den Apfel ist die Ursünde, die den Verlust der Harmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf symbolisiert. Damit verlieren Adam und Eva nicht nur ihre Unschuld, sondern auch ihre Unsterblichkeit. Mit dem Genuss des Apfels tritt der Tod auf die Bühne des Lebens. Eros und Tod sind nicht zu trennen.
So wird mit einem Apfelbaum auch alles enden, zumindest in Deutschland. Denn es ist ein Apfelbäumchen, das Martin Luther »heute noch« pflanzen würde, »wenn morgen die Welt unterginge«. Wäre es nicht sinnlos? Doch der Sinn des Lebens ist es eben nicht, immer nur Sinnvolles zu tun. Der Sinn des Lebens ist vielmehr das Leben selbst.
Möglich, dass das theologisch nicht ganz korrekt formuliert ist. Aber gerade mit diesem Satz kommt mir Martin Luther besonders deutsch vor. Eine Sache um ihrer selbst willen tun – und zu übertreiben. Auch wenn es das Letzte ist, was noch zu tun bleibt.
Streng genommen ist in der Bibel allerdings von einem Apfelbaum keine Rede. Nur in der Vorstellung der Deutschen trägt der Baum der Erkenntnis Äpfel. (Die Frucht, die Paradiesapfel heißt – Paradeiser in Österreich – , ist eine Tomate.) Womöglich hängt das botanisch-theologische Missverständnis mit der lateinischen Namensgleichheit von malum (Apfel) und malum (das Böse) zusammen.
Die Schlange lockt, doch der Apfel ist das Objekt der Begierde. Adam und Eva verletzen die totale Autorität ihres Schöpfers, geben einer stärkeren Kraft nach: ihrer Neugier. Der Biss in den Paradiesapfel macht Adam und Eva zu Verwandten des Prometheus, der den Göttern das Feuer stiehlt und damit zum ersten Koch der Menschheit avanciert. Im Paradies gibt es alles, nur keine Freiheit. Ein noch immer aktuelles Thema. Die meisten Menschen würden wohl im Zweifel ihre Freiheit gegen ewige Sorglosigkeit eintauschen.
Wer nach Erkenntnis strebt, begnügt sich nicht mehr mit dem Glauben. Glauben kann der Mensch nur blind. Wissen dagegen heißt erkennen. Adam und Eva erkennen sich nackt. Ihre Sexualität erwacht und damit ihre Scham.
Auf Albrecht Dürers grandiosem Gemälde betrachtet Eva ihren Adam mit unverhohlenem Interesse. Wie beiläufig hält er einen dünnen Zweig in der Hand, an dem eine große, pralle Frucht hängt, ohne den Zweig zu biegen. Der Apfel, nicht das Feigenblatt, bedeckt das Geschlechtsteil. Die beiden sind so schön wie Venus und Apoll. Dürer bezieht sich auch auf antike Götter, erweist sich als Künstler der Renaissance. Im Mittelalter hätte man ihm noch vorgeworfen, Götzenbilder zu malen.
Faust, Inbegriff des deutschen Manns, der in seinem Erkenntnisdrang den Pakt mit dem Teufel eingeht, ist auch so ein Renaissancemensch. In Goethes Schauspiel tanzt er in der Walpurgisnacht mit einer jungen Schönen. Unverfroren macht er sie an: »Einst hat ich einen schönen Traum; / Da sah ich einen Apfelbaum, / Zwei schöne Äpfel sah ich dran, / Sie reizten mich, ich stieg hinan.« Worauf die Schöne antwortet: »Der Äpfelchen begehrt ihr sehr / Und schon vom Paradiese her. / Von Freuden fühl ich mich bewegt, / Dass auch mein Garten solche trägt.« Das muss nicht erklärt werden. Goethe ist ein Apfelfreund, in jeder Hinsicht. Im zweiten Teil des »Faust« finden wir die unsterblichen Zeilen: »Über Rosen lässt sich dichten, / In die Äpfel muss man beißen.« Dem ist nichts hinzuzufügen.
Der Apfel ist doppeltes Sinnbild: für die verbotene Frucht wie für die Schönheit. Schönheit und Eros sind so wenig voneinander zu trennen wie Eros und Macht. Auch dieses Motiv kennen wir aus der Antike. Paris hat die Qual der Wahl. Der schönsten der drei Göttinnen wird er einen Apfel als Siegespreis überreichen. Schön sind sie alle drei. Athene bietet dem Prinzen von Troja zusätzlich Weisheit, Hera Macht. Er aber entscheidet sich für Aphrodite, für nichts als die Schönheit. Wie auch immer Paris gewählt hätte, die Rache der unterlegenen Göttinnen wäre ihm gewiss gewesen. Der Apfel ist Zankapfel. Paris nimmt sich die schöne Helena zur Frau, die dummerweise schon mit Menelaos, dem König von Sparta, verheiratet ist.
Warum nur entzündet sich am Schönen so oft das Böse? Die böse Königin kann es nicht ertragen, dass Schneewittchen die Schönste ist im ganzen Land. Ihr Mordwerkzeug: ein vergifteter Apfel. »Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam; aber wer ein Stück davon aß, der musste sterben.« Schönheit und Niedertracht sind im Apfel vereint, von der Bibel bis zum deutschen Märchen.
Auch in der deutschen Oper: In Wagners »Ring«-Tetralogie, gleich im ersten Teil, dem »Rheingold«, ist die Unsterblichkeit der Götter in Gefahr. Und damit Wotans Macht. Alles hängt an den Äpfeln. Die schöne Freia ist auf Walhall zuständig für das Ressort Gartenbau und Liebe. »Goldne Äpfel wachsen in ihrem Garten; / sie allein weiß die Äpfel zu pflegen: / der Frucht Genuss / frommt ihren Sippen / zu ewig nie / alternder Jugend«, singt Fafner, der Riese. Er hat gute Gründe, Wotan daran zu erinnern. Der vertragsbrüchige Potentat kann die Rechnung für den Neubau von Walhall nicht bezahlen. Deshalb nehmen die Bauunternehmer Fafner und Fasolt Freia in Geiselhaft. Was aber soll nun aus den Äpfeln werden und aus der Götter Unsterblichkeit? »Siech und bleich / doch sinkt ihre Blüte, / alt und schwach / schwinden sie hin, / müssen Freia sie missen.« Freia muss mit dem geraubten Gold der Nibelungen aufgewogen und ausgelöst werden. Schon tönt das Ende leitmotivisch in den Ohren, die Götterdämmerung.
Das Apfelmotiv entnahm Wagner der nordischen Sagenwelt. Das Paradies der Kelten ist Avalon – Apfelland. König Artus ritt nach Avalon, um Heilung zu finden. Der Apfel muss also schon sehr früh heimisch gewesen sein im Norden Europas. Der Wildapfel Malus silvestri wurde schon in der Jungsteinzeit kultiviert zum Malus domestica.
Das Know-how der Römer war beim Apfelanbau hilfreich. Sie veredelten, indem sie pfropften. Das deutsche Verb leitet sich vom lateinischen propagare, fortpflanzen, ab. Doch hatte der deutsche Apfel die lateinische Propaganda gar nicht nötig. Das ist schon daran zu erkennen, dass sich das ältere germanische Wort Apfel, althochdeutsch apful, durchgesetzt hat.
Den Reichsapfel hielten die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation als Insignie ihrer Herrschaft zur Krönung in der linken Hand, ein Symbol für die Macht über den Erdball. In unseren Tagen wird die Symbolik umgedeutet. In der Hand des Menschen ist die Erde nicht mehr sicher. »Dieser Apfel dort / ist die Erde / ein schönes Gestirn / auf dem es Äpfel gab / und Esser von Äpfeln«, dichtete Hans Magnus Enzensberger.
Die meisten Äpfel werden allerdings getrunken. Durch die Jahrhunderte war Most das hauptsächliche Getränk der einfachen Deutschen, bis weit ins Mittelalter hinein. Met, meist vergoren aus Honig und Äpfeln, verbreiteter als Bier. Die Germanen kelterten Äpfel, als die Römer Wein anbauten. Die nannten den sauren Most Vice Vinum, Vizewein, Weinersatz, weshalb im Umland der ehrwürdigen römischen Kapitale Augusta Treverorum (Trier) der Stoff bis heute Viez gerufen wird. Der Historiker Plinius der Ältere schrieb: »Vinum fit e piris malorumque omnibus generis.« Wein wird aus Birnen und Äpfeln aller Arten gemacht. Wo Bartel den Most holt, ist nicht gut Kirschen essen.
Most! Erinnerungen an berauschende Kindheitserlebnisse steigen auf, die mein Illertissener Onkel zu verantworten hatte. Das hausgemachte, laut Lebensmittelrecht »weinähnliche Getränk« von mindestens sechs Prozent Alkohol löscht den Durst besser als Wein und Bier und beflügelt die Verdauung. Es lässt sich nicht aus dem übersüßen Tafelobst der Supermärkte keltern, sondern verlangt nach gerbstoffreichen alten Sorten, etwa nach den kleinen Mostbirnen, die lange Zähne machen, falls man unbedingt hineinbeißen muss. Im Süddeutschen, in der Schweiz und in Österreich (Mostviertel) ist Apfelwein Kulturgut.
Ganz besonders auch im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Dort hält man den Ebbelwoi in tönernen Krügen aus dem Kannebäckerland kühl, ehe das Stöffche aus dem Bembel ins geribbte Glas geschenkt wird, Schobbe für Schobbe. Die einschlägigen Kneipen tragen lustige Namen: Daheim im Lorsbacher Thal oder Kanonesteppel.

Apfelernte am Bodensee
Unvergorener Apfelsaft, gespritzt oder pur, ist heute der bevorzugte Saft der Deutschen. Nach kulinarischen Maßstäben ist der größte Teil davon nur als Schorle gegen den gröbsten Durst genießbar. Saft aus Apfelsaftkonzentrat dominiert den Handel. Dessen Herkunft darf verschwiegen werden. Nicht selten stammt das sirupartig eingedampfte Konzentrat aus China, dem größten Produzenten der Welt. Abgesehen von immer wieder entdeckten Schwermetallen und Pestiziden sind die chinesischen Zuchtäpfel so süß, dass Zitronensäure nicht bloß zur Konservierung in den Saft muss. Wieder schlägt der Preis die Qualität.
Natürlich produzieren am oberen Ende der Skala kleine Mostereien direkt gepresste, oft auch sortenreine Apfelsäfte zum fünffachen Preis. Die besten Saftbauern arbeiten so sorgfältig wie Winzer, sortieren matschiges Fallobst aus, bevorzugen alte Bäume von Streuobstwiesen, düngen nicht mit Kunstdünger, verringern der Qualität zuliebe den Ertrag. Die Kraft der Aromen mit Wasser zu schwächen wäre so barbarisch, wie die besten Weine für Gespritzten herzunehmen. Schon sind Sommeliers zu finden, die die passenden, sortenreinen Direktsäfte als Menübegleiter empfehlen. Es ist der Reichtum vergangener Zeiten, der allmählich wiederentdeckt wird. Er ist seinen Preis wert, preiswert aber ist er nicht.
▸ Bauernopfer, Bio, Fleischeslust, Geschmackssache, Hopfen und Malz, Schnapsnase, Spätlese
Bananenrepublik
Deutschland, eine Bananenrepublik? Was das besonders innige Verhältnis der Deutschen zur Banane angeht, ganz gewiss. Sie schätzen sie mehr als andere Völker, jedenfalls unter denen, die keine Bananen anbauen. Das drückt schon die der deutschen Sprache vorbehaltene, ein wenig aus der Mode gekommene Phrase »Alles Banane« aus: alles Bestens.
Lange stand die Banane beispielhaft für die Versorgungsprobleme der DDR und wurde damit auch zu einer innerdeutschen Angelegenheit. Als Symbol der Wiedervereinigung schuf Klaus Staeck, der aus Sachsen stammende Politgrafiker, ein Plakat, das eine Bananenschale zeigt, aus der eine Bockwurst ragt. Da wächst zusammen, was offenbar nicht zusammengehört und dennoch zusammenpasst. Nach der letzten Volkskammerwahl der DDR, der ersten demokratischen, zog der westdeutsche Innenminister Otto Schily eine Banane aus der Tasche, um zu illustrieren, weshalb nicht seine Partei, die SPD, gewonnen hatte, sondern die CDU des Kanzlers. Hatte Helmut Kohl doch das Ende des Mangels versprochen, also auch Bananen. Schily verspottete die mit dem Geist der kapitalistischen Marktwirtschaft erleuchteten Brüder und Schwestern.
»Bananen! Richtige Bananen!« sind das Highlight der Büfetts in jenem Villenviertel Dresdens, in dem DDR-Bürger in Uwe Tellkamps preisgekröntem Roman »Der Turm« ihre bildungsbürgerliche Parallelgesellschaft pflegen. »Habe schon fünf verdrückt und ein paar auch um die Ecke geschafft. […] Für die Kinder«, triumphiert Malthakus. Man erzählt sich auch Bananenwitze. »Auf dem Alexanderplatz in Berlin wurde ein Bananenautomat aufgestellt. Steckt man oben eine Banane hinein, kommt unten ein Markstück heraus.« Ob eine Ost- oder eine Westmark, lässt der Roman offen.
Dem Mangel an Bananen ist der Schlager zu verdanken, den die Spatzen schon von deutschen Dächern pfiffen, als es die DDR noch gar nicht gab. »Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir! Nicht Erbsen, nicht Bohnen, auch keine Melonen, das ist ein’ Schikan von ihr!« Der deutsche Text des Erfolgshits stammt von Fritz Löhner-Beda, den die Nazis in Auschwitz umbrachten. Allerdings wurde der Bananenmangel, auf den der Songtext anspielt, nicht von deutscher Misswirtschaft verursacht, sondern von Braunfäule im Herkunftsland Brasilien. Die Krankheit traf nicht nur Europa, sondern auch die USA, wo dieser Schlager entstand.
Anhänger der nationalistischen Organisation Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen mit Bananen an der Stelle, an der früher Hammer und Zirkel der DDR prangten. Damit erregten sie den Verdacht auf Verunglimpfung staatlicher Symbole. Die Fahnen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Nein, als Bananenrepublik will sich Deutschland nicht verspotten lassen. Ist es doch eindeutig keine Bananenrepublik im Sinne der von Korruption und Misswirtschaft gebeutelten mittelamerikanischen Staaten, in denen tatsächlich Bananen wachsen. Obwohl einem sofort der Berliner Flughafen oder die »Gorch Fock« einfallen.
Die Sehnsucht nach Bananen ist in den Ländern der ehemaligen DDR auch Jahrzehnte nach dem Beitritt zum Schlaraffenland BRD noch immer überdurchschnittlich groß. Auch in dieser Hinsicht leben die Deutschen tatsächlich in einer Bananenrepublik. Sie vertilgen jede dritte in Europa verkaufte Banane, obwohl sie nur sechzehn Prozent der Bevölkerung ausmachen. 1,4 Millionen Tonnen, zwölf Kilo pro Person, etwa achtzig Stück mittlerer Größe pro Jahr.
Anlass zur Sorge gibt, dass der Welthandel an einer einzigen Sorte hängt, die akut von Schädlingen bedroht ist. Die Bananenindustrie bezahlt den Preis der Monokultur nicht zum ersten Mal. Bereits in den Fünfzigerjahren erledigte die Panamakrankheit die damals dominierende Sorte Gros Michel. Deren leider nicht so süße Nachfolgerin, die Cavendish, ist doppelt so ertragreich, leichter zu ernten und beherrscht heute den Bananenmarkt – wenn auch vermutlich nicht mehr lange. Die Pilze Black sigatoka und Tropical Race 4 rücken ihr zu Leibe. Forscher züchten um die Wette, entwickeln neue, resistente Sorten. Noch schnellere Abhilfe verspricht die Gentechnik. Doch auch die Abneigung der Deutschen gegen Gentechnik auf dem Teller ist überdurchschnittlich stark. Man wird sehen, was stärker ist, der Appetit oder der Argwohn.
Feinschmecker bevorzugen ohnehin die kleineren, süßeren karibischen Bananen und haben auch für roh nicht genießbare Kochbananen als Gemüse Verwendung. Noch liegt die Einheitsbanane in den Regalen, dank EU-Bananenmarktordnung. Die Bananenmarktordnung legt lediglich Länge (nicht unter vierzehn Zentimeter) und Dicke (niemals weniger als siebenundzwanzig Millimeter) fest und unterscheidet zwischen Gemeinschaftsbanane, AKP-Banane (Afrika-Karibik-Pazifik im Sinne des Abkommens von Lomé) sowie Drittlandsbanane. Sie werden jeweils unterschiedlich verzollt. Die Eurobanane, grün und hart geerntet, übersteht den Transport dadurch leichter, dass sie erst am Bestimmungsort reifen darf. Das aber ist dem deutschen Bananenfreund gleichgültig. Hauptsache, die Kalorienbombe (hundertfünfzig Kilokalorien pro mittelgroße Banane) mit hohem Kaliumgehalt ist günstig zu kriegen. Dies ist der Fall, solange Umwelt- und Sozialbedingungen in den echten Bananenrepubliken mangelhaft bleiben. Hungerlöhne auf Riesenplantagen – auch solchen, die ein »Rainforest-Alliance-Siegel« auf die Früchte kleben – subventionieren den deutschen Appetit auf Bananen.
Warum ist die Banane krumm? Nicht etwa, weil sie, wie ein Witz behauptet, um die DDR einen Bogen gemacht hat. Der Grund liegt in dem, was Biologen negativen Geotropismus nennen. Bananen drehen sich, eingezwängt ins Kollektiv des Büschels zu je sechs bis zwanzig »Händen«, von Beginn ihres Wachstums an gegen die Schwerkraft der Sonne zu. Gekrümmt aus Freiheitsdrang: Mit diesem Widerspruch muss die Banane leben.
Und reden wir nicht darum herum, die Banane nährt auch die erotische Fantasie, überhaupt künstlerische Fantasien. Natürlich ist es ein deutscher Künstler, der weltweit als »Bananensprayer« bekannt geworden ist. Der vom Niederrhein stammende Thomas Baumgärtel sprüht seit 1986 ungefragt Bananen an die Fassaden von bisher etwa viertausend Kunstmuseen und Galerien im In- und Ausland und etablierte so die Banane als Symbol für Kunst.

Der Bananensprayer war da. Kunstbunker des Sammlers Christian Boros in Berlin
Auf der Art Karlsruhe sorgte er 2018 für einen Eklat. Er steckte auf einer Karikatur seine phallische Lieblingsfrucht dem türkischen Präsidenten Erdoğan in den Hintern. Man muss das nicht pornografisch verstehen, kann es auch politisch-polemisch interpretieren: Die Kunst, symbolisiert durch die Banane, erniedrigt den Diktator. Politisch korrekt ist das nicht. Und weil die Deutschen in Sachen Political Correctness Spitze sind, gab es Ärger. Nach Protesten trennten sich der Galerist vom Bild und der Künstler vom Galeristen.
▸ Bio, Fleischeslust, Goldbroiler, Schlaraffenland, Zuckerbrot
Bauernopfer
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Umgedreht scheint das deutsche Sprichwort noch immer zu stimmen: Was der Bauer nicht frisst, kennt er nur zu gut. Rückständigkeit auf der einen, skrupellose Industrialisierung auf der anderen Seite – kaum ein Berufsstand hat mit mehr und widersprüchlicheren Vorurteilen zu kämpfen. Man könnte auch sagen: »Was der Städter frisst, kennt er nicht.« Weil er von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung hat. Aber ist das den Bauern vorzuwerfen?
Verbraucher und Erzeuger hatten schon immer unterschiedliche Interessen. Aber noch nie war das Misstrauen so groß. Das ist schon daran zu erkennen, dass Verbraucherschutzministerium und Landwirtschaftsministerium gegeneinander arbeiten. Besonders plakativ war dies zu sehen, als das eine der beiden Ministerien 2017 seltsame Bauernregeln propagierte. »Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein.« Der Spruch ist selbstredend Mist. Solche Slogans sollten die Stadt gegen das Land aufhetzen, schimpfte der bayerische Bauernminister. Was hatte die Bundesministerin für Umwelt und Verbraucherschutz geritten, dafür Steuergeld auszugeben? War der Landwirt zum offiziellen Feindbild der Regierung avanciert? Die Regierung hätte genauso gut die Verbraucher attackieren können, etwa so: Muss das Schwein sehr billig sein, ist das Essen gar nicht fein.
Der Landwirt mistet den Stall aus, betreibt am Computer Herdenmanagement, manövriert seinen Betrieb durch den Paragrafenwald des EU-Agrarmarkts, wird dabei zum Spielball der Agrarindustrie und verdient damit weniger als ein Angestellter im Chemiewerk, dessen Produkte er großzügig einsetzt.
Dafür hat er einen Beruf, der mehr ist als ein Beruf, nämlich eine Lebensform. Er sieht sich als fleißiger und traditionsbewusster Bewahrer der Kulturlandschaft. Bei allem Stolz auf die eigene Scholle hält er sich gern für die schwächste Figur auf dem Schachbrett, an den Rand geschoben und anderen, mächtigeren Interessen geopfert.

Jungbauern – Landwirtschaftsfest München
Der Bauer folgte dem Jäger und Sammler, aber der Übergang dauerte viele Jahrtausende. Der frühe Mensch war Jäger, Sammler, Fischer und Bauer zugleich, bis vor etwa zwölftausend Jahren, in unseren Breiten erst vor siebentausend Jahren, die unbearbeitete Natur zum Überleben der wachsenden Bevölkerung nicht mehr genug hergab. Der Anbau von Lebensmitteln musste kultiviert werden. Mit dem Bauern kam die Sesshaftigkeit, mit der Sesshaftigkeit entstand Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichte ist immer auch Ernährungsgeschichte.
Neuere Ausgrabungen, etwa bei den Pfahlbauten am Zürichsee vom Ende des vierten Jahrtausends v. Chr., belegen, dass der Tisch weitaus reichhaltiger gedeckt war als bisher vermutet. Nur etwa vierzig Prozent des Essens bestand aus Getreide. Es gab Alternativen, wenn Nahrungsquellen wetterbedingt ausfielen. Zum Beispiel Haselnüsse, mit dreizehn Prozent auf Platz zwei der Lebensmittel vor der Erbse mit neun Prozent. Es wurden Haustiere geschlachtet: Schweine, Rinder, Hunde. Aber auch Biber und Frösche kamen auf den Tisch. Wilde Äpfel, Brombeeren, Schlehen sorgten für Vitamine. Fett lieferte die Milch, aber auch Lein- und Mohnsamen.
Die Völker des Nordens, Kelten und Germanen, nutzten die unberührte Natur länger als die Hochkulturen im Süden. »Ackerbau betreiben sie wenig«, behauptete noch Cäsar. »Ihre Ernährung besteht zum größten Teil aus Milch, Käse und Fleisch. Jagen, Fischen, Sammeln.« Die Tiere, die sie züchteten, lebten wild in den Wäldern. Was den Ackerbau anging, waren die Römer schon viel weiter.
Erst mit der Bevölkerungszunahme im neunten Jahrhundert begann die Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen, wurden Wälder großflächig gerodet, Sümpfe trockengelegt und urbar gemacht. Die Nachfrage stieg, des Bauern Bedeutung wuchs. »Die unberührte Natur wird von jetzt ab an den Rand der produktiven Werte und der vorherrschenden Ideen verbannt. Es ist dies der Anfang eines großen Booms – oder vielleicht auch einer großen Krise«, resümiert der Historiker Massimo Montanari. Denn mit der Zunahme der Flächen wuchs auch die Konkurrenz um deren Nutzung. Der Bauer lebte vom Land, der Adel vom Grundbesitz. Er beutete die Bauern aus, zog die Überschüsse ein. Die meisten Bauern lebten von dem, was übrig blieb. Sie hatten zwar Tiere im Stall, aber nur selten Fleisch auf dem Teller. Und sie verspürten wenig Anreiz, unter diesen Bedingungen effizienter zu wirtschaften, sie hatten ja nichts davon. Bauern und Grundherrschaft: ein Spannungsfeld. Selbst die Jagd war ein Privileg des Adels, das Bauern aus den Wäldern verbannte und zum Wildern nötigte. Fleisch war nun eine Frage des Standes und der Klasse. Unter den Bauern selbst, den wenigen reichen, den vielen armen, die kaum mehr schafften als ihre Selbstversorgung, war Getreide die Hauptnahrungsquelle.
Die Konzentration auf den Getreideanbau wiederum strapazierte wie jede Monokultur die Böden. Der Ertrag war zunächst mäßig, auf ein Samenkorn kamen lediglich vier Körner des geernteten Korns. Eine Lösung bot die Dreifelderwirtschaft. Alle drei Jahre lag ein Acker brach, um den Nährstoffgehalt der Erde aufzufüllen. Entsprechend niedriger war der Ertrag. Bessere Pflüge sollten das ausgleichen. Je tiefer die Pflugschar ins Erdreich schnitt, je fetter und schwerer die Erde war, desto mehr Zugtiere waren nötig – und desto weniger Chancen hatten die kleinen Bauern. Der Teufel schiss von jeher auf den größten Haufen. Arme Bauern mussten sich selbst vor den Pflug spannen, hatten keine Zugtiere und dazu noch weniger Mist zum Düngen für die Felder.
Immer wenn die Bevölkerung stark zunahm, expandierte auch die Landwirtschaft. Jedes Mal ging dem eine Periode des Mangels voraus. Erst die Not machte erfinderisch. So auch während der Kleinen Eiszeit im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, als die Durchschnittstemperatur in Mitteleuropa deutlich gegenüber dem warmen Mittelalter sank. Hunderttausende von Kleinbauern verelendeten. Gab das Land zu wenig her, bissen den Letzten die Hunde. Es gab bald weniger Bauern, aber größere Höfe, die für einen größeren Markt produzierten. In den Hungerjahren der Kleinen Eiszeit wuchs auch der internationale Handel mit Getreide, um Ernteausfälle zu kompensieren. Nachdem sich die Methoden von der Antike bis zum Beginn der Neuzeit kaum verändert hatten, machten nun neue Getreidesorten, verbesserte Viehzucht sowie Düngung die Landwirtschaft intensiver und effizienter.
Zum Stand der Bauern gehörten immer Arme und Reiche, Herren und Knechte. Bauerndörfer waren Orte enormer sozialer Gegensätze. 1520 beschrieb Johannes Bohemus den Bauernstand: »Ihre Lage ist ziemlich bedauernswerth und hart; sie wohnen abgesondert voneinander, demüthig, mit ihren Angehörigen und ihrem Viehstand. […] Geringes Brot, Haferbrei, gekochtes Gemüse ist ihre Speise, Wasser und Molken ihr Getränk.«
In unzähligen Berichten aus mehreren Jahrhunderten ist immer nur von der Not der Bauern zu lesen. Fernand Braudel, der große französische Historiker, zweifelt sie gleichwohl an: »Nehmen wir also die in der Literatur so häufigen Klagen über die Ernährung der armen Bauern […] nicht allzu wörtlich: Wir haben Beweise für das Gegenteil.« Auch das Jammern gehört seit jeher zum Geschäft.
Der Bauernstand war in Deutschland immer wieder Objekt und Opfer von Ideologie. Man mag auch den Neoliberalismus für eine Ideologie halten. Aber zunächst denken wir an die Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis. Danach ist das rassisch reine Volk eins mit seinem Boden. Die Bauern wurden in den »Reichsnährstand« gezwungen. Der Staat legte Produktionsmengen und Preise fest. Der Reichsbauernführer war zugleich Landwirtschaftsminister. Sitz des Reichsnährstands war die Reichsbauernstadt Goslar. Der Verband war zäh, überlebte das Naziregime um etliche Jahre. Erst 2006 machte das Reichsnährstands-Abwicklungsgesetz dem Spuk auch juristisch ein Ende.
Die DDR sah sich als Arbeiter- und Bauernstaat. Vom Stand zur Klasse erhoben, hatten allenfalls Bauern ohne nennenswerten Landbesitz etwas davon. Als Werktätige der Scholle arbeiteten die Enteigneten zwangskollektiviert in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Agrarfabriken. Im Osten war die Landwirtschaft allerdings zuvor weitgehend in der Hand meist adliger Großgrundbesitzer. So sahen und sehen die ärmlichen Dörfer bis heute aus. Es fehlt eine gewachsene bäuerliche Kultur, wie sie Süddeutschland eigen ist.
Großagrarier mit mehr als tausend Hektar Boden wurden schon in der Sowjetischen Besatzungszone entschädigungslos enteignet. Tausende flohen in den Westen. Die stalinistische Zwangskollektivierung der übrigen Landwirte lief seit 1952 in Wellen und auch noch nach Stalins Tod (1953) bis 1964. Wer sich weigerte, sein Land einer LPG zu überlassen, wurde »überredet«. Dabei halfen willkürlich überhöhte Ablieferungsquoten, »Ernteeinsätze« der Staatssicherheit und anderer Kampfgruppen der Arbeiterklasse; die Maßnahmen reichten von eingeschlagenen Fensterscheiben bis zum Psychoterror. Nur maximal ein halber Hektar Boden blieb zur privaten Bewirtschaftung. Vor dem Mauerbau 1961 flohen Zehntausende Bauern. Manche brannten ihre Höfe nieder und verübten Selbstmord.
Fast alle Bauern arbeiteten in den LPGs, wobei sich die Umstrukturierung auf riesige Monokulturflächen sowie Massentierhaltung und auch die mangelnde Erfahrung mit solchen Kulturformen negativ auswirkte. Die Ernten blieben hinter den Plänen zurück, die Versorgungsvielfalt der Bevölkerung mangelhaft, und von der propagandistisch behaupteten Überlegenheit gegenüber der kapitalistischen Landwirtschaft im Westen konnte keine Rede sein. Nach der Wende wollte ein großer Teil der Bauern sein Land nicht wieder selbst bewirtschaften. LPGs wandelten sich in GmbHs oder Genossenschaften um.
Heute beliefern deutsche Bauern überwiegend die Industrie und sind ein Rad im Getriebe des Agrobusiness. Dieser hässliche Anglizismus hat sich auch in Deutschland eingebürgert. Der Bauernverband verwendet ihn ebenso wie das Landwirtschaftsministerium. Zum Agrobusiness zählt alles zwischen farm and fork, zwischen Pflug und Pfanne, vom Saatgut bis zum Brot. Erzeuger, Handel, Handwerk, Industrie umfassen ein gutes Zehntel der Beschäftigten in Deutschland, darunter sind die Bauern eine kleine Minderheit, gerade einmal 1,6 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten auf dem Bauernhof.
Agrobusiness ist Big Business. Die größten drei Landtechnikunternehmen teilen sich die Hälfte des Weltmarkts. Drei Saatgut- und Agrarchemiekonzerne kontrollieren ihn, das deutsche Unternehmen Bayer ist ganz vorn dabei und zugleich in der Bredouille, denn die Übernahme des umstrittenen amerikanischen Gentechnikkonzerns Monsanto birgt unüberschaubare Haftungsrisiken durch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und hat Bayer in höchste Bedrängnis gebracht.
Bis ins Mittelalter war noch alles in einer Hand. Der Bauer backte Brot, schlachtete, produzierte aus Milch Butter und Käse, webte Textilien, verkaufte direkt an die Verbraucher. Die Spezialisierung ging einher mit der Verstädterung der Gesellschaft. Mit der Arbeitsteilung – Marx hatte in diesem Punkt recht – kam die Entfremdung. Bauern werden heute von der Agrartechnikindustrie und den Saatgutproduzenten ausgenommen, kämpfen gegen die Agrarfabriken, gegen Lebensmitteldiscounter, gegen geizige Verbraucher. Die Freiheit von der Leibeigenschaft haben sich Landwirte mühsam erkämpft. Nun presst der Markt sie, Staat und Europäische Union reglementieren und subventionieren, die großen Lebensmittelketten diktieren Preise und zusätzliche Vorschriften.
Was immer ein Bauer unternimmt, um die Produktivität zu steigern und die wirtschaftlichen Risiken zu senken, es kostet Vertrauen. Zwar war die Lebensmittelsicherheit noch nie so hoch wie heute, die Versorgungslage noch nie so stabil – doch zugleich auch der Argwohn gegenüber Lebensmitteln so groß.
Das Agrobusiness hat zwar effizientere Betriebe geschaffen, doch auf Kosten von Produktvielfalt und Qualität. Wo Konsumenten Qualität höher zu schätzen wissen wie in Frankreich, ist das Angebot besser als in Deutschland.
Wenn die Scholle zum Geschäftsfeld wird, braucht sich niemand zu wundern, wenn die bäuerlichen Kulturlandschaften inzwischen auch so aussehen. Monochrome Flächen, Wände aus Mais, von tonnenschweren Landmaschinen zusammengepresste Böden, von Pestiziden vernichtete Blumen und Kräuter, ausgelaugte Böden, belastetes Grundwasser.
Die Natur schlägt zurück: der Ackerfuchsschwanz im Getreide, Bodenpilze in Kartoffeläckern, Nematoden, Rapsglanzkäfer. Die Wirkstoffkombinationen der Chemie helfen immer weniger. Schädlinge entwickeln Resistenzen. Wenn die Waffen stumpf sind, ertönt der Ruf nach besserer Chemie, nach neuen Pestiziden. Aber auch die Prüfung neuer Insektizide wird strenger.
Verbandssprecher beklagen, Bienen würden besser geschützt als die Bauern. Das Volksbegehren »Rettet die Bienen« stieß ausgerechnet im einst agrarischen Bayern auf höchste Zustimmung. Sein Ziel ist es, die Artenvielfalt zu erhalten, was nur mit einer Steigerung ökologisch weitgehend unbedenklicher Landwirtschaft zu erreichen ist. Und hier erweisen sich immer mehr Bauern findiger als ihr Verband. Manche Ackerfläche wird bereits in artenreiche Wiesen für Bienen und andere Insekten verwandelt.
Doch trägt der Landmann Mitschuld an der Misere, wenn er aus Gier nur die rentabelsten Pflanzen anbaut, statt die Böden zu schonen und etwa zwischen Weizen, Raps und Gerste abzuwechseln. Weizen bringt zwanzig Euro mehr pro Hektar. Weizen nimmt in Deutschland den größten Flächenanteil aller Ackerfrüchte ein. Inzwischen muss auf immer mehr Flächen der Weizenanbau eingestellt werden, weil Bauern die biologischen Bedingungen jahrzehntelang ignorierten. Geringere Rendite – weniger Resistenzen, auch diese Rechnung geht am Ende auf.
Rekordjagd auf dem Acker, Rekordjagd im Stall. Die Deutschen sind an billige Lebensmittel gewöhnt und stellen nun zunehmend fest, dass das mit Raubbau verbunden ist. Sie wollen vom Agrobusiness profitieren, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen. Sie wünschen sich eine saubere, sichere und preisgünstige Ernährung. Nicht zuletzt deshalb wird der Ruf nach einer Agrarwende lauter, auch wenn der Preis dafür zu zahlen ist. Bei konsequenter Umstellung auf tiergerechte Haltung kämen zum Beispiel auf die Bauern vierzig Prozent Mehrkosten zu, wie die Organisation Foodwatch berechnet hat. Sie müssen umgelegt werden auf die Verbraucher.
Die Wende wird kommen. Auch im Stall werden sich die Dinge ändern. Zum Besseren. Ausgemistet gehören die Maßstäbe von gestern. Dunkle, schlecht belüftete Ställe – sie gelten heute als Tierquälerei. Ebenso jedoch die Vorstellung vom kleinbäuerlichen Idyll im Einklang mit der Natur, denn das war nie mehr als eine romantische Illusion.
Vor tausend Jahren lebten drei Viertel der Deutschen auf dem Lande, vor hundert Jahren noch knapp die Hälfte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 1,65 Millionen landwirtschaftliche Betriebe allein in der alten Bundesrepublik. Heute sind es noch zweihundertsiebzigtausend in ganz Deutschland. Ein Bauer erwirtschaftet im Schnitt dreißigtausend Euro. Er produziert genug für hundertdreißig Verbraucher, vor gut hundert Jahren lag das Verhältnis noch bei eins zu vier. Und Jahr für Jahr geben viele Bauern auf. Die Großen werden vom Staat überdurchschnittlich gehätschelt und subventioniert, obwohl es die Kleinen sind, die für Vielfalt sorgen und tun, was die Propaganda vollmundig »Erhaltung der bäuerlichen Kulturlandschaft« nennt.

Prototyp eine Feldroboters – auf der Grünen Woche
Vorsprung durch Technik kann sich der Großbauer eher leisten als der kleine Landwirt. Beide hat die digitale Revolution erfasst, ob sie wollen oder nicht. Smart Farming: Künstliche Intelligenz wird den Feldarbeiter weitgehend ersetzen. Drohnen in der Luft, Sensoren in Saat- und Erntemaschinen überwachen den Zustand von Boden und Pflanzen. Nährstoffbedarf, Feuchtigkeit, Pflanzenschädigung: Der Computer erhält alle Informationen, die er braucht, um jede einzelne Pflanze mit Nährstoffen, Wasser, Dünger individuell zu versorgen. Kleinere, den Boden schonende, führerlose Maschinen erkennen Unkraut, bekämpfen es, säen und düngen. Satellitenbilder beobachten das Wachstum und teilen dem Bauern täglich mit, wo Gefahren drohen. Agrarmanagement 4.0.
Und wieder sind die Weltkonzerne mit im Spiel. Aber auch Hunderte von Agrar-Start-ups ziehen Wagniskapital an. Der einstige Monsanto-Forschungsvorstand Robert Fraley, ein Bauernsohn, sagt: »Wenn wir diese Technikfeindlichkeit hinter uns bringen, ist es möglich, zehn Millionen Menschen zu ernähren und gleichzeitig weniger Land zu nutzen. Apple wird dann wahrscheinlich die Agrarindustrie bestimmen. Und Google.« Als die Bundesforschungsministerin zum Ausbau des schnellen Internets auch auf dem Land nonchalant anmerkte, 5G sei »nicht an jeder Milchkanne notwendig«, hagelte es Widerspruch. Tatsächlich ist Landwirtschaft ohne den Einsatz elektronisch gesteuerter intelligenter Technik in Zukunft nicht mehr konkurrenzfähig. Attraktiver und profitabler könnte der Beruf werden, wenn alle technischen Möglichkeiten sinnvoll genutzt werden.
▸ Bio, Brotzeit, Hungersnot, Kraut und Rüben, Milchmädchenrechnung, Schlachtschüssel, Vegetarier und Veganer, Verbraucher, Zukunft auf dem Teller