

Buch
Ein Ausflug an die englische Küste wurde für Becky zum traumatischen Erlebnis. An diesem Tag trifft ihre Mutter den Mann, in den sie sich verlieben und für den sie ihre Familie verlassen würde. Drei Jahrzehnte später hat Becky kaum Kontakt zu ihrer Mutter Selma, als sie einen Anruf bekommt. Selma hat nur noch wenige Wochen zu leben. Und sie muss Becky etwas mitteilen, das seit vielen Jahren schwer auf Selma lastet. Denn sie hatte noch eine Tochter, nur wenige Jahre jünger als Becky selbst. Bevor Becky mehr erfahren kann, stirbt ihre Mutter. Becky geht auf die Suche nach der verlorenen Schwester – eine Suche, die sie rund um die Welt und in Selmas rätselhaftes Leben führt. Doch es gibt Menschen, die das, was damals passierte, für immer in Vergessenheit geraten lassen wollen …
Autorin
Tracy Buchanan lebt als Schriftstellerin in England. Wenn sie nicht gerade schreibt, liebt sie es, durch Wälder zu streifen, einsame Strände zu erkunden und mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Hund Brontë auf Städtetrips zu gehen.
Von Tracy Buchanan bereits erschienen
Die Mitternachtschwestern
Mehr Informationen zur Autorin unter www.tracybuchanan.co.uk
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Tracy Buchanan
Die
Meerestochter
Roman
Aus dem Englischen von Hanne Hammer
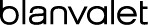
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»The Lost Sister« bei Avon, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Tracy Buchanan
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Larissa Rabe
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Ekaterina Grivet; Helen Hotson; Paul Nash;
Chizhenkova Svetlana; maxim ibragimov)
JB · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24622-8
V001
www.blanvalet.de
Für Archie. Wir vermissen dich, Junge.
Alles begann, als der Junge fast ertrank.
Queensbay erlebte einen dieser Sommerabende, an denen sich Fremde im Vorübergehen anlächeln und jeder nur ehrfürchtig staunt, dass es im grauen alten England so warm sein kann. Alles trug Flipflops und Sandalen, das Schlappen der Sohlen auf der Strandpromenade aus Holz und das Bellen kleiner Hunde war eine vertraute Geräuschkulisse. Das Café an der Strandpromenade war brechend voll, vor allem im Außenbereich. Die Kinder waren begeistert, dass sie an einem Schultag so lange aufbleiben durften, und die Eltern versuchten, ihre aufgedrehten und sonnenverbrannten Kinder zu ermahnen, während sie Wein tranken und mit Freunden lachten. Ältere Paare schlenderten am Sandstrand durchs flache Wasser, die Schuhe in der Hand, während ihre Hunde in die nah gelegenen Höhlen und wieder hinaus rannten. Die Sonne, die in glühendem Orange unterging, tauchte die Köpfe der Menschen in feuerrotes Licht.
Ich beobachtete alles durch meine Sonnenbrille. Der Gin, den ich getrunken hatte, benebelte meinen Verstand schon leicht, wie ich es mochte. Die geschwungene Bucht sah an diesem Abend ganz besonders schön aus, umrahmt vom Café auf der einen und gewaltigen Kreidefelsen auf der anderen Seite. Wenn man um die Felsen herumging, kam man zu einer abgelegenen Bucht mit ein paar Höhlen, über denen ein verlassenes Hotel thronte. Es war mein Traum gewesen, dieses Hotel einmal zu kaufen. Ich seufzte. Im Moment schien das alles andere als wahrscheinlich.
Meine Tochter Becky jagte ihre Freundin um die vollen Tische des Cafés, und ich behielt sie im Auge, bereit, im Fall von zerbrechendem Glas, einem Weinen oder einem Krachen aufzuspringen. Mein Mann Mike, der neben mir saß, hatte eine Hand auf mein nacktes Knie gelegt und lächelte, als sein Freund Greg von einem schwierigen Klienten erzählte. Warum hatten die Leute nur immer das Bedürfnis, an Abenden wie diesem über etwas so Banales wie die Arbeit zu sprechen?
Ich gähnte und streckte mich und bemerkte, wie Gregs Blicke über meine Brüste glitten, die den Stoff meines geblümten Wickelkleids dehnten.
So vorhersehbar. Und auch so falsch, wenn man bedachte, dass seine Frau Julie direkt neben mir saß und verzweifelt versuchte, ihr Neugeborenes zu stillen, dessen schrumpeliges, kleines rotes Gesicht sich an ihre nackte Brustwarze drückte. Sie fächelte ihre heißen, sommersprossigen Wangen mit der Speisekarte.
Ich sah Greg mit zusammengekniffenen Augen an, und er schaute weg. Meine Mum hätte ihn als »Ärger« bezeichnet. Ich erinnerte mich noch genau, wie sie das einmal gesagt hatte, auf das Sofa gelümmelt, einen Drink in der Hand und mit einer Freundin lästernd. »Er bedeutete Ärger, Schatz.« Das R hatte sie mit ihrer tiefen, rauen Stimme in die Länge gezogen. Als ich sie eines Abends beim Essen fragte, was sie damit gemeint habe, hatte sie mir einen ihrer vernichtenden Blicke zugeworfen. »Was interessiert dich das schon?«
Eine Woche später bekam ich meine Antwort, als ich den Mann kennenlernte, der mein Stiefvater werden sollte. Er war der schlimmste von allen. Die anderen – drei insgesamt, seit sie meinem Vater gesagt hatte, dass er sich aus dem Staub machen sollte, als ich acht war – hatten auch ihre Fehler. Glücklicherweise war ich bereits weg, als der dritte auftauchte.
Nein, Greg war nicht wie mein erster schrecklicher Stiefvater. Na ja, vielleicht sah er ihm mit seinem glatt zurückgekämmten schwarzen Haar und seinem spitzbübischen, attraktiven Gesicht ähnlich. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Greg die Hand gegen Frau und Kind erhob, wie mein Stiefvater das getan hatte. Ich sollte nicht zu hart mit ihm sein. Das Flirten, die heimlichen Blicke … das war nur ein kleiner Kitzel für ihn, um die Eintönigkeit des Lebens in dieser gottverlassenen Stadt etwas erträglicher zu machen.
Die Leute kamen nach Queensbay, weil sie sich hier ein ruhigeres Leben erhofften, an diesem wunderschönen Stück Strand an der Küste von Kent, das früher einmal ein verstecktes Kleinod gewesen war und das vor allem Ehepaare im Ruhestand und Familien anzog, die versuchten, dem Hamsterrad zu entkommen. Das Problem war, dass es hier zu ruhig geworden war, weil das Land eine Rezession erlebte. Bretter waren vor die Fenster der Geschäfte genagelt, die ich einmal geliebt hatte; »Zu verkaufen«-Schilder hingen zu lange draußen an früher so begehrten Häusern. Durch die Schicht von Möwenkot konnte man die Buchstaben kaum noch lesen. Der geliebte Traum war restlos verblasst.
Mir und Mike ging es nicht anders. Kurz nach unserer Hochzeit vor zehn Jahren waren wir zur Hochzeit eines alten Freundes in Margate gefahren und dabei durch die Stadt gekommen. Ich war so hingerissen gewesen von der blauen Bucht, dass wir spontan ein Zimmer gebucht hatten und nach der Hochzeit noch geblieben waren. Als ich das verlassene Hotel mit dem schäbigen »Zu verkaufen«-Schild über den nahen Felsen thronend entdeckt hatte, war ich vor Ehrfurcht erstarrt. Sicher, die weißen Wetterschenkel, die die äußeren Wände zierten, waren schwarz vor Moos, die Panoramafenster schmierig vor Schmutz. Aber es war immer noch wunderschön.
»An so einem Ort würde ich gerne leben«, hatte ich an diesem spontan verlängerten Wochenende zu Mike gesagt.
Aber er hatte nur gelacht. »Du machst wohl Witze. Sieh dir doch an, in was für einem Zustand es ist!«
Das war das Problem mit Mike: Er verfügte nicht über meine Fantasie. Das hätte ich von dem Moment an wissen müssen, als er sich in der Uni-Bar, in der wir uns begegneten, geweigert hatte, ein Trinkspiel zu spielen.
Egal, zurück zu dem Abend. Jenem Abend.
»Oh, mach schon, Finn«, stöhnte Julie neben mir und sah auf ihr Baby hinunter.
Ich schob meine große Sonnenbrille bis zur Nasenspitze herunter und spähte darüber hinweg auf das Neugeborene. »Trinkt er wieder nicht?«, fragte ich.
»Er kapiert’s langsam, glaube ich«, antwortete Julie. Die dunklen Ringe unter ihren Augen waren nicht zu übersehen, ihr rotes Haar war plattgedrückt und kraus.
»Gut so, halt weiter durch.«
»Hast du durchgehalten?«
Ich stieß einen dramatischen Seufzer aus. »Leider haben die alten Dinger hier nicht genug Milch produziert«, sagte ich und zeigte auf meine Brüste. Greg und ich schauten uns an. »Ich hatte keine andere Wahl als die Flasche«, fügte ich hinzu.
Mike warf mir einen Blick zu. Okay, das war gelogen. In Wirklichkeit hatte ich massenhaft Milch gehabt – so viel, dass sie nachts herausgetropft war und mein seidenes Unterhemd durchnässt hatte. Aber ich hatte das Stillen gehasst, vor allem den Geruch meiner eigenen Milch. Doch das konnte ich ja schlecht sagen, oder? Man hätte die Stirn über mich gerunzelt, gerade in Queensbay mit seiner Vorliebe für Yoga und gesunde Lebensweise.
Ich gähnte erneut und warf einen Blick auf meine alte goldene Uhr. Es war schon nach acht.
»Entschuldige, ich langweile dich«, sagte Julie missbilligend.
Sanft berührte ich ihren Arm. Ja, die Frau langweilte mich. Aber das war nicht ihre Schuld.
»Überhaupt nicht!«, sagte ich. »Ich bin nur müde von der Hitze. Du machst das großartig, wirklich, meine Liebe.«
»Meinst du, ihr bekommt noch eins?«, fragte Julie.
Mike schaute mich an. Er wollte unbedingt noch ein Kind. Aber ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen und schauderte bei der Erinnerung an diese schwierigen, verwirrenden, von Krankheit geprägten ersten Monate in Beckys Leben. An die Gefühle. Die Tränen. Ich betete Becky an, mein perfektes Kind. Alles würde zurück auf Anfang gestellt, wenn ich noch ein Kind bekäme. Außerdem war da das kleine Problem, dass Mike und ich einander kaum noch berührten. Das hätte mich vielleicht beunruhigen sollen, doch in Wirklichkeit wollte ich niemanden berühren oder berührt werden. Die seltenen Male, die wir uns liebten, schreckte ich zurück und fühlte nichts, tat lediglich so, als ob, und wandte das Gesicht ab. Ich war früher sehr leidenschaftlich gewesen, hatte es geliebt, zu umarmen und umarmt zu werden. Aber so war es nicht mehr.
Ich seufzte und drehte mich wieder zu Julie. »Wir können keine Kinder mehr bekommen, hat man uns gesagt«, flüsterte ich, sodass Mike es nicht hören konnte. Die Lüge ließ mich erbeben. »Wir sprechen nicht gerne darüber, vor allem Mike nicht«, fügte ich hinzu und schnitt eine Grimasse. Erneut berührte ich ihren Arm. »Du bist eine der wenigen, denen ich das erzähle.«
»Das tut mir sehr leid«, flüsterte Julie zurück. Ich konnte ihr an den Augen ablesen, wie sich die Anteilnahme mit dem Stolz mischte, eine der Wenigen zu sein, die Bescheid wussten.
»Aber lass uns nicht darüber reden«, sagte ich und fächelte mir mit der Hand Luft zu. »Erzähl mir von dir.«
Während Julie sich in den Problemen ihrer wunden Brustwarzen erging, schob ich die Sonnenbrille wieder hoch, um zu verbergen, dass ich gar nicht zuhörte, sondern in Gedanken bei der Handlung meines neuesten Romans war.
Ein strenger Winter. Ein verschwundenes Mädchen. Ein wilder Mann. Eine Welt weit weg von hier.
Ach ja, das wäre schön.
»Selma!« Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ärgerlich blickte ich auf, als eine rotgesichtige Frau in einem hellrosa Oberteil sich zwischen den Tischen hindurchdrängte. Sie gestikulierte wild, während ihr mürrischer Sohn ihr folgte.
Es war meine Kollegin Monica, die Büroleiterin, die jeden als beste Freundin ansah und alle, die zuhörten, mit intimen Details aus ihrem Leben versorgte, wie dem Zusammenbruch ihres Mannes, der Affäre ihrer Schwägerin und wie sehr sie in den letzten zwei Jahren unter Soor gelitten hatte. Ich tat mein Bestes, sie zu meiden und konnte mit ihrem sonnigen Gemüt nicht umgehen, vor allem Montagmorgens nicht. Doch in einem so kleinen Büro war das schwierig. Wir waren nur zehn und drängten uns in der obersten Etage einer kleinen umgebauten Scheune, wo wir für verschiedene Kunden Werbetexte zusammenschmierten. Gott sei Dank musste ich das nur drei Tage in der Woche ertragen.
»Hallo, Monica«, sagte ich mit einem angespannten Lächeln.
Ihr Sohn seufzte gelangweilt und verschränkte die Arme, während er aufs Meer hinaussah. Er war zehn, zwei Jahre älter als Becky, aber so groß wie sie, was alle, die Monica kannten, überraschte, denn sie war eine große Frau mit breiten Hüften und großen Brüsten. Das war etwas, das wir gemeinsam hatten: unsere Kurven – ein Kontrast zu den spindeldürren Frauen, aus denen die halbe Stadt zu bestehen schien.
»Oh, was ist Becky gewachsen!«, rief Monica und sah zu Becky hinüber, die inzwischen am Strand spielte. Ihre Stirn war sonnenverbrannt, Sommersprossen überzogen ihre kleine Nase, ihr langes blondes Haar war voller Sand und ihr Gesicht eisverschmiert. Mein Herz zog sich beim Anblick meiner wunderschönen, glücklichen Tochter zusammen. Alle erzählen einem von der Liebe, die man für sein Kind empfindet. Aber einige Mütter spüren sie im Wahnsinn der ersten Tage mit einem Neugeborenen nicht sofort. Doch wenn man sie spürt, verdrängt sie alle anderen Arten von Liebe. Selbst mir als Schriftstellerin fällt es schwer, sie zu beschreiben.
Ich winkte meine Tochter herbei und empfand plötzlich das verzweifelte Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen. Becky bahnte sich ihren Weg zwischen den Tischen, warf sich in meine Arme, legte ihre Wange an meinen Hals und die Liebe zu ihr überwältigte mich.
»Sie ist wirklich gewachsen«, antwortete ich und beugte mich vor, um ihr einen Kuss auf den Kopf zu geben. »Sie scheint jeden Tag größer zu werden.«
»Ich wünschte, bei Nathan wäre das auch so«, sagte Monica seufzend, während sie ihren Sohn ansah. »Es ist verblüffend, wenn man bedenkt, was er an Essen verputzt – und trotzdem, sieh ihn dir an!«
»Halt die Klappe, Mum«, zischte ihr Sohn im Flüsterton. Monicas Gesicht zuckte verletzt, und ob ich es wollte oder nicht, mir tat die Frau leid. Monica hatte mir – und allen, die es hören wollten – von den Problemen erzählt, die sie mit Nathan in der Schule hatte, von den Kämpfen, auf die er sich einließ, und dem Getuschel hinter ihrem Rücken. Auch Becky hatte gelegentlich davon erzählt.
Ich sah zu meiner Tochter hinunter, strich ihr über das weiche Haar und überlegte, wie glücklich ich war, dass ich sie hatte. Manchmal war sie eine Herausforderung, wie so viele Kinder. Aber sie war wirklich ein liebes Mädchen.
»Wie verkauft sich das Buch?«, fragte Monica, und ihr Gesicht leuchtete vor Aufregung.
»Gut«, antwortete ich lässig. Ich nippte schnell an meinem Gin, das Eis klirrte mir gegen die Zähne. »Über die genauen Verkaufszahlen erfährt man als Autor nicht so viel.«
»Nicht mal zwei Jahre, nachdem es erschienen ist?«, meldete Greg sich zu Wort.
Ich verkrampfte mich leicht. »Nein«, antwortete ich und trank schnell noch einen Schluck Gin.
»Und wann erscheint das nächste?«, fragte er.
Alle Blicke richteten sich auf mich, und ich spürte, wie ich rot wurde. Gewöhnlich liebte ich Aufmerksamkeit, aber nicht, wenn es um die Verkaufszahlen ging. »Ich werde es bald meinem Verleger vorstellen«, antwortete ich, so fröhlich ich konnte.
Mike runzelte die Stirn. »Wirklich?«
»Ja, wirklich, Liebling«, sagte ich.
»Wie aufregend!«, rief Monica. »Wart’s ab – du wirst die nächste Danielle Steel!«
Mike schnaubte, und ich warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Vielleicht irgendwann mal«, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln. Wenn mein Mann verdammt noch mal etwas optimistischer wäre, was meinen Erfolg angeht, hätte ich gerne hinzugefügt.
»Mum, nun komm endlich«, stöhnte Nathan ungeduldig. »Es wird gleich dunkel.«
Wir sahen alle zur Sonne hin, die inzwischen tief am Himmel stand und bald untergehen würde.
»Richtig, wir gehen jetzt lieber«, sagte Monica. »Nathan besteht auf einem Eis. Wir sehen uns nächste Woche in der Arbeit!« Sie winkte mir nervös zu und ging, blieb jedoch noch einmal stehen, um mit jemandem zu reden, während ihr Sohn frustriert die Hände zu Fäusten ballte.
Becky sprang von meinem Schoß und rannte wieder zum Strand, um mit ihrer Freundin zu spielen. Ich nutzte die Gelegenheit, die Augen hinter der Sonnenbrille zu schließen, und versuchte, zu dem Moment des Friedens zurückzufinden, den ich vorhin empfunden hatte. Doch dann spürte ich einen Ellenbogen, der mich anstieß. Verärgert über die Störung öffnete ich die Augen und beobachtete, wie Julie sich nach dem Musselintuch streckte, das auf den Boden gefallen war. Sie hielt das Baby an ihre von blauen Venen durchzogene Brust gedrückt.
»Komm, lass mich das machen«, sagte ich und beugte mich hinunter, um das Tuch für sie aufzuheben.
Als ich es ihr zurückgab, fiel mein Blick auf einen Mann, der bei den Kreidefelsen stand. Er war groß, über 1,80 Meter, langgliedrig und sonnengebräunt, sein blondes Haar reichte ihm bis zu den Schultern, und er hatte einen goldenen Bart. Am Arm trug er eine Reihe geflochtener Armbänder und seine blauen Shorts waren an der Tasche eingerissen. Er trug einen großen Rucksack mit einem Aufnäher, auf dem ein starres Auge zu sehen war.
Der Mann drehte sich um, als hätte er gespürt, dass ich ihn ansah. Er hielt meinem Blick stand, und mir stockte der Atem.
Dann gellte ein Schrei durch die Luft.
Mike hörte auf zu reden, Greg und Julie ebenfalls, als ein zweiter Schrei erklang. Andere Gäste standen von ihren Tischen auf und schirmten die Augen mit der Hand ab, um auf das Meer hinauszusehen.
Ich folgte ihren Blicken und sah eine Frau zum Rand des Wassers rennen, ihr hellrosa Oberteil flatterte in der Brise, als sie die sonnengebräunten Arme schwenkte.
Es war Monica.
»Mein Sohn!«, rief sie. »Er ertrinkt! Jemand muss ihm helfen, ich kann nicht schwimmen!«
Ich guckte in die Richtung, in die sie zeigte, und sah einen kleinen Kopf aus den Wellen auftauchen und wieder verschwinden.
»Mein Gott, er ist im Meer«, sagte ich.
Greg sprang auf und kickte seine Schuhe weg. »Ich geh rein.«
Julie griff nach seiner Hand. »Sei vorsichtig!«
Greg sah zu mir herüber, dann wieder zu seiner Frau. »Alles okay«, sagte er und lief zum Strand hinunter. Ich stieß Mike an, und er seufzte und folgte widerwillig seinem Freund. Die untergehende Sonne färbte sein kahl werdendes Haupt rot.
»Mein Gott, wie entsetzlich«, sagte Julie und drückte den kleinen Finn an sich.
Ich stellte mir Becky da draußen vor, wie ihr kleiner Körper von den Wellen verschlungen wurde, und mir wurde vor Entsetzen ganz schwindelig.
»Komm zu mir, Liebling«, rief ich ihr zu.
Becky sprang auf und kam zu mir herübergerannt. »Was ist los, Mummy?«, fragte sie, als ich sie an mich drückte und ihr einen Kuss auf den Scheitel gab.
»Der dumme Nathan ist im Meer, obwohl er das nicht darf«, antwortete ich.
»Die arme Frau«, sagte Julie und starrte Monica an, die verzweifelt im flachen Wasser stand. »Kennst du sie gut?«
»Nur von der Arbeit.« Ich beobachtete Monica, wie sie in die Wellen hineinmarschierte. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Dann sprang sie ängstlich wieder zurück. Sie nervte mich, doch wie sie versuchte, ihre offensichtliche Angst vor dem Wasser zu überwinden, die Panik in ihrem Gesicht …
»Pass du auf Becky auf, ja?«, sagte ich zu Julie. Ich stand auf, alles in meinem Kopf drehte sich plötzlich von dem Gin, dann bahnte ich mir einen Weg zwischen den Tischen und Stühlen hindurch.
»Oh, Selma!«, rief Monica, als ich bei ihr war, und umklammerte meine Hand. »Was, wenn sie ihn nicht kriegen?«
»Alles wird gut gehen, guck mal, die vielen Leute, die ihm helfen!«
Als ich das sagte, sah ich den Mann, den ich bei den Kreidefelsen gesehen hatte, zum Wasser gehen. Er war ruhiger als die anderen, doch seine langen Schritte hielten mit ihren mit. Direkt vor ihm folgte Mike Greg ins Wasser, plantschte ungeschickt in die Wellen und fiel fast hin. Greg drehte sich um, um ihm zu helfen. Doch der Mann marschierte mühelos ins Meer, die letzten Strahlen der untergehenden Sonne beleuchteten seine Umrisse.
»Oh Gott, ich kann meinen Jungen nicht sehen. Siehst du ihn?«, fragte Monica. Ihre Finger krallten sich in meinen Arm, und sie wurde blass. »Es wird so dunkel!«
Ich trat einen Schritt vor und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Monica hatte recht, es war inzwischen schwer, Nathan auszumachen. Die Sonne war untergegangen, der Himmel war indigoblau. Doch ich sah den Mann, sein Haar glänzte wie Silber in der zunehmenden Dunkelheit. Während die anderen Möchtegernretter ziemlich planlos waren, wirkte er gelassen.
Er schien nahezu auf den Wellen zu gehen.
»Geht dieser Mann auf dem Wasser?«, sprach eine Frau in der Nähe aus, was ich dachte. Andere Leute lachten nervös, aber ich wusste, dass sie das Gleiche sahen.
Ich trat noch ein paar Schritte vor, mein Herz klopfte, während meine Blicke weiter auf den Mann gerichtet waren, auf seine sonnengebräunten Waden, seine Knöchel … und auf seine Füße. Es sah tatsächlich so aus, als wäre das Wasser Eis, und er würde einfach darübergehen.
»Jesus«, flüsterte ich vor mich hin.
Stille legte sich über die Bucht, auch die anderen waren sich eindeutig nicht sicher, was sie da sahen.
»Da muss das Licht uns einen Streich spielen«, brach ein Mann das Schweigen. Doch ich konnte den Zweifel in seiner Stimme hören.
Der Mann blieb stehen, beugte sich vor und zog etwas hoch.
»Er hat ihn!«, rief jemand. Ein nervöses Jubeln ging durch die Menge.
Monica sackte gegen mich und weinte vor Erleichterung, während wir zusahen, wie der Mann zum Ufer zurückkam. Der Junge in seinen Armen schien schwerelos. Der Mann ging jetzt eindeutig im Wasser; vielleicht war es wirklich nur eine Täuschung des Lichts gewesen.
Die Leute beobachteten ihn mit offenem Mund, als er in der Dunkelheit auf uns zukam.
»Mummy!«, schniefte Nathan und streckte die Arme nach seiner Mutter aus. Sie nahm ihn dem Mann ab und vergrub ihr Gesicht in dem nassen Nacken ihres Sohns, während sie auf den Sand sank.
Der Mann sah mich an. Etwas passierte zwischen uns, etwas, das ich nicht richtig ausmachen konnte. Dann beugte er sich hinunter, nahm seinen Rucksack und verschwand in der Nacht. Der Klang von Sirenen erfüllte die Luft.
»Kanntest du den Mann, Mummy?«, fragte Becky und sah mit ihren wissenden blauen Augen zu mir hoch.
»Nein, Liebling, das war ein völlig Fremder.«
»Er ist ein völlig Fremder, Kay!«, sagt Becky, während sie in ihrem Kalender die Details zu ihrem nächsten Termin studiert. »Ich werde mich auf keinen Fall mit ihm treffen.«
»Da ist doch bloß eine Party, da sind jede Menge anderer Leute«, kontert Kay. Die Brille rutscht ihr von der Nase, ihre weiße Bluse ist nach einem turbulenten Tag in der Praxis fleckig und zerknittert.
»Falls du mir vorschlagen willst, dass er mich vorher abholt und auf einen Drink einlädt, ist das ganz klar ein Date«, sagt Becky. »Summer muss sich ohnehin noch von der Operation erholen. Ich kann sie nicht alleine lassen.«
»David ist doch gleich nebenan! Außerdem ist das vierzehn Tage her, und du weißt besser als jeder andere, dass sie inzwischen wieder völlig wiederhergestellt ist.« Kays Gesicht wird ernst. »Ich weiß, dass das nur eine Ausrede ist. Egal, wie sehr ich deine Köter mag, drei Hunde sind kein Ersatz für menschliche Gesellschaft, vor allem nicht für eine attraktive vierunddreißigjährige Frau wie dich.«
»Es tut mir leid, da muss ich dir widersprechen.« Becky beugt sich vor, legt ihrer Freundin die Hand auf die Schulter und lächelt. »Ich weiß deine Versuche zu schätzen, mich zu verkuppeln, aber ich bin ganz zufrieden damit, wie es ist, danke.«
Kay verschränkt die Arme vor der Brust und sieht sie misstrauisch an, als die Türklingel geht.
»Perfektes Timing«, sagt Becky mit einem Zwinkern, als eine Frau mit einer Plastikbox in der Hand hereinkommt, gefolgt von einem etwa achtjährigen Mädchen. Becky beugt sich hinunter und lächelt sie an. »Du musst Jessica sein. Und das ist Stanley?«, sagt sie und zeigt auf die Box. Das Mädchen nickt schüchtern. »Kommt rein, uns hat jemand abgesagt, sodass wir ausnahmsweise einmal gut in der Zeit liegen.«
Becky führt sie in das winzige Behandlungszimmer. Es ist eine kleine Praxis in einem Backsteingebäude am Rand eines großen Felds, hier arbeitet sie als Ärztin, zwei Tierarzthelferinnen, die sich eine Stelle teilen, ein weiterer Arzt, der stundenweise arbeitet, und Kay, Empfangsdame und Buchhalterin der Extraklasse. Mehr als genug für das kleine Dorf, in dem sie leben.
Die Frau stellt die Plastikbox auf den Behandlungstisch und öffnet sie.
Becky sieht lächelnd hinein. »Was für ein schönes Tier«, ruft sie.
Das Mädchen strahlt vor Stolz, während die Mutter das Aquarium vorsichtig aus der Box hebt. Becky beugt sich hinunter und sieht sich den Goldfisch an, seine transparente orange Haut, die Kugelaugen und das sich bewegende Maul. Ein Kommilitone von ihr hat Goldfische als Zeitverschwendung bezeichnet. Wenn er sehen könnte, wie das kleine Mädchen diese Zeitverschwendung gerade ansieht, würde er vielleicht verstehen, dass Goldfische – wie alle anderen Tiere auch – alles andere als Zeitverschwendung sind.
Vielleicht würde er es auch nicht verstehen. Schließlich hatte er etwas von einem oberflächlichen Idioten an sich gehabt.
»Es freut mich, dass du ihn hergebracht hast«, sagt Becky.
Das kleine Mädchen verschränkt die Arme und runzelt die Stirn. »Es ist eine Sie.«
Becky sieht zu der Mutter hin, die leicht die Achseln zuckt.
»Aha. Eine Sie. Entschuldige«, sagt Becky. »Nun, ich kann dir schon jetzt sagen, dass es nichts Ernstes ist. Du hast sie rechtzeitig hergebracht.«
»Was fehlt Stanley denn?«, fragt das Mädchen.
Becky zeigt auf die kleinen weißen Punkte auf Stanleys Flosse. »Sie hat Flossenfäule«, erklärt sie. Die blauen Augen des Mädchens werden ganz groß. »Aber es besteht kein Grund zur Sorge«, fügt Becky schnell hinzu. »Dank deiner Umsicht wird es Stanley bald wieder gut gehen.«
Das Mädchen lächelt, und ihr kleines Gesicht leuchtet auf.
Ihre Mutter drückt ihre Schulter. »Siehst du? Was hab ich dir gesagt?«
Becky beobachtet sie und kann nicht verhindern, dass sie einen Hauch von Eifersucht verspürt. »Also«, sagt sie und räuspert sich, »habt ihr Salz zu Hause?«
Das Mädchen sieht zu seiner Mutter hoch, die nickt.
»Gut. Damit werden wir Stanley behandeln. Gib jeden Tag ein paar Teelöffel Salz ins Aquarium und innerhalb einer Woche ist sie wieder fit.« Becky dreht sich um und tippt ein paar Notizen in ihren Computer. »Es ist gut, dass Stanley so eine liebevolle Besitzerin hat. Fische sind sehr wichtig. Du weißt doch, dass sie zuerst auf der Welt waren, noch vor uns Menschen, sogar noch vor den Dinosauriern? Und wie du siehst, gibt es sie noch immer«, sagt sie und zeigt auf das Aquarium. »Eine beachtliche Leistung.«
»Sie sind die besten Haustiere der Welt«, sagt das Mädchen ruhig, während ihre Mutter das Aquarium zurück in die Box hebt.
»Da stimme ich dir zu«, sagt Becky. »Obwohl das meine drei Hunde womöglich verärgern könnte. Ich denke, Stanley ist für heute fertig. Ruf an, wenn es Probleme gibt.«
»Sie waren großartig, danke«, sagt die Mutter des Mädchens, als sie die Praxis verlassen. »Sag danke, Jess.«
»Danke«, sagt das Mädchen schüchtern.
»Es war mir ein Vergnügen.«
Als sie gegangen sind, geht Becky zurück ins Behandlungszimmer und lässt sich gähnend auf ihren Stuhl fallen. Sie liebt es, am Ende eines Arbeitstages einfach die Augen zu schließen und einen Moment zu entspannen. Sie hat ihr Bestes getan, um das Behandlungszimmer so gemütlich wie möglich zu gestalten. Eine Wand hängt voller Dankesschreiben von ehemaligen Patienten; auf ihrem kleinen, aufgeräumten Schreibtisch stehen Fotos ihrer drei dürren Suki-Whippet-Mischlinge Summer, Womble und Danny und über dem Schreibtisch hängt ein Bücherregal mit einer breiten Auswahl an medizinischen Fachbüchern. Aber darunter stehen auch einige Liebesromane, die Patienten Becky geschenkt haben, nachdem Kay hat durchblicken lassen, dass Becky insgeheim ein Fan von Liebesromanen ist. Inzwischen sind die Bücher, die sie von ihren Stammpatienten zu Weihnachten bekommt oder von einem Tierfreund, der ihr danken möchte, ein Running Gag. Becky liebt diese Geschichten und verschlingt sie, wann immer sie Zeit dazu hat. Aber das ist es auch schon mit der Romantik in ihrem Leben. Vor zehn Jahren hat ihr Freund, den sie seit der Schulzeit hatte, kurz vor ihrem Zehnjährigen Schluss gemacht. Seitdem hat es eine Reihe von schlechten Dates gegeben, doch in der letzten Zeit hat sie immer öfter gedacht, dass ein Leben nur mit den Hunden perfekt sein könnte, trotz allem, was Kay denkt.
Beckys Blicke wandern zu dem Foto am Ende der Bücherreihe. Es zeigt sie am Tag der Abschlussfeier der Tierärztlichen Fakultät vor fünf Jahren. Ihr Vater steht steif neben ihr, einen Anflug von Stolz im Gesicht. Sie sollte eigentlich auch stolz sein, wenn sie dieses Foto ansieht, doch stattdessen denkt sie oft daran, wer an diesem Tag nicht da war: ihre Mutter.
Becky schiebt die Gedanken an sie weg und konzentriert sich auf ihren Vater. Wie sehr sie ihn vermisst, selbst ihre Mittagessen, die sie schweigend miteinander eingenommen haben. In den vielen gemeinsamen Jahren haben sie sich wohlgefühlt miteinander. Wenigstens ist er jetzt glücklich. Das ist wichtig, auch wenn er mit seiner zweiten Frau, Cynthia, weit weg in Wales lebt.
Becky lächelt über das stolze Gesicht ihres Vaters auf dem Foto, dann greift sie nach dem hellblauen Rucksack, wirft ihn sich über die Schulter und geht zur Anmeldung. »Das war die letzte Patientin für heute, Gott sei Dank«, sagt Kay, steht auf und streckt sich. »Diese Woche ist mir endlos lang vorgekommen. Das muss an der Hitze liegen. Hast du Pläne fürs Wochenende?«
Becky zuckt mit den Schultern. »Das Übliche.«
»Lange Spaziergänge. Abendessen für einen …«
»Für vier«, unterbricht Becky sie.
»Ach ja, die Hunde. Und, lass mich raten, ausgiebig Zeit zum Lesen?«
Becky lacht. »Du kennst mich gut.«
»Du weißt, dass du jederzeit vorbeischauen kannst, wenn du dich einsam fühlst.«
»Danke, aber ich fühle mich nicht einsam, ehrlich nicht.«
Kay sieht sie misstrauisch an. »Egal, denk daran, dir ein neues Kleid für meine Party nächsten Monat zu kaufen.« Becky will etwas sagen, doch Kay hebt abwehrend die Hände. »Ich weigere mich, mir irgendwelche Ausreden anzuhören. Ich werde fünfzig. Fünfzig! Wenn du mich wirklich so gern magst, wie du immer sagst, dann kommst du. Außerdem hast du die Chance, die Familie kennenzulernen, über die ich jeden Tag lästere!«
Becky lächelt zaghaft. Sie kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als eine große Familienfeier, selbst wenn sie für ihre Freundin ist. »Ich muss sehen, wie es Summer geht.«
»Das nehme ich mal als Ja«, sagt Kay mit einem Zwinkern.
Sie lachen und folgen der abendlichen Routine: Licht aus und Praxis abschließen. Dann treten sie in die Hitze des Abends hinaus. Vor ihren erstreckt sich das Feld.
»Ein schönes Wochenende!«, ruft Becky, als Kay den Weg hinunterflitzt, zweifellos in Eile, nach Hause zu kommen, um eins ihrer Teenagerkinder zum Fußball oder zur Tanzstunde zu bringen.
Becky hat keinen Grund zur Eile. Sie bleibt einen Moment stehen und atmet die warme, nach Blumen und Gräsern duftende Luft ein. Das ist einer der Vorteile, wenn man nicht zu jemandem nach Hause eilen muss, denkt sie. Sie kann sich Zeit für die einfachen Dinge nehmen und die Schönheit dieses heißen Sommerabends einatmen.
Nach einer Weile schlägt sie den Weg über die Felder ein und folgt dem Pfad, den die Hundebesitzer ins Gras getreten haben. Kay wohnt nahe der gepflasterten Hauptstraße, fünf Minuten in die andere Richtung, doch Becky lebt abgeschieden in einem der vier Cottages, die in einer Reihe stehen und das Feld überblicken. Alle Cottages sind klein, haben aber große Gärten, deren Tore direkt aufs Feld führen, ideal für Hunde. Sie erinnert sich noch, wie sie und ihr Dad, kurz nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte, auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause durch genau dieses Dorf gefahren sind. Das ist inzwischen fünfundzwanzig Jahre her. »Das ist ein schönes Dorf«, hat Becky damals zu ihm gesagt.
»Zu klein«, hatte er geantwortet. »Busby-on-Sea ist sehr viel besser, du wirst sehen. Es gibt sogar ein Freizeitzentrum. Und außerdem wohnen deine Großeltern dort.«
Ein Dorf mit nur einem Geschäft und ohne Freizeitzentrum waren ihr damals schon perfekt erschienen. Doch sie hatte gewusst, dass ihr Vater Familie um sich brauchte. Sie erinnert sich, ihn gefragt zu haben, wann ihre Mutter nachkommen würde. Sie hatte zwar gewusst, sie würde nicht kommen, »das Gespräch« war erst zwei Wochen her gewesen. Aber Becky hatte trotzdem fragen müssen, nur um sicherzugehen.
»Mummy bleibt in Queensbay, das weißt du doch?«, hatte ihr Vater geantwortet und dabei traurig und ärgerlich zugleich ausgesehen. »Aber sie kommt zu Besuch. Ich glaube, du wirst dich in Busby-on-Sea wohlfühlen. Das glaube ich wirklich, Becks.«
Als Becky daran denkt, meldet sich eine weitere Erinnerung. An den Klang der Wellen. Den Sand zwischen den Zehen. An ihre Mutter, die lächelnd zu ihr herunterblickt, die Nase voller Sommersprossen von der Sonne, die blauen Augen leuchtend.
»Ich glaube, du wirst dich hier wohlfühlen, das glaube ich wirklich.«
Und hinter ihr der Eingang einer Höhle.
»Becky!« Die Erinnerung versiegt, als ein Paar um die siebzig auf sie zukommt. Ihr goldbrauner Labrador springt auf sie zu, um sie zu begrüßen, einer ihrer vielen Patienten.
Sie bleibt stehen, beugt sich hinunter und drückt ihre Nase gegen die nasse Nase des Hundes. »Hallo, Sandy!«, sagt sie. »Was macht dein Ohr?«
»Es ist besser, dank Ihnen, Becky«, sagt die Frau, bereits im Weitergehen. Offensichtlich sind sie und ihr Mann auf dem Weg irgendwohin und Sandy folgt ihnen. Becky fragt sich, wohin sie gehen. Vielleicht zu einem Essen mit Freunden. Ins Kino. Oder auch nur zu einem Film zu zweit zu Hause. Sie haben einander, was immer auf sie wartet. Becky spürt die Einsamkeit wie einen plötzlichen stechenden Schmerz und denkt daran, was Kay vorhin gesagt hat.
Aber sie hat unrecht, Becky fühlt sich nicht einsam. Wann immer sie sich Gesellschaft wünscht, muss sie nur hier hinaus aufs Feld gehen, wo sie mit Sicherheit irgendeinen Dorfbewohner mit seinem Hund trifft. Man hat hier ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl. Ihr Dad hatte das anders gesehen, als sie ihm vor vier Jahren gesagt hatte, dass sie aus Busby-on-Sea wegziehen würde, dem Ort, der seit ihrem achten Lebensjahr ihr Zuhause gewesen war. Doch sie hatte die Unabhängigkeit gebraucht, selbst wenn ihr neuer Wohnort nur eine Autofahrt von zwanzig Minuten entfernt lag. Und ihr Vater hatte seine Unabhängigkeit auch gebraucht. Nachdem Becky ausgezogen war, hatte er den Kontakt zu seiner alten Freundin Cynthia verstärkt. Und jetzt waren sie verheiratet!
Becky kommt zum Ende des Felds und bleibt an dem Zaun stehen, der die vier großen Gärten der Cottages abtrennt. Ihr Cottage liegt am Ende der Reihe und sieht mit seinen geweißten Wänden und dem Reetdach genauso aus wie die drei anderen.
In dem Garten neben ihrem sitzt David in einem Sessel und liest in einem Buch. Sein Cavalier King Charles Spaniel Bronte liegt zu seinen Füßen und Beckys drei Lurcher haben sich in der Abendsonne auf dem Rasen ausgestreckt. Summer hat kurzes kastanienbraunes Fell und große braune Augen mit langen Wimpern. Danny ist schwarz wie die Nacht, langhaarig und schön. Womble ist der Längste und Größte der drei – grau, neugierig und der schnellste Hund, der ihr je untergekommen ist. Alle sind Streuner, die zur Behandlung in die Praxis gebracht und von Becky gerettet wurden, die eine Schwäche für »Dürre« hat, wie sie sie nennt. Der armen Summer ging es am schlechtesten, sie war von der Polizei abgeliefert worden, nachdem sie, wie per Anzeige dokumentiert, mit einem Seil an der Stoßstange festgebunden worden war, um hinter dem Auto her möglichst schnell zu laufen. Heute noch hat sie Angst vor Fremden und versteckt sich hinter Beckys Beinen, wenn sich ihr jemand anders als David nähert.
Summer sieht Becky als Erste, als sie das Tor zu Davids Garten öffnet. Die Hündin steht vorsichtig auf, streckt sich und humpelt zu Becky hinüber. Sie trägt immer noch den Verband von der Operation, mit der Becky ihr gebrochenes Bein gerichtet hat, und vergräbt ihre Nase in Beckys Bauch.
»Hallo, mein Schatz«, sagt Becky, streichelt sie und beugt sich vor, um ihr einen Kuss auf den Kopf zu geben, während sich die Ohren der anderen Hunde beim Klang ihrer Stimme aufrichten. Auch sie springen auf und tappen herüber.
»Summer war die reinste Katastrophe heute«, sagt David mit einem Lächeln, das zeigt, wie sehr er diese Katastrophe geliebt hat. Er ist in den Sechzigern, groß, hat kurzes graues Haar und ein spitzbübisches Lächeln. Er ist vor vier Jahren, nur wenige Monate nach Becky, hergezogen und über ihre Liebe zu Tieren haben sie sich auf Anhieb verstanden. Sie sprechen meistens über Hunde, aber David hat einmal erwähnt, dass er und seine Frau sich vor vielen Jahren getrennt haben und dass es eine gemeinsame Tochter gibt, die im Ausland lebt.
»Danke, dass du auf sie aufgepasst hast«, sagt sie mit einem Lächeln.
»Es ist mir immer ein Vergnügen.«
Gelegentlich nimmt sie die Hunde mit in die Praxis, aber es ist nicht leicht, drei große Hunde auf so kleinem Raum zu beschäftigen. Meistens passt David auf sie auf und kommt in den Pausen mit ihnen vorbei.
Becky beugt sich vor und tätschelt Brontes Kopf. Die klopft mit ihrem federweichen Schwanz leicht auf den Boden, dann legt sie ihr kleines Kinn wieder auf die Pfoten. Sie ist eine weitere gerettete Hündin, die man vor zwei Jahren in die Praxis gebracht hat, eine ehemalige Zuchthündin, die der Züchter nach einer Infektion loswerden wollte. David hatte sofort Gefallen an ihr gefunden, und nachdem sein letzter Cockerspaniel gestorben war, hatte er sie schließlich adoptiert.
»Dann auf nach Hause«, sagt Becky, während sie auf ihren Oberschenkel klopft und in Richtung des Zauns geht, der ihre beiden Gärten voneinander trennt.
»Lust auf eine Tasse Tee?«, ruft David ihr hinterher.
»Morgen«, ruft sie zurück. »Ich bin so erschöpft, ich denke, ich gehe direkt nach dem Abendessen ins Bett.«
Er lacht. »Du arbeitest zu viel.«
Becky steigt über den Zaun, gefolgt von den Hunden, und betritt ihr Cottage. Alle drei Hunde sprinten sofort in den hinteren Teil des Hauses zu ihren Fressnäpfen, während sie sie ungeduldig ansehen, begierig auf ihr Abendessen.
»Okay, okay, lasst mir mal eine Minute Zeit!«, ruft Becky.
Sie wirft ihre Schlüssel auf die Treppe und geht durch die kleine Diele in die Küche, die überraschend geräumig ist, wenn man bedenkt, wie klein das Cottage ist, sie bietet genug Platz für einen großen Kieferntisch in der Mitte des Raumes.
Becky füttert die Hunde, dann bereitet sie ihr eigenes Abendessen zu, eine schnelle Chinapfanne. Als sie mit Kochen fertig ist, tut sie sich auf und geht mit ihrem Essen und einem Buch – einem weiteren Liebesroman – auf die Terrasse hinaus. David ist inzwischen ins Haus gegangen. Becky lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und blinzelt zur Sonne hoch. Sie mag diese Tageszeit, wenn es noch warm genug ist, um draußen zu sitzen, aber kühl genug, dass sie sich keine Sorgen machen muss, mit ihrer hellen Haut einen Sonnenbrand zu bekommen. Ein Vogel schwingt sich in die Höhe – und fliegt vielleicht nach Kent, wo sie früher gelebt hat.
Das Telefon klingelt und stört sie in ihren Gedanken. Sie seufzt. Warum passiert das immer gerade dann, wenn sie sich zum Essen hingesetzt hat? Sie stellt den Teller ab und steht auf, dann geht sie schnell nach drinnen und greift nach dem Hörer.
»Hallo?«
»Becky?«
Die Stimme ist schwach, kaum zu verstehen. Sie hat sie seit Jahren nicht gehört, aber sie erkennt sie sofort. Diese Stimme hat sich in ihr Herz gebrannt.
»Mum?«